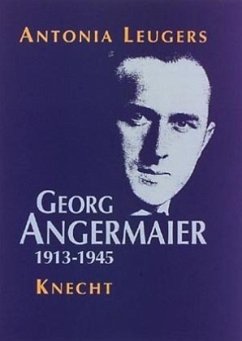Die Biographie zeichnet Werdegang und Einsatz dieses Juristen und Offiziers, dem seine Kirche wie sein Land gleichermaßen Verpflichtung waren, kenntnisreich nach. Angermaiers Tagebücher, von 1941 bis kurz vor seinem mysteriösen Tod 1945 niedergeschrieben, erhellen seine religiösen, kulturellen und politischen Anschauungen. Wichtige Texte aus dem "Kreisauer Kreis" können ihm eindeutig zugeschrieben werden. Das vorliegende Buch ist dem Andenken eines Jugendfreundes von Julius Döpfner gewidmet und stellt ein wichtiges Dokument der allgemeinen Zeitgeschichtsforschung dar.

Eine überfällige Geschichte des Ausschusses für Ordensangelegenheiten
Antonia Leugers: Gegen eine Mauer bischöflichen Schweigens. Der Ausschuß für Ordensangelegenheiten und seine Widerstandskonzeption 1941-1945. Verlag Josef Knecht, Frankfurt am Main 1996. 560 Seiten, 16 Abbildungen, 98,- Mark
Antonia Leugers: Georg Angermaier 1913-1945. Katholischer Jurist zwischen nationalsozialistischem Regime und Kirche. Lebensbild und Tagebücher. Verlag Josef Knecht, Frankfurt am Main 1997. 444 Seiten, 2. Auflage, 78,- Mark.
Der Jesuit Lothar König litt an Krebs. Trotzdem legte er im Kriegsjahr 1941 77000 Kilometer zurück, zumeist mit der Eisenbahn, manchmal auch im Flugzeug. Auch der Dominikaner Odilo Braun, wie Rösch in Zivil, legte in jenem und in den folgenden Jahren immense Entfernungen zurück. König und Braun waren Kuriere. Sie reisten vor allem zwischen München, Würzburg, Fulda und Berlin, überbrachten Botschaften und Textentwürfe, vermittelten Kontakte. Ihre beiden Ordensoberen Augustinus Rösch und Laurentius Siemer, Provinzial der oberdeutschen Provinz des Jesuitenordens der eine, Provinzial der Dominikanerprovinz Teutonia der andere, wußten um die konspirative Tätigkeit der beiden Männer. Denn auch sie gehörten dem "Ausschuß für Ordensangelegenheiten" an, der sich 1941 angesichts der Beschlagnahmungen und Enteigungen von Ordenshäusern durch das nationalsozialistische Regime konstituierte. Absicht der Ordensleute war aber nicht nur, die Bischofskonferenz dazu zu bewegen, den Nationalsozialisten dort entschiedener entgegenzutreten, wo es um die Rechte der Institution Kirche ging. Vor allem Georg Angermaier, Justitiar der Diözesen Würzburg und Bamberg und einziger Laie im Ausschuß, trat dafür ein, daß die Bischöfe ihre Stimme auch gegen die Verletzung der Menschenrechte erheben müßten.
Im deutschen Episkopat fand diese Position nie eine Mehrheit. Im Gegenteil. Der Bischof von Berlin, Konrad Graf von Preysing, und der Bischof von Fulda, Johannes Dietz, waren lange Zeit die einzigen, die sich der Kirchenpolitik des Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz, des Breslauer Kardinals Bertram, und des vatikanischen Nuntius Orsenigo widersetzten. Zum Eklat kam es allerdings erst 1940, als Bertram dem Führer zu dessen Geburtstag auch noch Glückwünsche sandte. Bertram hatte seit jeher anstatt auf offenen Widerstand auf schriftliche Korrespondenz, Eingaben an staatliche Stellen und persönliche Fühlungnahme durch zwei Emissäre, die Bischöfe Wienken und Berning, gesetzt. Gemeinsamen Worten der Bischöfe stand er selbst in den Kriegsjahren ablehnend gegenüber, getrieben von der Furcht, bei einem öffentlichen Eintreten für die Menschenrechte werde die Kirche zerschlagen und ihr damit die Möglichkeit genommen, für das Heil der Seelen zu wirken.
Für Preysing, den Kontrahenten Bertrams, war mit den Glückwünschen des Jahres 1940 - weitere sollten folgen - die Grenze überschritten. Die eine Gruppe meine, daß die katholische Kirche sich mit dem totalitären Staat abfinden könne und daß die vorhandenen Schwierigkeiten nicht notwendig mit diesem Staatsleben zusammenhingen und daher auch abgestellt werden könnten, so umriß er vor dem Plenum der Bischofskonferenz 1940 die Position Bertrams und der großen, schweigenden Mehrheit der deutschen Bischöfe. Sein Standpunkt war ein anderer und wurde von wenigen geteilt, außer von Dietz am ehesten von dem Münchener Kardinal Faulhaber, Erzbischof Gröber aus Freiburg und - erst später - von dem Münsteraner Bischof Graf von Galen: Die andere Gruppe glaube, daß ein freundschaftliches, gedeihliches Zusammenleben zwischen dem totalitären Staat von heute und der katholischen Kirche unmöglich sei, so verzeichnete es Preysings Mitarbeiter Adolphs.
Als im Jahr 1941 die Lage der Orden immer schwieriger wurde, die Bischofskonferenz sich aber nicht bereit fand, sich schützend vor sie zu stellen, schlossen sich Preysing, Dietz, die Ordensleute und Angermaier zusammen. Unterstützt von Papst Pius XII., der Bertrams Linie vorsichtig kritisierte, und (immerhin) mit der Billigung der Bischofskonferenz jenes Jahres, bildeten sie den "Ausschuß für Ordensangelegenheiten". Er wurde zum einzigen kirchlichen Gremium jener Jahre, dessen Arbeit mit dem Begriff "Widerstand" zutreffend beschrieben ist. Nicht nur das wenige, was die deutschen Bischöfe gemeinsam oder einzelne von ihnen unternahmen, um den Nationalsozialisten Einhalt zu gebieten, ging von den Mitgliedern des Ordensausschusses aus. Sie konnten auch den Klostersturm im Elsaß verhindern und Kardinal Bertram dazu bewegen, sich dem geplanten Gesetz zur Zwangsscheidung von "rassischen Mischehen" zu widersetzen (was viele Katholiken betroffen hätte). Selbst die berühmten Galen-Predigten des Jahres 1941, mit denen der Münsteraner Bischof gegen die planmäßige Ermordung Behinderter protestierte, tragen zum Teil die Handschrift des Ordensausschusses. Preysing und die Jesuiten knüpften Verbindungen zu Widerstandskreisen um Goerdeler und den späteren Verschwörern des 20. Juli - Preysing traf Graf Stauffenberg zum letzten Mal drei Wochen vor dem Attentat auf Hitler und gab ihm seinen Segen -, um Laurentius Siemer herum bildete sich in Köln ein Gesprächskreis.
Sie alle gaben Informationen über die Vernichtung der Juden und der Zigeuner nicht nur untereinander weiter, sondern auch an die Bischöfe und den Papst. Vergebens. Pius XII., über vieles genau informiert, schwieg, die deutschen Bischöfe, die aus ihrer Ablehnung der nationalsozialistischen Rassenlehre nie einen Hehl gemacht hatten, beschränkten sich in ihrem Dekalog-Hirtenbrief des Jahres 1943, dem ersten und einzigen gemeinsamen Wort während der Kriegsjahre, auf allgemeine Bemerkungen über Verletzungen der Menschenrechte. Sie hätten "entsetzlich geschwiegen zu so vielem und Furchtbaren", schrieb Rösch im selben Jahr.
Das Scheitern des Attentats auf Hitler bedeutete auch das Ende des Ordensausschusses. Preysing und Dietz, deren Verbindungen zum Widerstand nicht entdeckt wurden, blieben unbehelligt, Rösch und Braun flohen, wurden verhaftet und überlebten, Siemer und König tauchten bis zum Mai 1945 unter, Angermaier kam in den letzten Kriegstagen bei einem mysteriösen Unfall ums Leben. 1941 hatte er notiert, "daß unsere Ungesichertheit und unser totales Wagnis unsere einzige, aber unerschütterliche Sicherheit sind".
Mehr als fünfundfünfzig Jahre sind seit der Konstituierung des Ausschusses vergangen. Seine Entstehungsgeschichte und seine Arbeit sind erst jetzt zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung geworden - als habe man geahnt, daß die Geschichte selbst über die "gekünstelt theoretischen, zuweilen apologetisch gewendeten Widerstandsstufen-Modelle", wie die Verfasserin Antonia Leugers vielsagend formuliert, richten werde. Die Autorin stammt eben nicht aus dem Umfeld der katholischen "Kommission für Zeitgeschichte", sondern wurde an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster mit einer Arbeit über den Juristen Angermaier promoviert. Ihre weitergehenden Forschungen über den Ordensausschuß und die Rolle der Bischofskonferenz in jenen Jahren liegen nun auf 350 Textseiten vor, ergänzt um zahlreiche Tabellen und Schaubilder, einen Datenüberblick, annähernd hundert Seiten Anmerkungen und ein umfassendes Quellen- und Literaturverzeichnis. Die zahlreichen ungedruckten Quellen, die Frau Leugers zum Teil selbst aufgefunden und erstmals erschlossen hat, und die Auskünfte von mehr als fünfzig Zeitzeugen tauchen viele Vorgänge jener düsteren Zeit in helleres Licht. Vor allem aber verleihen sie ihrer Arbeit ein Maß an Unmittelbarkeit und Genauigkeit, das nicht mehr übertroffen werden kann. DANIEL DECKERS
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main