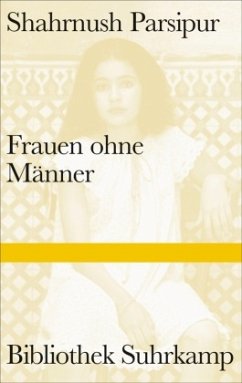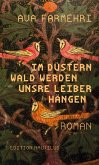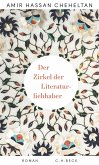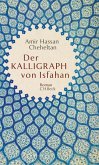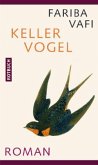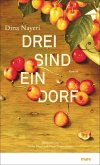Jahre vor der Islamischen Revolution von 1979 fliehen fünf Frauen aus unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten Teherans aus ihrem Lebensunglück aufs Land. Sie geraten in ein Haus, das eine vermögende Frau sich nach der Trennung von ihrem Mann gekauft hat. Es wird zum Zufluchtsort. Ein prekäres Zusammenleben beginnt. Geschichten sind zu erzählen, Wunden zu heilen, Wünsche anzupacken. Nach einiger Zeit und vielen Turbulenzen zerstreuen sich die Frauen wieder: das Leben (und Sterben) geht weiter. Als Parsipur ihren Roman 1990 in Teheran veröffentlichte, wurde er umgehend verboten. 2009 wurde der Film "Women Without Men", den Shirin Neshat nach dem Buch drehte, bei den Filmfestspielen in Venedig ausgezeichnet.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Geradezu beglückt zeigt sich Stefan Weidner von Shahrnush Parsipurs Roman "Frauen ohne Männer", der, 1989 auf Farsi erschienen, nun endlich in deutscher Übersetzung vorliegt. Weidner schätzt die iranische Autorin, die im Exil in den USA lebt, als eine der wichtigsten Schriftstellerinnen ihres Landes. Die Verfilmung von "Frauen ohne Männer" - der Film erhielt 2009 bei den Filmfestspielen in Venedig einen Silbernen Löwen - hat zu seiner Freude das Interesse der westlichen Verlage geweckt. Der Rezensent stellt klar, dass das Buch wesentlich besser als der Film ist. Den fünfzehn kurzen Kapiteln, die vom Schicksal von fünf Frauen aus den 50er Jahren im Iran mit teils phantastischen Wendungen erzählen, attestiert er Tiefsinn, subtilen Witz und eine große Leichtigkeit. Die Metamorphosen, die diese Frauen erleben, haben es seines Erachtens in sich. Das Fazit des Rezensenten: große Literatur.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Fünfzehn Kapitel über fünf Frauen aus den fünfziger Jahren: Shahrnush Parsipurs Roman "Frauen ohne Männer" erzählt von persischen Metamorphosen.
Leidgeschwängert ist sie, tiefschwarz und vom Tode besessen, die iranische Literatur der Gegenwart. Meisterwerke sind darunter wie "Die blinde Eule" von Sadeq Hedayat, der klassisch-realistische Roman "Savushun" (im Deutschen "Drama der Trauer") von Simin Daneshwar oder die Epen über die iranischen Dörfer von Mahmud Doulatabadi. Aber nachdem Daneshwar in diesem Frühjahr im Alter von 91 Jahren verstarb, fehlen die hochkarätigen Autorinnen. Fattaneh Haj Seyed Javadis Bestseller "Morgen der Trunkenheit" liest sich zwar streckenweise wie Dostojewski, wird aber von gebildeten Iranern als Trivialliteratur abgetan; so dass wir gestehen, über die persischsprachige Frauenliteratur der Gegenwart beschämend wenig zu wissen.
Doch es gibt noch Shahrnush Parsipur! 1946 in Iran geboren, hat sie eine dieser mustergültigen iranischen Autorenbiographien: in der politischen Opposition und im Gefängnis erst unter dem Schah, dann unter Chomeini, Publikationsverbot, Exil in den Vereinigten Staaten. Ihr erstes und einziges Buch auf Deutsch, "Tuba", ist vor siebzehn Jahren erschienen und über den regulären Buchhandel gar nicht mehr zu beziehen. Tuba ist zugleich der Name der Heldin und des Paradiesbaums aus der islamischen Mythologie. Der Roman erzählt die Lebensgeschichten Tubas und zahlreicher Nebenfiguren von der ersten Jahrhunderthälfte bis zur iranischen Revolution. Die Konfrontation von Mythos und Aufklärung, von altem Denken und neuer Zeit ist der nie versiegende Treibstoff, der diesen wunderbaren Roman durch Kopf und Herz des Lesers rasen lässt.
Eigentlich hätte man Parsipurs nun vorliegenden Roman gleich nach "Tuba" publizieren können; "Frauen ohne Männer" erschien auf Farsi bereits 1989. Aber wir mussten auf die Verfilmung durch die berühmte iranische Foto- und Videokünstlerin Shirin Neshat warten, bis sich die westlichen Verlage dafür interessierten. "Frauen ohne Männer" erhielt 2009 bei den Filmfestspielen in Venedig einen Silbernen Löwen für die beste Regie. Man mag über die mit dem Stoff sehr frei umgehende Verfilmung denken, was man will: Das Buch ist besser!
Fünfzehn kurze Kapitel über fünf Frauenschicksale aus der Zeit der fünfziger Jahre, mehr ist es nicht. Keine erzählerischen Schwelgereien wie in "Tuba", kein großes Zeitpanorama, wenig Welthaltigkeit, keine Politik (anders als im Film), gar keine Wehleidigkeit (ganz anders als im Film). Und doch, was für ein Traum von einem Buch, ein Märchen, eine Utopie, echte persische "Metamorphosen", tiefsinnig und leichtfüßig, verspielt und verrückt.
Da bekommt die Lehrerin Madokht von ihrem Kollegen, der eine Frau sucht, eine Einladung ins Kino. Madokht, stolz und altmodisch, lehnt empört ab und gibt ihre Stelle auf. Als alternde Jungfer vegetiert sie im Garten ihres Bruders in der Teheraner Sommerfrische Karadsch dahin. Die Obsession mit der Jungfräulichkeit, von Männern und Frauen gleichermaßen geteilt, ist das große Leitmotiv der Erzählungen: "Plötzlich schoss es ihr durch den Kopf: Meine Jungfräulichkeit ist wie ein Baum. Vielleicht bin ich ja deshalb so grün. Ich bin ein Samenkorn, ich bin ein Baum, ich muss mich selbst einpflanzen." So geschieht es, und die Verwandelte träumt davon, wie bald "die ganze Erde voller Madokht-Bäume" steht.
Ähnliche, mehr oder weniger drastische Metamorphosen machen auch die anderen Frauen bei ihren manischen Versuchen durch, ihre Ehre zu bewahren, selbst die Hure Zarrinkolah. Eines Tages sieht sie alle Männer ohne Kopf. Um nicht verrückt zu werden, wäscht sie sich, "bis ihr Körper lichterloh brennt", und zieht dann ebenfalls nach Karadsch, wo sie, vom Gärtner geschwängert, allmählich "kristallfarben, transparent" wird: "Man konnte langsam durch sie hindurchsehen."
Die seltsamen Gesetze dieser Welt gelten auch für die sozialen Beziehungen. Ein gestandener Mann tötet seine erwachsene Schwester, weil sie für ein paar Tage spurlos verschwindet. Und die Freundin der Schwester - sie hat ein Auge auf den Bruder geworfen - hilft ihm, sie zu verscharren. Wundert es da, dass die Tote sich zwei Tage später wieder ausgraben lässt und fortan Gedanken lesen kann? Was zu recht komischen Verwicklungen führt, wie überhaupt alles mit einem feinen, hintergründigen Witz erzählt wird und die Gefahr des Pathos, üblicherweise der auf jeder Seite lauernde Killer der persischen Literatur, von Anfang an in Schach gehalten wird. Da lesen wir zum Beispiel eine großartige Parodie auf die iranische Lyriktrunkenheit. In dem Gedicht, das Farrokhlagha nach Monaten der Klausur endlich zustande bringt, stimmen zwar Versmaß und Reim, aber der Gehalt ist ein weißhaariger Revolver, den André Breton sich nicht schöner hätte ausdenken können.
Mit einem tüchtigen Stoß in die Magengrube hat Farrokhlagha zuvor ihren Mann getötet. Trotzdem - oder eben deshalb - taugt "Frauen ohne Männer" nicht zum feministischen Manifest. Diese gutbürgerlichen Sittenwächterinnen sind Biester, die die Werte, von denen sie sich unterdrücken lassen, am liebsten selbst gegen ihre Leidensgenossinnen vertreten. Der Garten in Karadsch, den Farrokhlagha schließlich mietet und in dem sie die anderen aufnimmt, ist auch kein Paradies, sondern soll ihr (wie die Lyrik und der Madokht-Baum!) dabei helfen, eine politische Karriere einzuschlagen. Diese macht dann ihr neuer Mann, und der Bericht über die beiden endet mit dem lapidaren Satz: "Ihre Beziehung ist gut, weder kalt noch warm." Schließlich kehren alle nach Teheran zurück. Nur der Madokht-Baum geht in Gestalt seines Samens "mit dem Wasser auf Reisen. Die Welt lud sie ein. Sie reiste rund um die Erde."
Alle Schlagwörter, die einem jetzt einfallen, versagen vor diesem Buch. Das ist nicht kafkaesk, es ist auch nicht surreal, es ist kein magischer Realismus, kein Märchen, keine Gesellschaftskritik, es ist alles zusammen in einer originären chemischen Verbindung, unerhört. Man begreift sofort, was die mythomane Shirin Neshat an diesem Stoff gereizt hat. Mit dem Video "Tooba", 2002 auf der Documenta 11 gezeigt, inszenierte sie bereits die Verschmelzung von Frau und Baum, wie sie von Parsipur vorausgedacht, vorausgedichtet wurde. Aber während die Leser von "Frauen ohne Männer" schon nach wenigen Seiten Flügel bekommen, zieht der Film dem Zuschauer Schuhe aus Blei an.
Bleibt zu vermerken, dass die Welt, aus der Shahrnush Parsipur diesen Stoff geschöpft hat, nicht mehr existiert. Die gutbürgerliche Mittelschicht, der diese Frauen ohne Männer, abgesehen von Zarrinkolah, allesamt angehören, ist trotz Mullah-Regime längst verwestlicht oder kann sich den Doktor leisten, der die jungfräuliche Ehre vor der Ehe chirurgisch wiederherstellt. Wir weinen der alten Zeit keine Träne nach. Aber wenn sie uns solche Literatur schenkt, kann sie so schlecht nicht gewesen sein!
STEFAN WEIDNER.
Shahrnush Parsipur: "Frauen ohne Männer". Roman.
Aus dem Farsi von Jutta Himmelreich. Suhrkamp Verlag, Berlin 2012. 137 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Das ist nicht kafkaesk, ... nicht surreal, es ist kein magischer Realismus, kein Märchen, keine Gesellschaftskritik, es ist alles zusammen in einer originären Verbindung, unerhört.« Stefan Weidner Frankfurter Allgemeine Zeitung 20121027