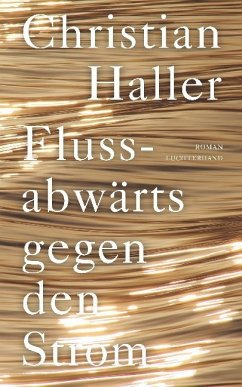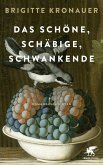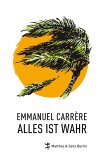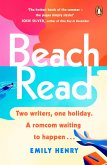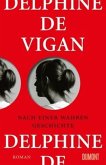Der Damm ist gebrochen, der Fluss des Lebens trägt Christian Haller näher an seine Bestimmung heran. Aus dem jungen Mann, der den Weg suchte, "den es nicht gab und den er dennoch gehen wollte", ist ein Schriftsteller geworden. Durch Widerstände, Schicksals- und Rückschläge eröffnen sich ihm zunächst neue Lebens- und Arbeitsbereiche. Er aber muss kämpfen gegen finanzielle Nöte, gegen Ablehnung und für die Anerkennung seiner Arbeit. Doch schreibend gelangt er an sein Ziel: In der Erkundung seiner Herkunft, jener Einschläge des 20. Jahrhunderts, die die Wege seiner Familie bestimmten, tritt allmählich das erzählende Ich hervor. Und mit ihm die Frage, wie der Untergrund des Lebens tatsächlich beschaffen ist.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Hier schreibt ein Schriftsteller über einen Schriftsteller. Rezensent Kurt Drawert, der in diesem Jahr selbst ein autobiografisches Buch über Dresden vorgelegt hat, schreibt über den Selberlebensbeschreiber Christian Haller, der mit "Flussabwärts gegen den Strom" den dritten Band einer autobiografischen Trilogie vorlegt. Drawert schildert ihn als einen erhabenen Außenseiter der deutschen Literatur, einen der zwanzig Jahre lang daran gearbeitet hat, zu einer Prosa der Kunstlosigkeit zu finden, und der auf dem Weg zum anerkannten - und eben auch verlegten Schriftsteller - eine Menge Demütigungen durchstehen musste, die er ebenfalls in uneitler Prosa schildere. Es handelt sich sehr wohl um Romane, betont Drawert, obwohl die Überblendung von literarischer und realer Person in der Trilogie natürlich bezweckt und Gegenstand ist. Drawert bewundert, wie reale Ereignisse - ein Hochwasserschaden im Haus, der Schlaganfall seiner Frau - hier literarische Wucht bekommen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Christian Haller schließt mit "Flussabwärts gegen den Strom" seine autobiographische Trilogie ab
Zu den größten Wagnissen, die ein Autor in seiner Zeit eingehen kann, gehört das Schreiben von autobiographischer Prosa. Das enorme Risiko der Missverständnisse basiert hier auf zwei grundlegenden Irrtümern in der Rezeption: Erstens, die Person der Erzählung wird mit dem Autor als identisch erlebt, und zweitens, die Welt der Erzählung ist, da sie eine reale topologische Zuweisung von Orten und Namen erhält, der Überprüfung mit jener Realität ausgesetzt, die im literarischen Werk ja gerade nicht abgebildet, sondern im Strom des Erinnerns neu hervorgebracht wurde. Auf dieser Oberfläche der Indifferenz lauert nun der Skandal, der sich aus den sachlichen Abweichungen und subjektiven Einfärbungen des erinnerten Stoffes wie von selbst ergibt - und die Chronisten stehen sofort mit der geladenen Flinte im Busch, wenn ein Regentag im Text nicht mit dem meteorologischen Kalender übereinstimmt.
Dabei entgeht ihnen etwas Entscheidendes, was Literatur von Reportagen oder Sachtexten trennt: die Reproduktion einer starken Empfindung und nicht die kalter Fakten; denn nicht das Protokoll, sondern die Erinnerung ist der Motor des autobiographischen Schreibens. Das gelebte Leben will in seiner inneren Substanz rekonstruiert und verstanden werden - die Geschichte, die es umgibt, ist Folie und Material.
Christian Haller nun hat diese Missverständnisse in allen Facetten erfahren, denn sein großes literarisches Projekt ist der dauernde Versuch, dem eigenen Ich eine Stimme zu geben, die indessen nie so ganz bei sich selbst bleiben kann. Wenn er seine autobiographische Trilogie, die aus den Bänden "Die verborgenen Ufer" (2015), "Das unaufhaltsame Fließen" (2017) und "Flussabwärts gegen den Strom" (2020) besteht, jetzt abgeschlossen hat, dann liest es sich schon fast paradox, dass dieses "Ich bin" erst am Ende des Buches überhaupt gesagt wird - und das noch im Zitat eines Freundes: "Den Boden, den wir nicht gehabt haben, schaffen wir uns selber. Mit Buchstaben und Wörtern, die wir zu Geschichten verfugen, geben wir dem Ich einen Grund, machen das Nichts begehbar und steigen an Orte, wo kein Boden mehr nötig ist."
Kurz zuvor fällt es dem Ich-Erzähler selbst auf, dass er sich dieses "Ich bin" noch immer schuldig geblieben ist, da es nur in Referenz zu anderen erscheint; das Ich bleibt ein Schatten seiner selbst - mehr Ahnung als Gewissheit, mehr "ich möchte" als "ich bin". Und dann der letzte, geradezu ungeheuerliche Satz: "Davon schreib, sagte ich mir und stieg die Treppe hoch in meine ,Flussklause'." Ja, aber was haben wir denn drei Bände hindurch gelesen? Warum sagt der Autor am Schluss, wovon alles handelt? Was ist das für eine unerhörte Tautologie?
Wann stürzte die Hausmauer ein?
Doch zum Anfang zurück. Die große metaphorische Klammer wird abermals eröffnet wie schon in Band eins, wo es hieß: "19. Juni, vier Uhr nachts, ein dumpfes Grollen. Ich schrecke hoch. Die Hausmauern zittern. Ein Erdbeben! Brechende, reißende Mauern, dann ein dunkel plumpsender Ton, gefolgt von einem hellen, spritzenden Rauschen, das in einem Regen fallender Tropfen erlischt. Stille. Sie schafft Gewissheit: Das Hochwasser hat einen Teil unseres Hauses weggerissen." Jetzt heißt es: "Vor drei Jahren, am 13. Juni, stürzte die sieben Meter hohe Mauer, die unsere Terrasse zum Rhein hin begrenzt hat, in den Strom. Ein Grollen und Bersten erschütterte das Fundament des Hauses, riss eine klaffende Wunde aus Erde und Fels unter die beiden Veranden. Nach Befestigung des Untergrundes und der Errichtung eines Balkons blieb die Frage zu klären, ob die Schadenssumme nicht durch die Versicherung wenigstens teilweise bezahlt werden müsste." Wären wir Versicherungsbeamte, die dafür bezahlt werden, dass sie nicht zahlen, hätten wir leichtes Spiel, den Antragsteller abzuweisen, der sich ja nicht einmal im Datum des Ereignisses - 13. Juni hier, 19. Juni dort - sicher sein kann.
Wir haben es also mit einem unzuverlässigen Erzähler zu tun, und genau dieser Fokus der Labilität generiert die Metapher: sich das Haus in Erweiterung eines realen Objektes als Paradigma des Lebens zu denken und den brüchigen Unterbau als dessen permanente Gefährdung. Nichts ist sicher, nichts ist verlässlich; die Dinge der Existenz sind es nicht, das Erzählen darüber ist es ebenso wenig. Wir sind gefangen in einer sokratischen Aporetik, von der alles handelt. Ebenso die Parallelmetapher, die immer wieder im Zwang zur Wiederholung aufgerufen wird: Pippa, die Lebensgefährtin des Erzählers, erleidet einen Schlaganfall mit den Folgen einer dauernden Behinderung. Immer wieder kreist die Erzählung um dieses Ereignis, wie in einer Sinfonie, die ihr Grundmotiv repetiert. "Zwischen zwei und drei Uhr früh erlitt Pippa eine Hirnblutung, lag zur Hälfte aus dem Bett gerutscht am Boden, stöhnte, schlug um sich, und grell durchzuckte mich ein Gedankenblitz: Es ist passiert!"
Überhaupt ist die Prosa von Haller nicht so sehr handlungsorientiert, sondern musikalisch, nach Gesetzen der Rhythmik und Prosodie aufgebaut. So wird, was gelegentlich wie Redundanz erscheint, zu einem Stilmittel dafür, das Unverarbeitete offenzulegen, das, was nicht geschlossen und nicht beendet werden kann.
Die Tradition des Künstlerromans
Aber neben dieser tieferen Schicht des Erzählens, die im Titel des ersten Bandes das schöne Bild vom "verborgenen Ufer" dafür fand, wird ebenso eine chronologisch strukturierte Geschichte erzählt - und es ist die einer Entwicklung zum Schriftsteller. Alle Bände der Trilogie stehen in der großen Tradition des Künstlerromans, und was an Erzählstoff aufgerufen wird, dient dieser besonderen Genese. Dabei dominieren die inneren Zweifel und äußeren Rückschläge immens. Es gibt so anrührende Szenen der Niederlage, dass man die Kraft bewundert, die dieser Mann zum Weitermachen immer neu aufbringen musste.
Eine davon schauen wir uns stellvertretend an. Der Ich-Erzähler hat endlich einen Vertrag bei Luchterhand in Aussicht, "und freuen Sie sich, Ihr Buch wird der Spitzentitel des Herbstes". Dem Autor aber "zog es den Magen zusammen", als hätte er gerade einen Tiefschlag erlitten, und man wundert sich leise - war er nicht endlich am Ziel? Kurz darauf liest er bei den Solothurner Literaturtagen aus dem Manuskript: "Nach zwei, drei Seiten unterbrach mich ein Zwischenruf, ein Zuhörer war im Publikum aufgestanden, rief in den Saal, er protestiere, das sei keine Literatur, die ich da vortrage, das seien Klischees und banale Sätze." Schließlich steht auch noch ein Mitglied der Programmkommission auf und entschuldigt sich, dass er ihn eingeladen habe.
Kann man sich für einen Autor, der zum ersten Mal ein Podium betritt, etwas Furchtbareres vorstellen? Dass er davon erzählen kann, zeigt, wie uneitel er ist und wie es ihm nur um die Sache der Sprache geht. Und so antwortet er auch im Reflex der Angriffe entsprechend, "dass ich zwanzig Jahre gearbeitet habe, um zu einer einfachen Sprache zu finden, dass mir ein Satz wie ,Er ging die Straße hinunter' lieber sei als Zierereien, die vorgeben, Literatur zu sein wie ,er setzte Bein vor Bein, um das Gepflästerte hinter sich zu bringen'". Ein so fundamentales Gefühl der Verirrung geht von dieser Schilderung aus, dass man sich diesen Autor im Netz des Literaturbetriebes alles andere als angekommen vorstellen kann.
Aber es ist keine Soziopathie im Spiel, nichts über die Grenzen der Literatur Hinausfallendes, das sie gleichsam beschädigt; es ist diese sehr eigene poetologische Vorstellung vom geraden, unprätentiösen Satz, die mit einer breiteren Literaturvorstellung offenbar nicht zusammenfällt - oder war, wenn wir die lange Phase der Abweisungen in die erzählte Vergangenheit rücken. Diese kühle, nüchterne Geste des Sprechens, die sich jeder selbstreferentiellen Sprachlust verweigert, finden wir auch im neuesten Text - und nur selten kommt es zu leicht pathetischen Durchbrüchen wie: "Während des Lektorats schmolz ich durch die Anregungen meines Lektors wiederum auf, verflüssigte ihn erneut, um ihn erneut zu härten." Man muss - wie bei allen seinen Büchern - die gesamte Komposition lesen, das feine Arrangement der Szenen und Bilder, deren Poesie in den Schnittstellen entsteht und weniger in den Formulierungen selbst.
Im letzten Teil des Romans "Die Schlüssel zur Kammer" wird eine Leerstelle gefüllt, die sich selbst noch nicht evident war, aber für die Schreibexistenz von größter Wichtigkeit ist: die fehlende Mutter. Plötzlich wird dem Erzähler bewusst, dass sie kaum auftaucht, und erst am Ende des Buches spricht er sie an. Diese Initiation der Mutter, der leiblichen wie der imaginären, und die Suche nach Sprache und Stil fallen im Text auf einen Punkt, der zum Ich des Erzählers wird.
Was tautologisch erscheint, dass ein sprechendes Ich erst in der Sprache zu sich selbst kommen und "Ich bin" sagen kann, wird zu einer tiefen psychologischen Spur. Denn dieses Ich (bei sich selbst) muss erst erarbeitet werden; es ist noch nicht, aber es wird. Oder, besser noch, es wurde - in drei bemerkenswerten Bänden.
KURT DRAWERT
Christian Haller:
"Flussabwärts gegen den Strom". Roman.
Luchterhand Literaturverlag, München 2020. 224 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»'Flussabwärts gegen den Strom' ist das Zeugnis eines beeindruckenden künstlerischen Überlebenswillens und belegt, wie komplex der Zusammenhang von Autobiografie und Fiktion ist.« Rainer Moritz / Neue Zürcher Zeitung