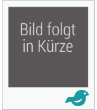Kyle Harper
Buch
Fatum
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:



Produktdetails
- Verlag: Wissenschaftliche Buchgesellschaft
- ISBN-13: 9783534272853
- Artikelnr.: 73446739
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 27.03.2020
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 27.03.2020Der Preis der Verdichtung
Roms Untergang: Kyle Harper bettet die Krisen der Spätantike, den Klimawandel und drei große Pandemien in ein großes Panorama ein.
Allgemeinhistoriker pflegen im Verhältnis zu den Naturwissenschaften meist Distanz. Doch gab es auch bis weit ins zwanzigste Jahrhundert immer wieder Versuche, zumal in der Vogelschau auf die historische Entwicklung der Menschheit, Stufen oder quasinaturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten zu identifizieren, um jenseits der individualisierenden historischen Hermeneutik auch im großen Maßstab zwingende Deutungen zu entwickeln - am besten noch solche mit Prognosekraft. Diese nomologischen Bemühungen führten allerdings letztlich in eine Sackgasse.
Doch auch
Roms Untergang: Kyle Harper bettet die Krisen der Spätantike, den Klimawandel und drei große Pandemien in ein großes Panorama ein.
Allgemeinhistoriker pflegen im Verhältnis zu den Naturwissenschaften meist Distanz. Doch gab es auch bis weit ins zwanzigste Jahrhundert immer wieder Versuche, zumal in der Vogelschau auf die historische Entwicklung der Menschheit, Stufen oder quasinaturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten zu identifizieren, um jenseits der individualisierenden historischen Hermeneutik auch im großen Maßstab zwingende Deutungen zu entwickeln - am besten noch solche mit Prognosekraft. Diese nomologischen Bemühungen führten allerdings letztlich in eine Sackgasse.
Doch auch
Mehr anzeigen
die viel jüngere, von mehreren "turns" gespeiste kulturalistische Bewegung erweist sich allmählich als steril: Historische Katastrophen und Abbrüche sind nicht lediglich sprachliche Kennzeichnungen oder Konstruktionen, und inhuman verfährt, wer existentielle Erfahrungen von vergangenen Akteuren zu bloßen Diskursen banalisiert. "Facts on the ground", so die Praktiken des Wirtschaftens oder Kriegführens, spielen wieder eine größere Rolle. Hinzu kommt: Wir haben heute aus den Archiven der Natur einfach viel mehr Daten als noch vor zwei, drei Jahrzehnten, um auch für ferne Vergangenheiten zu ergründen, wie viele Menschen wann wo gelebt haben, wie sie sich ernährt haben und woran sie in welchem Alter gestorben sind. Dieser empirische Fortschritt mag in manchen Fällen problematische Folgen zeitigen, wenn etwa über DNA-Untersuchungen an großen Mengen menschlicher Überreste auf einmal wieder ein essentialistischer Volksbegriff buchstäblich dem Grab entsteigt. Doch sollen deswegen Erkenntnismöglichkeiten gleich ganz ausgeschlossen werden? Oder nur deshalb, weil die Daten im Detail strittig sind und nicht exakt zu bestimmen ist, welchen Einfluss genau Klimaveränderungen und Seuchen auf den überaus komplexen Großprozess hatten, den wir seit Gibbon den "Untergang des Römischen Reiches" nennen? Man muss beileibe kein Greta-Jünger sein, um die Umwelt als einen veränderlichen, unter den Bedingungen einer vormodernen Knappheitsökonomie zugleich einflussreichen Faktor von Geschichte zu sehen. Und Streit um Fakten und Gewichtungen gehört in jede Wissenschaft.
Der Althistoriker Kyle Harper jedenfalls bettet in seiner vieldiskutierten Rekonstruktion der Krisen und Transformationen, die in der langen Spätantike in Europa und im Vorderen Orient abliefen, den Klimawandel sowie die drei großen Pandemien des zweiten, dritten und sechsten Jahrhunderts in ein breites Panorama ein. Fern von einem gern beargwöhnten szientifischen Determinismus, sieht er das Ende des Imperium Romanum keinesfalls als einen kontinuierlichen, zwangsweise zum Ruin führenden Niedergang, sondern als "eine lange, verschlungene und durch vielerlei Umstände bedingte Geschichte, bei der ein resilienter politischer Verband zunächst standhielt und sich neu organisierte, bis er, zuerst im Westen, dann auch im Osten, zerfiel". Im Rückblick zeige sich ein "extrem durch Zufälle bedingtes Wechselspiel von Natur, Demographie, Wirtschaft und Politik", wobei nicht zuletzt die Glaubenssysteme, die wiederholt erschüttert und neu formiert wurden, eine Rolle spielten. Wenn Harper vorsichtig, mit Hilfe multikausaler Klimamodelle argumentiert oder die Evolution von Seuchenerregern in Nagetierpopulationen nachzeichnet, wird das Buch streckenweise zu einer anspruchsvollen Lektüre, freilich balanciert durch - bisweilen allzu griffige - Metaphern und Merksätze wie "Bakterien sind noch weitaus tödlicher als Barbaren".
In den vier Centennien bis 150 nach Christus hatte das - zunächst mit brutaler Gewalt geschmiedete - Imperium von kluger Politik und sicheren Handelswegen profitiert, doch die Blüte der Landwirtschaft und der Städte wäre ohne besonders günstige klimatische Bedingungen nicht möglich gewesen. Das sogenannte "Roman Climate Optimum" ist in der Forschung als Faktum unstrittig. Zwar herrschten im Mittelmeerraum schon damals zahlreiche, oft auf kleinem Raum sehr unterschiedliche Mikroklimata, doch insgesamt begünstigte mehr Wärme bei höherer Feuchtigkeit die landwirtschaftliche Produktion, und die durch eine steigende Geburtenrate - bei anhaltend hoher Sterblichkeit - verursachte Bevölkerungszunahme setzte die ansonsten für die Vormoderne typischen krisenhaften Kontraktionen aus. Doch mit dem geschenkten Glück bauten die Menschen eine Umwelt, die auch besonders anfällig war: Über die Verbindungswege der protoglobalen Ökonomie sowie in den dichtbevölkerten Städten konnten aus Mittelasien und dem Raum des Indischen Ozeans eingeschleppte Erreger nunmehr Pandemien auslösen, von deren verheerender Wirkung sowohl die literarischen Zeugnisse der Zeitgenossen wie neuerdings untersuchte Massengräber zeugen.
Wie lange die günstigen Klimabedingungen andauerten, ist unter Experten umstritten. Harper nimmt für 150 bis 450 nach Christus eine wechselvolle Übergangsperiode mit kürzeren und regionalen Ausschlägen an. Historisch ist diese Phase die interessanteste, weil die Akteure in ihrem Verlauf die miteinander verflochtenen Rückschläge durch Seuchen, Krieg und wirtschaftlich-demographischen Rückgang noch auffangen konnten und dabei eine hohe Kreativität entfalteten, wie sich am Ende des dritten Jahrhunderts unter den Kaisern Diokletian und Konstantin zeigen sollte. Doch die Ressourcen waren knapper geworden, und die Großregionen des Reiches hielten politisch nicht mehr so fest zusammen, als sich - vielleicht wegen einer massiven Klimaveränderung in der Eurasischen Steppe - die als "Hunnen" bezeichneten Verbände in Bewegung setzten und weiträumige Migrationen auslösten.
Welche Rolle in der Folge Kontingenz und politisches Vermögen spielten, zeigte sich im langen fünften Jahrhundert, als die römische Zentralgewalt im Westen erlosch, während sich das Ostreich um Konstantinopel behaupten und zeitweise sogar Teile des Westens zurückerobern konnte. Danach sind indes fast nur noch Leiden und Beten zu verzeichnen. Nachdem bereits um 450 die "Spätantike Kleine Eiszeit" eingesetzt hatte, machten gewaltige Vulkanausbrüche die Jahre von 536 bis 545 zur kältesten Dekade der letzten zweitausend Jahre, und danach raffte die sogenannte Justinianische Pest etwa die Hälfte der Bevölkerung dahin - um dann noch für etwa zweihundert Jahre endemisch zu bleiben. Doch ebenso ausführlich kommen die großen lokalen und regionalen Unterschiede in Art und Umfang der Katastrophen zur Sprache.
Der Überzeugungskraft von Erklärungen für zeitlich entfernte historische Vorgänge schadet es gewiss nicht, wenn dafür auch diejenigen Instrumente eingesetzt werden, von denen wir angesichts der ökologischen Probleme unserer Tage Aufschluss erwarten. Kyle Harper erzählt Roms Schwanken zwischen Fragilität und Resilienz mit wissenschaftlicher Kühle, zugleich jedoch als implizit heroischen Hymnus auf den schaffenden, ausgesetzten und leidenden Menschen. Hinter das hier vorgeführte Niveau wird die weitere Diskussion nicht mehr zurückfallen dürfen.
UWE WALTER.
Kyle Harper: "Fatum". Das Klima und der Untergang des Römischen Reiches.
Aus dem Englischen von Anna und Wolf Heinrich Leube. C. H. Beck Verlag, München 2020. 567 S., Abb., geb., 32,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Der Althistoriker Kyle Harper jedenfalls bettet in seiner vieldiskutierten Rekonstruktion der Krisen und Transformationen, die in der langen Spätantike in Europa und im Vorderen Orient abliefen, den Klimawandel sowie die drei großen Pandemien des zweiten, dritten und sechsten Jahrhunderts in ein breites Panorama ein. Fern von einem gern beargwöhnten szientifischen Determinismus, sieht er das Ende des Imperium Romanum keinesfalls als einen kontinuierlichen, zwangsweise zum Ruin führenden Niedergang, sondern als "eine lange, verschlungene und durch vielerlei Umstände bedingte Geschichte, bei der ein resilienter politischer Verband zunächst standhielt und sich neu organisierte, bis er, zuerst im Westen, dann auch im Osten, zerfiel". Im Rückblick zeige sich ein "extrem durch Zufälle bedingtes Wechselspiel von Natur, Demographie, Wirtschaft und Politik", wobei nicht zuletzt die Glaubenssysteme, die wiederholt erschüttert und neu formiert wurden, eine Rolle spielten. Wenn Harper vorsichtig, mit Hilfe multikausaler Klimamodelle argumentiert oder die Evolution von Seuchenerregern in Nagetierpopulationen nachzeichnet, wird das Buch streckenweise zu einer anspruchsvollen Lektüre, freilich balanciert durch - bisweilen allzu griffige - Metaphern und Merksätze wie "Bakterien sind noch weitaus tödlicher als Barbaren".
In den vier Centennien bis 150 nach Christus hatte das - zunächst mit brutaler Gewalt geschmiedete - Imperium von kluger Politik und sicheren Handelswegen profitiert, doch die Blüte der Landwirtschaft und der Städte wäre ohne besonders günstige klimatische Bedingungen nicht möglich gewesen. Das sogenannte "Roman Climate Optimum" ist in der Forschung als Faktum unstrittig. Zwar herrschten im Mittelmeerraum schon damals zahlreiche, oft auf kleinem Raum sehr unterschiedliche Mikroklimata, doch insgesamt begünstigte mehr Wärme bei höherer Feuchtigkeit die landwirtschaftliche Produktion, und die durch eine steigende Geburtenrate - bei anhaltend hoher Sterblichkeit - verursachte Bevölkerungszunahme setzte die ansonsten für die Vormoderne typischen krisenhaften Kontraktionen aus. Doch mit dem geschenkten Glück bauten die Menschen eine Umwelt, die auch besonders anfällig war: Über die Verbindungswege der protoglobalen Ökonomie sowie in den dichtbevölkerten Städten konnten aus Mittelasien und dem Raum des Indischen Ozeans eingeschleppte Erreger nunmehr Pandemien auslösen, von deren verheerender Wirkung sowohl die literarischen Zeugnisse der Zeitgenossen wie neuerdings untersuchte Massengräber zeugen.
Wie lange die günstigen Klimabedingungen andauerten, ist unter Experten umstritten. Harper nimmt für 150 bis 450 nach Christus eine wechselvolle Übergangsperiode mit kürzeren und regionalen Ausschlägen an. Historisch ist diese Phase die interessanteste, weil die Akteure in ihrem Verlauf die miteinander verflochtenen Rückschläge durch Seuchen, Krieg und wirtschaftlich-demographischen Rückgang noch auffangen konnten und dabei eine hohe Kreativität entfalteten, wie sich am Ende des dritten Jahrhunderts unter den Kaisern Diokletian und Konstantin zeigen sollte. Doch die Ressourcen waren knapper geworden, und die Großregionen des Reiches hielten politisch nicht mehr so fest zusammen, als sich - vielleicht wegen einer massiven Klimaveränderung in der Eurasischen Steppe - die als "Hunnen" bezeichneten Verbände in Bewegung setzten und weiträumige Migrationen auslösten.
Welche Rolle in der Folge Kontingenz und politisches Vermögen spielten, zeigte sich im langen fünften Jahrhundert, als die römische Zentralgewalt im Westen erlosch, während sich das Ostreich um Konstantinopel behaupten und zeitweise sogar Teile des Westens zurückerobern konnte. Danach sind indes fast nur noch Leiden und Beten zu verzeichnen. Nachdem bereits um 450 die "Spätantike Kleine Eiszeit" eingesetzt hatte, machten gewaltige Vulkanausbrüche die Jahre von 536 bis 545 zur kältesten Dekade der letzten zweitausend Jahre, und danach raffte die sogenannte Justinianische Pest etwa die Hälfte der Bevölkerung dahin - um dann noch für etwa zweihundert Jahre endemisch zu bleiben. Doch ebenso ausführlich kommen die großen lokalen und regionalen Unterschiede in Art und Umfang der Katastrophen zur Sprache.
Der Überzeugungskraft von Erklärungen für zeitlich entfernte historische Vorgänge schadet es gewiss nicht, wenn dafür auch diejenigen Instrumente eingesetzt werden, von denen wir angesichts der ökologischen Probleme unserer Tage Aufschluss erwarten. Kyle Harper erzählt Roms Schwanken zwischen Fragilität und Resilienz mit wissenschaftlicher Kühle, zugleich jedoch als implizit heroischen Hymnus auf den schaffenden, ausgesetzten und leidenden Menschen. Hinter das hier vorgeführte Niveau wird die weitere Diskussion nicht mehr zurückfallen dürfen.
UWE WALTER.
Kyle Harper: "Fatum". Das Klima und der Untergang des Römischen Reiches.
Aus dem Englischen von Anna und Wolf Heinrich Leube. C. H. Beck Verlag, München 2020. 567 S., Abb., geb., 32,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Rezensent Clemens Klünemann fühlt sich als Römer mit dem Buch von Kyle Harper. Harpers Ansatz, den Untergang Roms als selbstverursachte Folge von klimatologischen und infektiologischen Bedingungen zu beschreiben, leuchtet dem Rezensenten ein. Wie sich Seuchen und Epidemien infolge von Expansion, stärkerer Besiedelung und Migration stärker verbreiten konnten, vermittelt ihm der Autor "akribisch" und auf spannende, ja erschreckende Weise. Besonders stark scheint Klünemann der Text, wenn er ihm unsere Nähe zu Rom und zum Schicksal, aber auch zur zivilisatorischen Größe der Römer vor Augen führt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Ist das Römische Reich am Klimawandel zugrunde gegangen? Oder an einer ansteckenden Krankheit? Kyle Harper untersucht die Spätantike."
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Andreas Kilb
"'Fatum' ist das erste Buch, in dem konsequent die katastrophale Rolle untersucht und beschrieben wird, die Klimawandel und Seuchen beim Zusammenbruch des römischen Weltreichs spielten."
Der neue Tag
"Harper unterscheidet an jeder Stelle Fakten von Hypothesen, seine Analyse von Faktoren und Wechselwirkungen bleibt durchsichtig auch da, wo er nur Vermutungen bieten kann. (...)Für den gebildeten Leser stellt Harper nicht nur aufregenden Lesestoff zur Verfügung, sondern vor allem Modelle über den Zusammenhang
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Andreas Kilb
"'Fatum' ist das erste Buch, in dem konsequent die katastrophale Rolle untersucht und beschrieben wird, die Klimawandel und Seuchen beim Zusammenbruch des römischen Weltreichs spielten."
Der neue Tag
"Harper unterscheidet an jeder Stelle Fakten von Hypothesen, seine Analyse von Faktoren und Wechselwirkungen bleibt durchsichtig auch da, wo er nur Vermutungen bieten kann. (...)Für den gebildeten Leser stellt Harper nicht nur aufregenden Lesestoff zur Verfügung, sondern vor allem Modelle über den Zusammenhang
Mehr anzeigen
von Natur und Zivilisation in früher, vorindustrieller Zeit."
Süddeutsche Zeitung, Gustav Seibt
"Ein Buch, so packend wie ein Thriller, nur krasser, denn es beschreibt unmittelbar die Realität."
ZEIT Wissen, Fritz Habekuß
"Ein wunderbares Buch."
Die Presse, Martin Kugler
"Unheimlich viele neue Details (...) wirklich packend."
WDR5, Matthias Hennies
"Ein spannend zu lesendes Breitwandgemälde des Untergangs. "
Nürnberger Zeitung, Reinhard Kalb
"Der US-amerikanische Historiker vertritt die umstrittene These, dass äußeren Einflüssen wie Klimaextremen und Seuchen entscheidende Bedeutung für die spätantiken Umwälzungen zukommt."
ZEIT Geschichte
"Geradezu unheimlich aktuell."
Die Presse, Anne-Catherine Simon
"Meisterhaft komponiertes, brillant erzähltes und eindrücklich illustriertes Werk."
Im Gegenlicht, Karl Adam
"Die Parallelen zu unserer Zeit sind frappant."
Tagesanzeiger, Martin Ebel
"Jetzt ist das inspirierende Buch des Althistorikers Kyle Harper auf dem deutschen Markt erhältlich. Und es sind ihm viele Leser zu wünschen."
Landeszeitung für die Lüneburger Zeitung, Joachim Zießler
"eine neue These (...) merkwürdig, wie aktuell die Geschichte ist."
3sat Kulturzeit, Lotar Schüler
"Zum Verhängnis wurden Rom neben klimatischen Veränderungen auch jene Errungenschaften, die seinen Erfolg ausmachten: Globale Verbindungen und Bevölkerungswachstum schufen die idealen Bedingungen für die ersten Pandemien der Welt. Die Parallelen zu heute sind augenfällig."
Der Standard, David Rennert
"Hinter das hier vorgeführte Niveau wird die weitere Diskussion nicht mehr zurückfallen dürfen."
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Uwe Walter
"Ein faszinierendes Buch."
Kölner Stadtanzeiger, Michael Hesse
"Eine weltweite Seuche leitete den Untergang des Römischen Reichs ein, sagt der Historiker Kyle Harper - und erzählt, was man daraus für die Gegenwart lernen kann."
Die ZEIT, Stefan Schmitt
"Stark an Harpers Buch sind seine globalen klimageschichtlichen Aussagen, die uns im Big-History-Stil in Erinnerung rufen, wie sehr die Menschheitsgeschichte Funktion der Naturgeschichte ist."
Tagesspiegel, Konstantin Sakkas
"Harper entwirft ein faszinierendes Bild, das Schattenseiten römischen Alltags, die bisher allzu häufig ausgeblendet wurden, ins Bewusstsein rückt."
Sehpunkte, Mischa Meier
"Inspirierendes Buch (...) (Harper) entwirft das große Panorama eines Niedergangs."
Landeszeitung für die Lüneburger Heide, Joachim Zießler
"Kyle Harper hat ein wichtiges Buch geschrieben, an dem niemand vorbeikommen wird, der sich mit dem Untergang des Römischen Reiches beschäftigt. Ohne die Aspekte Klima und Seuchen wird zukünftig keine Diskussion mehr geführt werden können."
sehepunkte, Holger Sonnabend
Süddeutsche Zeitung, Gustav Seibt
"Ein Buch, so packend wie ein Thriller, nur krasser, denn es beschreibt unmittelbar die Realität."
ZEIT Wissen, Fritz Habekuß
"Ein wunderbares Buch."
Die Presse, Martin Kugler
"Unheimlich viele neue Details (...) wirklich packend."
WDR5, Matthias Hennies
"Ein spannend zu lesendes Breitwandgemälde des Untergangs. "
Nürnberger Zeitung, Reinhard Kalb
"Der US-amerikanische Historiker vertritt die umstrittene These, dass äußeren Einflüssen wie Klimaextremen und Seuchen entscheidende Bedeutung für die spätantiken Umwälzungen zukommt."
ZEIT Geschichte
"Geradezu unheimlich aktuell."
Die Presse, Anne-Catherine Simon
"Meisterhaft komponiertes, brillant erzähltes und eindrücklich illustriertes Werk."
Im Gegenlicht, Karl Adam
"Die Parallelen zu unserer Zeit sind frappant."
Tagesanzeiger, Martin Ebel
"Jetzt ist das inspirierende Buch des Althistorikers Kyle Harper auf dem deutschen Markt erhältlich. Und es sind ihm viele Leser zu wünschen."
Landeszeitung für die Lüneburger Zeitung, Joachim Zießler
"eine neue These (...) merkwürdig, wie aktuell die Geschichte ist."
3sat Kulturzeit, Lotar Schüler
"Zum Verhängnis wurden Rom neben klimatischen Veränderungen auch jene Errungenschaften, die seinen Erfolg ausmachten: Globale Verbindungen und Bevölkerungswachstum schufen die idealen Bedingungen für die ersten Pandemien der Welt. Die Parallelen zu heute sind augenfällig."
Der Standard, David Rennert
"Hinter das hier vorgeführte Niveau wird die weitere Diskussion nicht mehr zurückfallen dürfen."
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Uwe Walter
"Ein faszinierendes Buch."
Kölner Stadtanzeiger, Michael Hesse
"Eine weltweite Seuche leitete den Untergang des Römischen Reichs ein, sagt der Historiker Kyle Harper - und erzählt, was man daraus für die Gegenwart lernen kann."
Die ZEIT, Stefan Schmitt
"Stark an Harpers Buch sind seine globalen klimageschichtlichen Aussagen, die uns im Big-History-Stil in Erinnerung rufen, wie sehr die Menschheitsgeschichte Funktion der Naturgeschichte ist."
Tagesspiegel, Konstantin Sakkas
"Harper entwirft ein faszinierendes Bild, das Schattenseiten römischen Alltags, die bisher allzu häufig ausgeblendet wurden, ins Bewusstsein rückt."
Sehpunkte, Mischa Meier
"Inspirierendes Buch (...) (Harper) entwirft das große Panorama eines Niedergangs."
Landeszeitung für die Lüneburger Heide, Joachim Zießler
"Kyle Harper hat ein wichtiges Buch geschrieben, an dem niemand vorbeikommen wird, der sich mit dem Untergang des Römischen Reiches beschäftigt. Ohne die Aspekte Klima und Seuchen wird zukünftig keine Diskussion mehr geführt werden können."
sehepunkte, Holger Sonnabend
Schließen
Gebundenes Buch
Gute Idee mit Schwächen in der Ausführung
Seit 4 Jahren bewerte ich hier Bücher und bei diesem Sachbuch muss ich eine neue Kategorie einführen.
Die These des Buches lautet, dass das Römische Reich wegen einer Verschlechterung des Klimas und wegen dreier verschiedener …
Mehr
Gute Idee mit Schwächen in der Ausführung
Seit 4 Jahren bewerte ich hier Bücher und bei diesem Sachbuch muss ich eine neue Kategorie einführen.
Die These des Buches lautet, dass das Römische Reich wegen einer Verschlechterung des Klimas und wegen dreier verschiedener Epidemien unterging, unter anderem die Pest und die Pocken.
So formuliert war mir das neu, ich glaubte der Hauptgrund seien die Einfälle der Germanen.
Meine zweiter Bewertungspunkt ist die Zahl der Wiederholungen. Hier hätte ein guter Lektor mindestens 100 Seiten streichen können. Dreimal lese ich von der Weinpresse des Zorns und es sind so viele Getreideschiffe von Alexandria nach Konstantinopel gefahren, dass der Leser zu Fuß nach Ägypten laufen könnte.
Was mich aber am meisten störte, dass der nordamerikanische Autor offenbar nicht weiß, dass der europäische Leser ein gewisses Vorwissen mitbringt, wenn er ein Buch über die Römer liest.
Er behauptet, dass der Gesundheitszustand der Römer nicht der beste war, weil die Römer klein waren. Ich bestreite nicht, dass es vor allem in der Jugend einen Zusammenhang zwischen Körpergröße und Nahrungsaufnahme gibt, aber noch heute sind die Italiener die kleinsten Europäer und keiner kann mir weiß machen, dass sie weniger essen als, sagen wir, Belgier oder Schweden.
Beim Klimawandel kann ich nachvollziehen, dass häufige Vulkanausbrüche das Klima abkühlen. Ich verstehe auch, dass die Sonnenaktivität nicht immer gleich ist. Die Trockenheit des Mittelmeerraums im Sommer hängt aber mit der atmosphärischen Zirkulation zusammen und warum die Flüsse Italiens zur Römerzeit im Sommer Hochwasser führen sollten, ist mir ein Rätsel. Ich mailte dazu einem Professor aus Freiburg, erhielt aber keine Antwort. Die Erklärung des Autor mit dem verschiedene Zugbahnen der Regengebiete befriedigt mich nicht.
Was mich auch wundert, ist, dass das Christentum sich erst im 3. Jahrhundert von einer Sekte zur größeren Religion durchgesetzt hat. Ich weiß, dass die Apostelgeschichte nicht als historisches Buch zu lesen ist, aber welchen Sinn haben die Christenverfolgungen unter Nero, wenn das Christentum nur eine kleine Sekte war?
Zu meinen Einwänden kommt vom Autor kein Wort. Ich behaupte nicht einmal richtig zu liegen, vermutlich hat er ja recht, aber dann schreib doch was dazu.
Und es geht so weiter. Auf S.286 erlebt Valens 378 bei Adrianopel die schlimmste Niederlage der römischen Geschichte. Kein Wort zu Varus. Auf S. 316 wird von byzantinischer Seite gesprochen, bei der nur eine chemische Analyse zeigen könnte, ob sie erfolgreich war. Aber gab es im Mittelalter Seide in Europa?
Und dann fehlt mir beim Marienkult (396) der Verweis auf die römische Göttin Isis.
Trotz aller Mängel vergebe ich vor allem wegen der neue Idee, die dem Buch unter Greta und Corona Aktualität verschafft, noch 3 Sterne.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Sind das Zufälle, dass in der letzten Zeit neue und gefährliche Viren und Erreger auftauchen, quasi als menschliches Schicksal? Nein, sagt Kyle Harper, Dekan der Universität Oklahoma und Fachmann für die römische Geschichte. Der Untergang des mächtigen römischen …
Mehr
Sind das Zufälle, dass in der letzten Zeit neue und gefährliche Viren und Erreger auftauchen, quasi als menschliches Schicksal? Nein, sagt Kyle Harper, Dekan der Universität Oklahoma und Fachmann für die römische Geschichte. Der Untergang des mächtigen römischen Reiches war lange Zeit nicht erklärbar, nun zeigen aktuelle Forschungen die tatsächlichen Gründe. Die Fortschritte in der Mikrobiologie, neue Methoden der Genomanalyse und immer weiter in Details gehende Forschungen an Pflanzen und Eisbohrkernen beweisen, dass das römische Reich an mehreren Faktoren scheiterte. Es war die Kombination vieler Einflüsse, klimatische Veränderungen, jedoch genau so ökonomische und ökologische. Der Einfall der Antoninischen und später der Justinianischen Pest, und die Klimaveränderungen im Mittelmeerraum, all das war nicht nur naturgegeben, sondern die Menschen dieser Zeit hatten erheblichen Einfluss darauf, was damals geschah. Was jedoch an diesem Szenario erschreckt, sind die Parallelen zu unserer heutigen Zeit. Und die noch immer vorherrschende Meinung, die Menschheit hätte alles im Griff, man brauche nur die richtige Technologie und die Märkte würden schon alles regeln und gut machen.
Kyle Harper ist kein Virologe oder Epidemiologe, sondern Historiker. Sein Spezialgebiet ist das römische Reich, eine der größten und langlebigsten Mächte der Geschichte. Seinem Fachgebiet entsprechend liegt sein Blick auf der geschichtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung. Aber eben nicht nur. Harper spiegelt die Geschichte Roms an anderen Parametern wie Klima und globalen Veränderungen. Den fast zentralen Teil der Geschichte nimmt die Zeit ab 200 n. Chr. ein, besonders die drei großen Pandemien, die das römische Reich am Ende in die Knie zwangen. Die Römer waren die Hochtechnologen dieser Epoche, dementsprechend gewannen in dieser Zeit Themen an Bedeutung, die wir eher der Neuzeit zuordnen würden. Umfangreiche Rodungen für eine sich ausweitende Landwirtschaft, rücksichtslose Ausbeutung der Provinzen, Aufbau von Handelsbeziehungen bis nach China, eine florierende und mächtige Wirtschaft zu Land und zu See, die Römer herrschten von der Grenze zu Schottland bis tief ins Rote Meer hinein. Dementsprechend hielt sich das Römische Reich für allmächtig und unbesiegbar. In zwei Punkten irrten sie leider: Im sich verändernden Klima, und bei neuen Krankheiten wie Pocken und Pest.
Mit Reitervölkern wie den Hunnen und anderen eurasischen Banden hatten die Römer nie Kontakt, ihre Art Kriege zu führen war den Römern völlig unbekannt. Wie auch tödliche Waffen wie die Langbogen der Hunnen. Dass die Hunnen überhaupt im Reich einfielen, hat wiederum Klimagründe. Man könnte die Hunnen als die ersten Klima-Migranten bezeichnen. Als dann noch die Pest aus Asien gerade über das weit verzweigte Handelsnetz Roms erst Ägypten, dann sogar Germanien und Schottland erreichte, war das Ende der römischen Ära besiegelt. In seinem Epilog geht Harper gerade auf das Thema Infektionen noch einmal detaillierter ein. Denn diese Welt wird zunehmend vom Menschen geprägt, aber von den unsichtbaren Feinden regiert. Selbst wenn von den Abermillionen an bekannten Erregern nur rund 1.400 für den Menschen gefährlich sind. Die eigentlich am meisten erschreckende Erkenntnis aus Harpers Buch ist die, dass die relative Hochtechnologie und Militärmacht der Römer ihnen am Ende gar nicht geholfen haben. Sie standen dem veränderten Klima, den Rattenhorden aus Asien mit dem Pesterreger und Hunnen und Goten in ausufernden Kriegen hilflos gegenüber. Der Glaube, man könnte die Natur überlisten oder gar beherrschen, hat sich schon in der Spätantike erübrigt. In diesem Sinne ist das Buch eine deutliche Warnung.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich