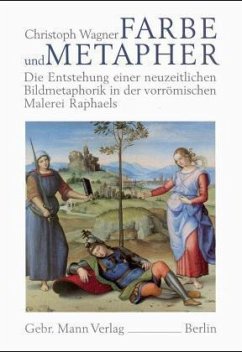Dieser Band liefert einen grundlegenden Beitrag zu einer kaum erforschten Seite der Malerei Raphaels: Das Buch stellt die Frage nach der Bedeutung der Farbe als einem Schlüsselphänomen der visuellen Kultur der Renaissance im Rahmen der Wiederentdeckung des Poetischen am Beginn der Frühen Neuzeit.
Neben exemplarischen Interpretationen enthält die Darstellung eine neue Sichtung der literarischen und kunsttheoretischen Außerungen zu Raphales Farbe aus fünf Jahrhunderten und ein Kapitel zur Stellung der Farbe im Auftraggeberkontrakt und im Werkprozeß.
Neben exemplarischen Interpretationen enthält die Darstellung eine neue Sichtung der literarischen und kunsttheoretischen Außerungen zu Raphales Farbe aus fünf Jahrhunderten und ein Kapitel zur Stellung der Farbe im Auftraggeberkontrakt und im Werkprozeß.

Die Kunst des jungen Raffael zeugt von großem Farbbewusstsein / Von Hubert Locher
Es ist schwierig, über Farbe zu sprechen, schwieriger jedenfalls, als zu erzählen, wer auf einem Gemälde in welcher Aktion dargestellt ist. Das Gründungsparadigma der modernen Kunstgeschichte, die Stilgeschichte, ist von Winckelmann in seiner "Geschichte der Kunst des Altertums" (1764) ganz ohne Blick auf die Farbe definiert worden. Farbe ist für den Antikenverehrer nur eine mehr oder weniger überflüssige Zutat, die von dem ablenkt, worauf es eigentlich ankommt, und darin sind Winckelmann die Ästhetiker und Kunsthistoriker späterer Jahrzehnte mehrheitlich gefolgt. Natürlich ist auch von Belang, dass die Kunstgeschichte auf die Reproduktion angewiesen war, die zunächst im Kupferstich, dann als Fotografie die Werke nur farblos vergegenwärtigen konnte.
Spezifisch für die deutschsprachige "Koloritforschung" ist ihre weniger kulturgeschichtliche als phänomenologisch-hermeneutische Ausrichtung. Lorenz Dittmann hat mit Blick auf Ernst Strauß davon gesprochen, dieser habe an der "Grundlegung einer bildkünstlerischen ,Poetik'" gearbeitet. Koloritforschung in dieser Tradition befasst sich demnach mit Farbe als elementarem künstlerischem Gestaltungsmittel der Malerei im Rahmen des Versuches, zu einer Interpretation des Kunstwerkes aus der "reinen Anschauung" zu gelangen, hauptsächlich gestützt auf die Erfahrung systematischer Zusammenhänge der künstlerischen Gestaltungsmittel.
In diese Tradition darf man auch die neueste Buchpublikation zum Problembereich einordnen, Christoph Wagners umfangreiche Arbeit zur Farbgestaltung des jungen Raffael, die als Saarbrücker Dissertation von Dittmann betreut worden ist. Die Studie geht aber insofern über das in diesen Kreisen bisher Unternommene hinaus, als sich Wagner nicht mit der Analyse des Kolorits aus der Anschauung und der Beschreibung der geschichtlich sich verändernden Verwendung von Farbe durch die Künstler begnügt. Vielmehr wird spezifisch nach dem Zusammenhang zwischen Farbgebung und Bildthema gefragt mit dem Ziel, im Werk des jungen Raffael die "Entstehung einer neuzeitlichen Bildmetaphorik" zu erfassen.
Das Beispiel des jungen Raffael ist aus mehreren Gründen besonders interessant. Seit jeher hat man die zwei Jahrzehnte um 1500 als eine entscheidende Phase in der Entwicklungsgeschichte der italienischen Malerei bestimmt. Es sind die Jahre, in denen Leonardo, Michelangelo und Raffael in Florenz mit einer neuen Auffassung von Figur und Raum auftreten und die Erfolgsmaler des Quattrocento plötzlich alt aussehen lassen. Leonardo, 1452 geboren, hat man mit seiner neuartigen Hell-dunkel-Malerei gewöhnlich eine Leitfunktion zugeschrieben; impliziert war damit, dass die Farbgestaltung in der Malerei um 1500 generell weniger wichtig gewesen sei. Spätestens mit der Restaurierung von Michelangelos Fresken in der Sixtinischen Kapelle, die dessen reiches Kolorit wieder offen legten, wurde die Einseitigkeit dieser Sicht klar. Auch im Falle Raffaels haben die in den letzten Jahrzehnten vorgenommenen Restaurierungen wichtiger früher Werke, etwa 1983 der Münchner "Heiligen Familie Canigiani", sichtbar gemacht, welche zentrale Rolle die Farbe in seinem Werk spielt.
Die prononcierte Farbigkeit des jungen Raffael ist sicher teilweise durch den Verweis auf die Buntfarbigkeit im Werk seines Lehrers Perugino erklärbar. Aber diese Erklärung ist nicht hinreichend, denn die Differenzen sind markant, wie jetzt Wagner zu Recht betont. Zudem ist schon in Raffaels Jugendwerk die Verwendung von Farbe überaus vielfältig. Raffael setzt Farbe als Metapher ein und erarbeitet "durch die Ausbildung einer konsequent auf den thematischen Gehalt bezogenen Farbigkeit eine Bildsprache", in der er "die großen künstlerischen Aufgaben und Themen der abendländischen Malerei" in "paradigmatischer Weise" neu gestalte.
Diese These versucht der Autor, ausgehend von Analysen des anschaulichen Bildganzen unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Ikonographie, zu belegen. Modellhaft vorgeführt wird dies im Einleitungskapitel, das zu den interessantesten Teilen des Buches gehört, am Beispiel eines neuen Interpretationsversuches des kleinen Täfelchens "Traum eines Ritters". Das zweite Kapitel besteht aus einer fast hundert Seiten umfassenden Geschichte der Bewertung von Raffaels Farbe, die auf Grund der Bedeutung des Beispielfalles zu einer eigentlichen Geschichte des Urteils über die Bedeutung der Farbe in der Malerei gerät. Der Hauptteil besteht aber in der Analyse von Raffaels vorrömischem Werk, gegliedert nach den Aufgaben Madonnenbilder, Porträts, Heilige Familien, Altarbilder und schließlich Historien.
Bild- und besonders Farbanalysen in diesem Umfang sind schwere Kost auch für den speziell interessierten Fachgenossen, zumal man mit vielen begrifflichen Neuprägungen konfrontiert ist: Da ist etwa die Rede von "transitorischen Halbschattensäumen", von "Sordinierung der Buntwerte", einem "schmelzklanglich geschlossenen primärtriadischen Farbakkord", der einem "additiven Spaltklang" gegenüberstand, und so weiter. Man mag solche Wendungen als manieriert empfinden, doch insgesamt darf die sprachliche Gestaltungskraft des Autors als beachtlich gelten. Obwohl das Abbildungsmaterial nur teilweise farbig und für Studien dieser Art ja immer ungenügend ist, kann sich der Leser eine Vorstellung von dem machen, was die Beschreibungen erläutern. Auf der Spur des Autors vollzieht man viele interessante Beobachtungen zur Farb- und Lichtregie und zur Kompositionstechnik Raffaels nach, insbesondere wie der Künstler narrative Beziehungen zwischen Figuren mittels Farbe akzentuiert und bedeutsame Bildordnungen festlegt. Auf der Grundlage der Kompositionsanalysen gelangt der Autor auch zu gut begründeten Korrekturen der schwierigen Werkchronologie, etwa bei den Madonnenbildern, und selbst zu überzeugenden Aussagen hinsichtlich umstrittener Zuschreibungen. Doch gerade die metaphorische Dimension der Farbe kann nicht überall so suggestiv erläutert werden wie in den Fällen des sonderbar orangen Miederrockes der "Maddalena Doni" oder der "Heiligen Familie Canigiani".
Der Autor streitet nicht ab, dass der junge Raffael oft im Einklang mit älteren Konventionen arbeitet, die aber kaum erläutert werden. Farbe wurde etwa im sechzehnten Jahrhundert von den Auftraggebern weiterhin auch als kostbare Materie geschätzt. Dies ist in einem Vertrag belegt, den Wagner in einem allzu knappen dritten Kapitel - es hätte die konkreten materiellen und arbeitstechnischen Aspekte klären sollen - kaum ganz richtig interpretiert. In dem Dokument wird von Raffael gefordert, einen Auftrag "in guter Malerei und mit guten Farben" auszuführen. Hier geht es, was die Farbe betrifft, gerade nicht um künstlerische Ansprüche im "neuzeitlichen" Sinn, wie der Autor unterstellt. Verlangt wird schlicht gutes, echtes Pigment, eine kostspielige Sache, die eher auf eine "mittelalterliche" - oder vielmehr zeitlose - Auffassung verweist, in der Kostbarkeit über Kunstfertigkeit gestellt wird. Es weist vieles darauf hin, dass Farbe neben ihrer möglichen symbolischen oder metaphorischen Bedeutsamkeit weiterhin einen ästhetischen Wert an sich darstellen kann.
Man wird dem Autor darin zustimmen, dass das "Nachdenken über das Verhältnis von Farbe und Thema" den hermeneutischen Zirkel für eine Interpretation eröffnen kann, "in dem das Verstehen aus der Anschauung hervorgeht", und es mag zutreffend sein, dass "die Anschauung selbst mit dem fortschreitenden Verstehen geklärt, differenziert und vertieft wird". Solches Vorgehen tendiert allerdings dazu, die eigene "Anschauung" zum Gegenstand der Erkenntnis zu machen und die Fremdheit und Komplexität des historischen Phänomens auszublenden, das sich letztlich wohl nur der rekonstruierenden Vorstellung erschließen kann. Wagner war sich dieses Problems offenbar bewusst, denn für seine hermeneutische Gratwanderung hat er sich in der Korrellierung von Farbe und Thema, durch das Beiziehen theoretischer und literarischer Quellen des sechzehnten Jahrhunderts und in der Rekapitulation der Geschichte der historischen Vorurteile über Raffaels Farbe gegen die Gefahr der unangemessenen "Einfühlung" abzusichern versucht.
Christoph Wagner: "Farbe und Metapher". Die Entstehung einer neuzeitlichen Bildmetaphorik in der vorrömischen Malerei Raffaels. Gebrüder Mann Verlag, Berlin 1999. 425 S., 48 Tafeln mit 161 Farb- und S/W-Abb., geb., 148,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Jene kunstwissenschaftliche Schule, die sich auf die Farbe in der Malerei konzentriert - so erläutert Hubert Locher zu Beginn seiner Kritik - sei immer auf eine Interpretation aus der reinen Anschauung und weniger auf stilgschichtliche Einordnung aus gewesen. Wagner zeige, wie vielfältig Raffael die Farbe einsetze und wie sie bei ihm zur Metapher werde. Mit seiner Methode gelängen ihm auch einige genauere Datierungen von Raffaels Bildern. Locher warnt, dass Farbanalysen für Laien oft schwere Kost seien, lobt aber Wagners sprachliche Gestaltungskraft. Er kritisiert allerdings das allzu knappe dritte Kapitel, das die konkreten materiellen und arbeitstechnischen Aspekte hätte klären sollen. Hier seien Wagner auch Missverständnisse bei der Interpretation seiner Quellen unterlaufen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH