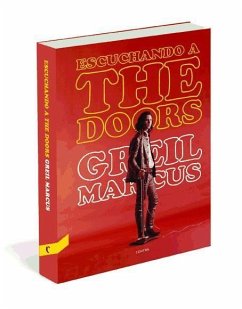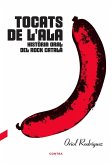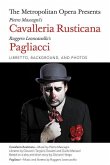Produktdetails
- Verlag: Contra
- Seitenzahl: 216
- Erscheinungstermin: September 2012
- Spanisch
- Abmessung: 210mm x 140mm
- ISBN-13: 9788493985066
- ISBN-10: 8493985066
- Artikelnr.: 36554451

Greil Marcus hört The Doors
Wer sich an Bands und Songs erinnert, der hört, ganz gleich, wie alt er ist, immer auch hinein in den Soundtrack des eigenen Lebens. Und es spielt dabei nicht die zentrale Rolle, ob man dabei war, als ein Song das Licht der Welt erblickte - wichtiger ist, dass man nach ihm die Welt in einem neuen Licht sah. Mit den Doors ist es vielen so gegangen, auch wenn sie die Band nicht, wie Greil Marcus, ein Dutzend Mal live erlebt haben. Marcus, 67, der kluge amerikanische Deuter der Populärkultur, der über Elvis, Punk und Bob Dylan großartige Bücher geschrieben hat, hört sie immer noch, mit Leidenschaft, weshalb sein Buch "The Doors" im Original auch den Untertitel "A Lifetime of Listening to Five Mean Years" hat.
Fast wie Dämonen haben ihn die Doors nicht losgelassen, die 1965 am Strand von Venice zur Band und dann mit "Light My Fire" berühmt wurden, die schnell hintereinander sechs Alben machten, ein paar Skandale erzeugten und deren Sänger Jim Morrison zum männlichen Pin-up wurde, das sich zum Rimbaud der Rockmusik stilisierte, um nach viel Alkohol und anderen Drogen im Juli 1971 in einer Pariser Badewanne zu sterben, mit 27 Jahren. Sein schmales Grab auf dem Père Lachaise wurde sofort zum Wallfahrtsort, dort wurde gesprayt, gemalt und gekifft, bis man es schließlich einzäunte.
Greil Marcus ist nun nicht der Mann, der einem noch einmal mit ehrfürchtigem Schaudern von Exzessen und Skandalen erzählte. Darüber steht nichts in seinem Buch. Er ist immun gegen jede Form der Hagiographie. Das Bild des Sängers "in den Fußstapfen Rimbauds" überblendet er mit dem "Bild des toten Marat in seiner Badewanne". Weniger hilfreich für Leser & Hörer ist dagegen Marcus' Methode, die veröffentlichten und leicht zugänglichen Alben weitgehend zu ignorieren und sich bevorzugt auf entlegene Bootlegs mit Konzertmitschnitten zu stützen.
Aber es geht nun mal um die ganze Musik, die Varianten, die Performances, weshalb auch fast alle Kapitelüberschriften Songtitel der Doors sind; und es geht vor allem darum, was in dieser Musik schwebt, arbeitet, droht. Gegen Morrisons Songtexte und seine Lyrik (die der Verlag 2001 vor Jahren als Buch veröffentlichte, welches wir später Gekommenen damals so begierig aufnahmen wie die Platten selbst) lassen sich leicht geschmackliche Einwände formulieren; aber da ist dann eben immer wieder, im Auftritt, in der Verbindung mit dem Keyboard von Ray Manzarek, dem brutal harten Schlagzeug von John Densmore, der Gitarre von Robby Krieger, diese überwältigende Wucht, da sind diese Reisen in Nacht und Finsternis, die es in jener Zeit nur noch bei den Velvet Underground gab (die Marcus, seltsam genug, nicht mal erwähnt).
"Sprache der Angst" nennt Marcus, was die Doors ausmachte, und er meint damit nicht die Worte, sondern wie diese Worte gesungen werden; nicht die berühmte (und eher schülerhafte) ödipale Provokation in "The End", sondern die so schwer fassbaren Übergänge, die einstürzenden Melodiebögen oder die gespenstischen Läufe von Manzareks Keyboard. Und er meint auch, was Joan Didion in ihrem Porträt der Band so unnachahmlich formuliert hat: "Die Musik der Doors insistierte darauf, dass Liebe Sex war und dass Sex Tod war und dass darin Erlösung lag."
Dass seit Joan Didions Porträt ein paar Jahrzehnte vergangen und mit ihnen die Mythen der Sixties verblasst sind, das setzt bei einem Autor wie Marcus natürlich eine Reflexion darüber in Gang, was es heißt, wenn man noch einmal an diesen Ort zurückkehrt. Er ist kein Nostalgiker, er sieht "die Sixties, die ich hasse", das ist für ihn diese Attitüde ",Freiheit . . . Es gab sie einmal'-Krankheit, die die Vergangenheit verklärte".
Ihn interessiert die "Zäsur", die mitten durch die Musik der Doors läuft, dieses Sensorium für das damals in Amerika allgegenwärtige Gefühl der Angst. Marcus sieht "Chaos, Zerstörung, Vernichtung", welche die Musik der Band enthielt, und er verortet sie mit ein paar Strichen im Kontext der Zeit. Die politischen Attentate des Jahres 1968, der Mord an Sharon Tate im August 1969, sechs Tage danach Woodstock, das Hippiefest des Friedens und der Liebe, im Dezember 1969 die Rolling Stones in Altamont, wo die Hells Angels vor der Bühne einen jungen Mann erstachen. Und die Doors, "die Band, die im Krieg mit ihrem Publikum war". In der Stille, die auf diesen Tumult folgt, hinterlassen die Sixties für Marcus so etwas wie einen Sinn: "das Gefühl, dass es eine andere Welt gibt".
Trotz einiger leicht überdehnter Thesen und mitunter doch zu heftig mäandernder Assoziationen ist in "The Doors" alles, was einem an Greil Marcus' Büchern seit Jahren so imponiert: diese Hingabe ans Sujet, diese fabelhafte Detailkenntnis und diese Fähigkeit, Leser von seiner Begeisterung zu begeistern. Ich habe mir jedenfalls seit Jahren zum ersten Mal wieder die Doors angehört - und es keine Sekunde lang bereut.
PETER KÖRTE
Greil Marcus: "The Doors". Übersetzt von Fritz Schneider. Kiepenheuer & Witsch, 258 Seiten, 9,99 Euro. Erscheint am 16. Mai.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main