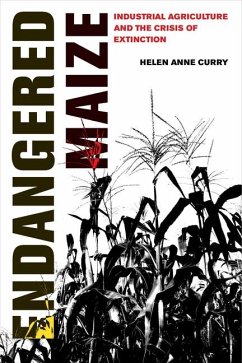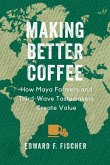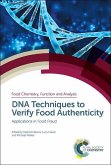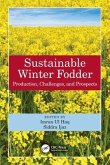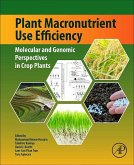"Maize seems to have found its best biographer in Helen Anne Curry. Other grains will be envious. Endangered Maize is a well-nigh comprehensive and nuanced account of the genetic, social, and agronomic career of this cultivar and its fraught future. It avoids all the clichés. Elegantly written, deeply informed, and technically meticulous."--James C. Scott, Sterling Professor of Political Science and Professor of Anthropology, Yale University "In this sweeping history, Helen Anne Curry does the great service of uncovering the money, the philanthro-capitalism, and the imperial assumptions behind doctrines of endangerment. Her solution demands a democratic transformation in the configurations of power that license the conservation business and its contemporary catastrophist narratives. But that's as it should be. As she amply demonstrates, Indigenous and peasant stewardship of maize has long subverted the policing of genetic purity that state and capital have imposed."--Raj Patel, author of Stuffed and Starved: The Hidden Battle for the World Food System "Curry's story of maize is a fresh, provocative, and sharply argued critique of the plant genetic scarcity myth. Her keen assessment of agribusiness machinations is one of the best ever."--Deborah Fitzgerald, author of Every Farm a Factory: The Industrial Ideal in American Agriculture "Curry's book is an engaging, thought-provoking, carefully researched history of maize varietal collections, classification, and breeding projects. By exploring shifts in the narratives about maize varietal diversity over time, and in different contexts, this book raises compelling questions about how we understand and measure biodiversity more broadly."--Elizabeth Fitting, author of The Struggle for Maize: Campesinos, Workers, and Transgenic Corn in the Mexican Countryside

Genetische Erosion? Helen Anne Curry zeigt am Beispiel von Mais, dass die Klage über das Verschwinden von Sorten mit Vorsicht zu genießen ist.
Mais entstand vor zehntausend bis sechtausend Jahren in Mexiko durch die Domestikation der Grasart Teosinte. Heutzutage werden weltweit jährlich mehr als eine Milliarde Tonnen dieser Getreideart geerntet, sie trägt damit zwanzig Prozent zur Kalorienversorgung der Weltbevölkerung bei. In Mexiko ist Mais aber weit mehr als ein Grundnahrungsmittel - es ist das Nahrungsmittel, das "die Götter gewählt haben, um die Menschheit zu ernähren". Mais spielt eine ungemein wichtige Rolle nicht nur im Alltagsleben als Grundlage zahlloser Gerichte, sondern auch in religiösen Ritualen und kulturellen Praktiken. Diese Vielzahl von Nutzungen und Rollen spiegelt sich in einer großen Vielfalt von Maissorten wider: Es gibt Sorten mit weichen oder harten Körnern, mit hohem Zuckergehalt, mit verschiedenen Reifezeiten, mit Körnern in fast allen Farben des Spektrums.
Wenn man allerdings Maisfelder in Europa oder Nordamerika betrachtet, sieht alles sehr einheitlich aus. Unterschiede zwischen den Sorten sind meist nur Fachleuten erkennbar. Seit die Industrialisierung der Landwirtschaft zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts Fahrt aufnahm, gibt es die Sorge, dass ein Rückgang der genetischen Vielfalt auf den immer einheitlicher werdenden Feldern eine langfristige Bedrohung der Ernährungssicherheit bedeuten könnte. "Genetische Erosion" und das Verschwinden alter Sorten oder wilder Arten, die mit kultivierten Arten nahe verwandt sind, werden regelmäßig als Gefahren von Landwirten, Züchtern, Behörden und Umweltschützern beschworen.
Die Wissenschaftshistorikerin Helen Anne Curry zeigt nun am Beispiel von Mais, welche Anstrengungen seit mehr als hundert Jahren in den Vereinigten Staaten, Mittel- und Südamerika unternommen wurden, um die Vielfalt des Maises zu schützen und für Züchter zu erhalten. Mexiko war das Land, in dem die "Grüne Revolution" ihren Anfang nahm: Die Rockefeller Foundation finanzierte dort in den Vierzigerjahren Projekte, die agrarwissenschaftliche Forschung und Züchtung stärken sollten, wodurch Kleinbauern - als politisch unruhig eingeschätzt - dazu gebracht werden sollten, moderne Sorten anzubauen und zuverlässige Teilnehmer am kapitalistischen Markt zu werden.
Was diese Grüne Revolution Kleinbauern in Mittel- und Südamerika tatsächlich brachte, ist immer noch umstritten. Oft übergangen wird aber, dass die Projekte auch das Sammeln und die langfristige Erhaltung genetischer Vielfalt von Kulturpflanzen zum Ziel hatten. Denn den beteiligten Wissenschaftlern war klar, dass veränderte Anbaumethoden der Kleinbauern massive Folgen für die genetische Vielfalt des Maises haben würden. Man erachtete die Lebensweisen indigener Völker als dem Untergang geweiht und ging davon aus, dass damit auch die an spezifische Umwelten, Anbaupraktiken und kulinarische Vorlieben angepassten Maissorten verschwinden würden. Currys Fazit lautet, dass die Züchtung neuer Sorten auf Einheitlichkeit zielte, während die Überzeugung herrschte, dass Vielfalt nur in den Kühlschränken der Genbanken bewahrt werden konnte. Die indigenen Maissorten wurden damit zu "genetischen Ressourcen".
Das Sammeln der Vielfalt des Maises bei den indigenen Völkern Nord-, Mittel- und Südamerikas bedeutete schon eine enorme Anstrengung, aber die langfristige Erhaltung des Saatgutes benötigte zudem eine teure Infrastruktur. Denn auch gekühlt aufbewahrtes Saatgut muss nach einigen Jahren erneuert werden, und dieser Aufwand ist nur dann sinnvoll, wenn die Eigenschaften der Sorten untersucht und katalogisiert werden. Die regelmäßige Erneuerung des Saatgutes und Feldversuche waren wiederum nur in den Ursprungsgebieten durchzuführen - Mais aus Guatemala wächst nun einmal nicht sonderlich gut in Iowa -, was sich in vielen der politisch oft volatilen Länder jedoch nicht verwirklichen ließ. Duplikate von Saatgutproben landeten derweil in den Kühlschränken der nationalen Genbank der Vereinigten Staaten und zum Teil auch in universitären Forschungsinstituten. Doch in Mexiko und anderen Ländern dauerte es Jahrzehnte, bis eine angemessene Infrastruktur aufgebaut werden konnte.
Trotz der Grünen Revolution und zahlloser anderer Versuche, Kleinbauern in Entwicklungsländern auf den Pfad der Modernisierung zu bringen, ist diese Form der Landwirtschaft allerdings nicht verschwunden. Mindestens fünfhundert Millionen Kleinbauern praktizieren immer noch Anbau und Weiterentwicklung lokal angepasster Sorten sowie den Austausch von selbst erzeugtem Saatgut. Die Autorin stellt auch dar, wie diese Landwirtschaftsformen seit den Siebzigerjahren nach und nach anerkannt und in internationalen Vereinbarungen gestützt wurden. Der 2001 verabschiedete "Internationale Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft" wird von ihr allerdings nicht angemessen gewürdigt, da sie unterstellt, es gehe da vorrangig um die Erhaltung von Saatgut in Genbanken. Ein wesentliches Ziel dieses Saatgutvertrages ist aber gerade die nachhaltige Nutzung und Weiterentwicklung dieser Ressourcen durch Kleinbauern. Darüber hinaus kodifiziert diese internationale Vereinbarung zum ersten Mal die Rechte von Landwirten und erkennt damit an, welchen Beitrag sie zur Erhaltung und Entwicklung von angepassten Pflanzensorten leisten. Sie versucht damit genau das zu erreichen, wofür sich die Autorin so eindrücklich einsetzt.
Aber dieser Einwand soll nicht von der zentralen Botschaft des Buches ablenken, dass nämlich die mit schöner Regelmäßigkeit wiederholte Geschichte von verschwundenen und verschwindenden Sorten mit größter Vorsicht zu genießen ist. Es ist eines, diesen Verlust zu behaupten, und es ist sehr viel schwieriger, ihn nachzuweisen. Vergessen wird auch gern, dass beständig neue Vielfalt hinzugefügt wird. Die wirksamste Methode, Vielfalt auf Feldern zu erhalten, ist schließlich die Pflege einer Vielfalt landwirtschaftlicher Lebens- und Produktionsweisen, nicht die Verbannung von Saatgut in Genbanken. THOMAS WEBER
Helen Anne Curry: "Endangered Maize". Industrial Agriculture and the Crisis of Extinction.
University of California Press, Oakland 2022. 336 S., br., 29,70 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main