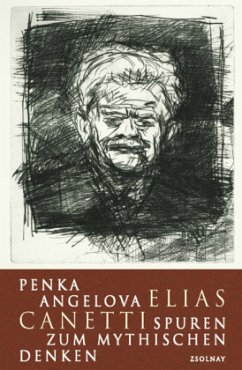Penka Angelovas Buch widmet sich Canettis "Aufzeichnungen" und seinem großen anthropologischen Buch "Masse und Macht". Die Autorin wählt verschiedenste Zugänge, um dem vielfältigen, nicht in ein System zu pressenden Denken Canettis gerecht zu werden. Sie greift weit aus in die verschiedenen Disziplinen und Diskurse von der Literaturwissenschaft bis zur Philosophie, Psychologie und Geschichte und wagt die These, daß Canetti mit einem neuen Menschenbild die kulturale Wende der westlichen Welt vorweggenommen hat.

Elias Canetti, Marie-Louise von Motesiczky und der Schulmeister Witz
Zu den Neuigkeiten im Canetti-Jahr gehört die Wiederentdeckung einer Malerin, die im Familienalbum des 20. Jahrhunderts noch keinen rechten Platz gefunden hat: Im Stafettenlauf der Gedenktage nähert sich der 100. Geburtstag der nur wenigen Eingeweihten bekannten Wienerin Marie-Louise von Motesiczky (1906-1996). Dabei dürfte keinem aufmerksamen Besucher der Österreichischen Galerie im Oberen Belvedere ihr „Selbstporträt mit Kamm” aus dem Jahr 1926 entgangen sein. Das im ungewöhnlich schmalen Hochformat gehaltene Bild wirkt in Komposition und Figurenbehandlung wie mit den zu weiblichen Händen verwandelten Augen eines Max Beckmann gesehen. „Piz”, wie die Jugendfreundin von Beckmanns zweiter Ehefrau Mathilde „Quappi” Kaulbach gerufen wurde, war seine Lieblingsschülerin. Über die Bildniskunst der Malerin schrieb Benno Reifenberg: „Manchmal ist es, als höre man sehend einem Märchen zu.” Auch Canetti lässt grüßen.
In London, am Ort ihres Exils, wird Marie-Louise von Motesiczky im nächsten Jahr eine Retrospektive zuteil werden. Ferner wird aus ihrem Nachlass der Briefwechsel mit Canetti erscheinen. Beider enge Beziehung ist schon jetzt durch die Trouvaille eines von Canetti mit „Aufzeichnungen für Marie-Louise” betitelten Manuskripts dokumentiert. Das im Herbst 1941 entstandene Konvolut ist als Stammbuch seiner in der Folge kontinuierlich verfassten Aphorismen anzusehen. Auf kalligraphisch beschrifteten, am oberen Seitenrand gelochten Blättern, die von einer goldenen Schnur zusammengehalten wurden, hatte er es der Geliebten zum Geschenk gemacht: „Die Liebe hat immer einen Bandwurm, und er wächst mit ihr”, heißt es da. Und in der für Selbstbetrachtungen favorisierten Pronominalform schreibt Canetti drohender noch: „Er tut keiner Fliege was zuleid: sie sind ihm nicht fleischig genug.”
Ach, wäre man sein eigner Vater
Aufgrund ihrer romanhaften Lebensgeschichte ist zu befürchten, dass die „sehr bezaubernde Marie-Louise” - wie Theodor W. Adorno sie nannte, der er ihre Bekanntschaft Walter Benjamin ans Herz legte - demnächst die Nachfolge von Frieda Kahlo antreten wird. Gleichwohl könnte die Beschäftigung mit ihr einer künftigen, wilden Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts zu einem Schlüsselkapitel verhelfen: Es müsste „Die Frau als Medium” heißen und den seit Platon durch die Ideengeschichte vagierenden Mythos eines sich gleichsam selbst zeugenden Intellekts entblättern. Solcher Hybris folgen auch Canettis Notate: „Er wäre gern sein eigener Vater gewesen, und gleich die Mutter dazu.”
Canetti hat den vielzitierten Satz geprägt, wonach der beste „Weg zur Wirklichkeit . . . über Bilder” gehe. Er selbst bevorzugte den Weg über die Bildermacherinnen, die er - wie Anna Mahler, Iris Murdoch und Marie-Louise von Motesiczky - als „Delegierte” bezeichnete, welche „sozusagen statt meiner gearbeitet” hätten. Ihre Genealogie ist dem von Kristian Wachinger besorgten Großband mit Bildern aus Canettis Leben zu entnehmen. Im Londoner Exil war Marie-Louise die Hauswirtin und Mäzenin, die vertraute Freundin und inoffizielle Lebenspartnerin von Canetti, bis dieser die Zürcher Bilderrestauratorin Hera Buschor heiratete. Motesiczky selbst sagte in einem ausführlichen Gespräch, das der Hörbuchausgabe der „Aufzeichnungen” beigegeben ist, Canetti habe sie jahrzehntelang von der Außenwelt abgeschnitten. Just am Eingang der „Aufzeichnungen” steht der beklemmende Satz: „Keiner will die Türe sein.”
Dass es Canetti bei der Vorstellung einer Frau als „Medium” bange ums Herz wurde, zeigt eine Episode in Werner Morlangs schöner Sammlung von Erinnerungen und Gesprächen aus den altersmilden Zürcher Jahren: Eine Bekannte hatte Canetti beim Tod seiner zweiten Frau ein merkwürdiges Kondolenzgeschenk überbracht - die Bücher der einst im Haus von Thomas Mann verkehrenden Telepathin Eva Hermann mit Aufzeichnungen „postumer” Gespräche mit Hildegard von Bingen, Sigmund Freud, Thomas Mann und anderen: „Sie wissen gar nicht”, habe Canetti erwidert, „was Sie mir angetan haben. Sie hätten mich töten können, ich habe gedacht, mein Herz bleibt stehen, als ich in diesen beiden Büchern las.”
Eine Perle unter den im letzten Band der Werkausgabe versammelten Aufsätzen, Reden und Gesprächen ist Canettis Dialog mit jenem verehrten Zürcher Schulmeister, der den emblematischen Namen Friedrich Witz trug und dessen Porträt auch in der Autobiographie gezeichnet ist. Wenig Ohr fand der „Hüter der Verwandlungen” dagegen bei Adorno, mit dem er ein abendfüllendes Rundfunkgespräch führte: Selten haben zwei große Geister so gründlich aneinander vorbeigeredet. Dass sie überhaupt zusammenkamen, war wohl wiederum das Werk „des Piz”, wie Adorno die Wiener Cousine seiner Gemahlin Gretel grammatikalisch korrekt nannte. Zu Hause in London sowie in Briefen beklagte sich Canetti allerdings darüber, dass Marie-Louise die Lektüre der ihr mit handschriftlichen Widmungen zugeeigneten Bücher des Frankfurters dem Studium von „Masse und Macht” vorzöge: „Er ist eifersüchtig auf ihre abgeschnittenen Fingernägel”, ist in den „Aufzeichnungen” zu lesen.
Nationen sind Freudenmädchen
Den Spuren von Canettis mythischem Denken folgt bis in die Tiefen von „Masse und Macht” hinein die ansonsten etwas spröde Abhandlung der bulgarischen Germanistin Penka Angelova. Das Toben des Geschlechterkampfs ist in Canettis Hauptwerk nicht minder mächtig zu spüren als in den „Aufzeichnungen für Marie-Louise”, wo man schon anfangs nicht so recht weiß, ob vom Weltkrieg der Nationen oder vom Krieg der Liebenden die Rede ist: „Sie kämpfen zwischen den Zehen, im Nabel, in den Nüstern, sie kämpfen im Hintern, unter den Achseln, in den Ohren und im Mund, es gibt keinen versteckten Ort, kein Zollbreit, keine Pore tief, wo sie nicht auf Leben und Tod miteinander kämpfen.”
Wahrscheinlich sind beide Kriege gemeint, zumal es gleich darauf heißt: „Die Nationen sind Freudenmädchen und Klageweiber.” Wer oder was sind dann die Männer? VOLKER BREIDECKER
ELIAS CANETTI: Aufzeichnungen für Marie-Louise. Aus dem Nachlass herausgegeben und mit einem Nachwort von Jeremy Adler. Carl Hanser Verlag, München 2005. 119 Seiten, 12,90 Euro.
ELIAS CANETTI: Aufzeichnungen für Marie-Louise. Gelesen von Lena Stolze und Felix von Manteuffel / Gespräch zwischen Gudrun Buch und der Malerin Marie-Louise von Motesiczky. 2 Audio-CDs. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2005. 19,95 Euro.
ELIAS CANETTI: Aufsätze - Reden - Gespräche (= Werke, Bd. 10). Carl Hanser Verlag, München 2005. 397 Seiten, 27,90 Euro.
KRISTIAN WACHINGER (HRSG.): Elias Canetti. Bilder aus seinem Leben. Carl Hanser Verlag, München 2005. 175 Seiten, 24,90 Euro.
WERNER MORLANG (HRSG.): Canetti in Zürich. Erinnerungen und Gespräche. Nagel & Kimche Verlag, Zürich 2005. 239 Seiten, 19,90 Euro.
PENKA ANGELOVA: Elias Canetti. Spuren zum mythischen Denken. Zsolnay Verlag, Wien 2005. 318 Seiten, 25,90 Euro.
Marie-Louise von Motesiczky, Elias Canetti Fotos: Marie-Louise von Motesiczky Charitable Trust, London / „Elias Canetti. Bilder aus seinem Leben”, Hanser Verlag
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH