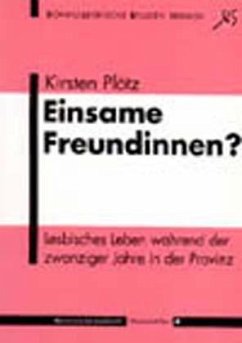Die zwanziger Jahre sind Legende. Eingezwängt zwischen Kaiserreich und Nazizeit gelingt ein tiefes Atemholen und in Aufleben von Freiheit. Das gilt auch für lesbische Frauen. Die wenigen Darstellungen und Untersuchungen ihrer Lebensbedingungen, des Alltags und ihrer Treffpunkte beziehen sich jedoch fast ausschließlich auf Berlin. Der Rest war einfach "Provinz". Kirsten Plötz weitet den Blick und beschreibt erstmals das Selbstbewusstsein lesbischer Frauen und ihr Leben außerhalb von Berlin. Sie analysiert "provinzielles" Leben im Spiegel lesbischer Zeitschriften, vermittelt ein Bild subkultureller Räume und kontrastiert diese Darstellung durch die Geschichte eines Scheiterns: Sie erzählt von einer Lehrerin aus Norddeutschland, die den Anschluss an die Zeit nicht findet, sich versteckt, denunziert und schließlich in ihrer beruflichen Existenz vernichtet wird.

Kirsten Plötz untersucht lesbisches Leben fernab von Berlin
Es gehört Mut dazu, eine Magisterarbeit über ein Thema zu schreiben, zu dem es wenig Forschungsliteratur gibt, zu dem die Quellenlage dürftig ist und deren Protagonistinnen sich im verborgenen hielten. Kirsten Plötz hat trotzdem den Versuch gewagt und sich mit lesbischen Frauen "während der zwanziger Jahre in der Provinz" beschäftigt. Provinz bedeutete für die lesbischen Frauen damals wie für die Autorin heute alles, was nicht zu Berlin gehörte. Während im Berlin der zwanziger Jahre eine homosexuelle Szene existierte, lesbische Frauen sich eine subkulturelle Infrastruktur mit Bars, privaten Treffpunkten, Verbandsstrukturen und Zeitschriften schufen, blieb lesbischen Frauen in anderen Städten - von der Kleinstadt und dem Lande ganz zu schweigen - diese Möglichkeit des "coming out" weitgehend verwehrt. Natürlich gab es hier Abstufungen. Frankfurt und Hamburg hatten deutlich mehr zu bieten als Forst, Weimar oder Liegnitz. Die Autorin beläßt es allerdings bei der Auflistung der Treffpunkte und Kontaktadressen in den jeweiligen Orten und erörtert die regionalen und lokalen Besonderheiten nur in wenigen Sätzen.
Dies liegt vor allem am Quellenmaterial. Denn ausgewertet wurden lediglich Zeitschriften für lesbische Frauen aus den Jahren 1924 bis 1933. Eine Analyse der konkreten Verhältnisse vor Ort war daher nicht zu leisten. Kirsten Plötz muß sich damit zufrieden geben, aus den wenigen Leserbriefen, einigen Kurzgeschichten und Meldungen das lesbische Leben in der Provinz zu rekonstruieren. Das Ergebnis ist wenig überraschend. Die Angst vor Klatschsucht, die Gefahr, aus der Gemeinschaft ausgestoßen zu werden, trieb die Frauen in die Isolation und die Einsamkeit: "Warum dürfen wir nicht wie die anderen uns frei zu unserer Liebe bekennen, wie ein Dieb müssen wir uns unsere Liebe in aller Heimlichkeit stehlen." Die Lektüre der Zeitschriften "Freundin", "Garçonne" oder "Frauenliebe", die es Anfang 1930 auf eine wöchentliche Auflage von rund 10 000 Exemplaren brachte, war den "einsamen Frauen" in der Provinz daher "eine Freude, ein Gruß aus der Welt, die auch die ihre ist".
Die Diskussion um die Ursachen der Homosexualität, die von der Autorin viel zu knapp abgehandelt wird, hatte den Frauen verschiedene Erklärungsmuster ihres "Andersseins" angeboten. Die um 1900 entstandenen Schriften Magnus Hirschfelds über gleichgeschlechtliche Liebe übten Plötz zufolge in den zwanziger Jahren einen großen Einfluß aus. Diese Theorie ermöglichte es den Frauen, sich zu ihrer Homosexualität zu bekennen, da sie als eine "ererbte Veranlagung" interpretiert wurde. Daß die Auseinandersetzung mit sexualwissenschaftlichen Theorien nicht nur befreiend wirken, sondern heillose Verwirrung stiften konnte, zeigt das abschließende Kapitel. Die Geestemünder Studienrätin Anna Philipps hatte sich nach der Lektüre von Hirschfelds Arbeiten eingestanden, homosexuelle Neigungen zu empfinden. Doch in einem Geflecht aus Angst vor gesellschaftlicher Ächtung und wechselseitigen öffentlichen Beschuldigungen unter Philipps Kolleginnen, homosexuell zu sein, zerbrach nicht nur eine enge Frauenfreundschaft; nach einer Radikalwendung leugnete Philipps jedes Lesbischsein und verschanzte sich "hinter der biederen Maske der Normalität".
Mehr als ein erster Schritt in Richtung der Erforschung lesbischen Lebens in der "Provinz" kann das Büchlein von Kirsten Plötz nicht sein. Ob das Wissen über diese Frauen erweitert und vertieft werden kann, hängt von der Entdeckung weiterer, aussagekräftigerer Quellen ab.
JÜRGEN SCHMIDT.
Kirsten Plötz: "Einsame Freundinnen?" Lesbisches Leben während der zwanziger Jahre in der Provinz. Männerschwarm-Skript Verlag, Hamburg 1999. 109 S., br., 26,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main