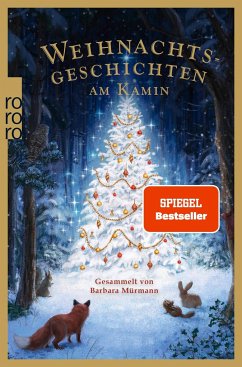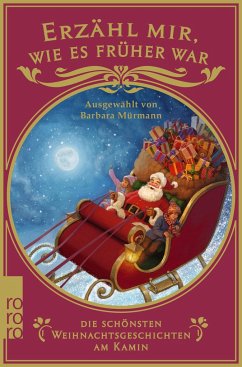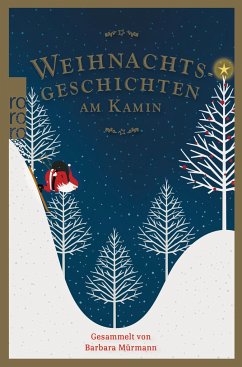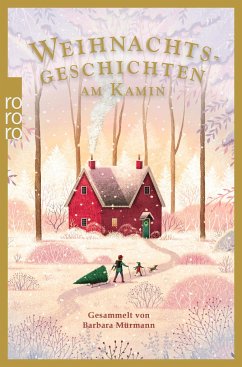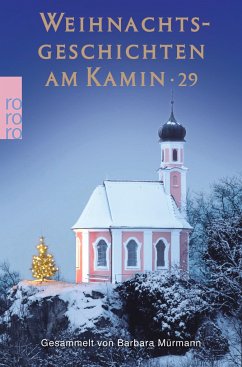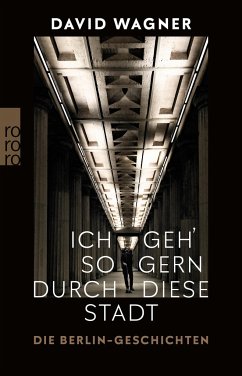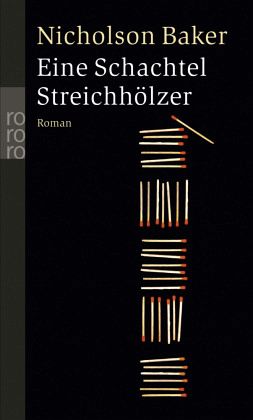
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar





33 Streichhölzer - 33 Skizzen über die kleinen Wunder des Alltags
Aus kleinen Geschichten, Gedankensplittern und Erinnerungsblitzen beim frühmorgendlichen Kaminanzünden entsteht das Bild einer Familie, zu der außer dem wunderlichen Familienvater Emmett Ehefrau Claire (am Geldautomaten kamen sie sich näher), Tochter Phoebe (14, lebensklug), Sohn Henry (8, praktisch veranlagt) und die Ente Greta gehören. Bis das letzte Streichholz abgebrannt ist, gehen dem Leser eine Menge Lichter auf.
"Wirkt wie ein Glücks-Cookie" (Literaturen)
Aus kleinen Geschichten, Gedankensplittern und Erinnerungsblitzen beim frühmorgendlichen Kaminanzünden entsteht das Bild einer Familie, zu der außer dem wunderlichen Familienvater Emmett Ehefrau Claire (am Geldautomaten kamen sie sich näher), Tochter Phoebe (14, lebensklug), Sohn Henry (8, praktisch veranlagt) und die Ente Greta gehören. Bis das letzte Streichholz abgebrannt ist, gehen dem Leser eine Menge Lichter auf.
"Wirkt wie ein Glücks-Cookie" (Literaturen)
Baker, NicholsonNicholson Baker wurde 1957 in Rochester, New York, geboren. Er studierte u.a. an der Eastman School of Music und lebt heute in South Berwick, Maine. Er hat zahlreiche Romane und Sachbücher veröffentlicht. 1997 erhielt er den Madison Freedom of Information Award, 2001 den National Book Critics Circle Award für «Der Eckenknick», 2014, zusammen mit seinem Übersetzer, den Internationalen Hermann-Hesse-Preis. Zuletzt erschienen von ihm «Eine Schachtel Streichhölzer», «Menschenrauch», «Haus der Löcher» und die Essaysammlung «So geht's».
Schönfeld, EikeEike Schönfeld, geboren 1949 in Rheinsberg, promovierte über Oscar Wilde, lebt als freier Übersetzer, Lektor und Autor in Hamburg. Er übersetzte u.a. J. D. Salinger, Jonathan Franzen und Jeffrey Eugenides und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Christoph-Martin-Wieland-Preis 2013 und dem Hermann-Hesse-Preis 2014.
Schönfeld, EikeEike Schönfeld, geboren 1949 in Rheinsberg, promovierte über Oscar Wilde, lebt als freier Übersetzer, Lektor und Autor in Hamburg. Er übersetzte u.a. J. D. Salinger, Jonathan Franzen und Jeffrey Eugenides und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Christoph-Martin-Wieland-Preis 2013 und dem Hermann-Hesse-Preis 2014.
Produktdetails
- rororo Taschenbücher 23975
- Verlag: Rowohlt TB.
- Originaltitel: A Box of Matches
- Artikelnr. des Verlages: 15394
- Seitenzahl: 160
- Deutsch
- Abmessung: 190.00mm
- Gewicht: 151g
- ISBN-13: 9783499239755
- ISBN-10: 3499239752
- Artikelnr.: 13208772
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.03.2004
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.03.2004Wenn ihr nicht werdet wie die Ameisen
Am Kamin: Nicholson Baker läßt dem Leser ein Licht aufgehen / Von Hannes Hintermeier
Morgens um vier liegt die Welt noch im Dunkeln. Das ist die Zeit, in der Emmett aufsteht, ein Streichholz anreißt und den Kamin im Wohnzimmer anzündet. Er spielt nach den Regeln des alten Kinderspiels: Mit geschlossenen Augen durch das Haus gehen, ohne sich an den Möbeln zu stoßen, einen Lichtschalter ertasten, ihn aber nicht einschalten. Und er treibt das Spiel noch weiter, macht sich im Dunkeln einen Kaffee, nimmt im Sessel Platz. Räume, die nur vom schwachen Licht der Sterne und des Mondes beleuchtet sind; eine Blindheit mit dem Ausweg, einfach die Augen wieder öffnen zu können. Warum er
Am Kamin: Nicholson Baker läßt dem Leser ein Licht aufgehen / Von Hannes Hintermeier
Morgens um vier liegt die Welt noch im Dunkeln. Das ist die Zeit, in der Emmett aufsteht, ein Streichholz anreißt und den Kamin im Wohnzimmer anzündet. Er spielt nach den Regeln des alten Kinderspiels: Mit geschlossenen Augen durch das Haus gehen, ohne sich an den Möbeln zu stoßen, einen Lichtschalter ertasten, ihn aber nicht einschalten. Und er treibt das Spiel noch weiter, macht sich im Dunkeln einen Kaffee, nimmt im Sessel Platz. Räume, die nur vom schwachen Licht der Sterne und des Mondes beleuchtet sind; eine Blindheit mit dem Ausweg, einfach die Augen wieder öffnen zu können. Warum er
Mehr anzeigen
das tut, wissen wir nicht, wir werden es auch nicht erfahren. Es spielt vielleicht auch keine Rolle. Wir erfahren aber eine Menge andere Dinge, die uns eigentlich nicht zu interessieren hätten, wenn sie nicht aus der Feder des amerikanischen Schriftstellers Nicholson Baker stammten, der uns für hundertfünfzig kurze, aber sehr intensive Seiten Einlaß in das Bewußtsein seines neuen Helden gewährt.
"Eine Schachtel Streichhölzer" ist dieser sonderbare kurze Roman überschrieben, und die dreiunddreißig Hölzchen, die diese Schachtel faßt, geben den Zeitrahmen der Erzählung vor. "Guten Morgen, es ist Januar, und es ist 4.17 Uhr, und ich bleibe nun hier im Dunkeln sitzen." Ein sehr frostiger Winter in einer Stadt namens Oldfield an der Ostküste. Emmett hat aus irgendeinem nicht näher erläuterten Grund beschlossen, sehr früh aufzustehen, und er wird diese Gewohnheit dreiunddreißig Tage lang beibehalten. Er müßte nicht aufstehen, er ist Lektor für medizinische Fachbücher, eine Arbeit, die sich mit dem Tageslicht besser verträgt. Seine Frau Claire schläft, seine beiden Kinder, die vierzehnjährige Phoebe und der achtjährige Henry, auch. Claire wird als wunderbar, warmherzig und klug gelobt; sie war es, die seinerzeit den ersten Schritt gemacht hat.
Die Kinder haben ihre Macken, wie alle Kinder. Die Ehe funktioniert, das Jahreseinkommen von siebzigtausend Dollar ist gesichert, im Auto hört Emmett Brahms. Es gibt eine Katze im Haushalt, eine Ente names Greta im Garten, die in der Hundehütte lebt. Die Idee, Küchenkrepp zu sammeln und so den Geschmacks- und Formatwandel dieses nur scheinbar unwichtigen Utensils zu dokumentieren, hat Emmett wieder fallengelassen. Das Leben des Vierundvierzigjährigen scheint ohne Gefährdung, aber auch ohne Höhepunkte - der gleichmäßige Fluß des Daseins zwischen nicht mehr jung, aber noch lange nicht alt.
Nicholson Baker ist mit mittlerweile fünf Romanen und drei essayistischen Bänden längst zu einem Fixstern am Firmament über den creative-writing-Prärien der amerikanischen Gegenwartsliteratur aufgestiegen. Dazu mag die Aufregung um den als pornographisch etikettierten Telefonsex-Roman "Vox" und um den mit ähnlichen Bewertungen versehenen Roman "Die Fermate" beigetragen haben. Dabei war es seit Bakers 1988 erschienenem Debüt "Rolltreppe oder Die Herkunft der Dinge" klar, daß hier einer schreibt, dessen Stärke weniger im epischen Panorama denn in der Mikroanalyse der Dingwelt des Industriezeitalters liegt - und in der proustischen Meditation über die Vergänglichkeit. Aber während sich Howie in der "Rolltreppe" noch hauptsächlich damit beschäftigte, warum innerhalb von achtundzwanzig Stunden zwei Schnürsenkel gerissen sind, ist fünfzehn Jahre später doch eine melancholischere Grundierung des Heldengemüts zu diagnostizieren. Und auch die Komik, die Bakers frühere Bücher auszeichnete, hat einer sanften Heiterkeit Platz gemacht, die zumindest eines nicht tut - den Protagonisten der Lächerlichkeit preiszugeben.
Auf Seite 108, bei Streichholz Nummer zweiundzwanzig, lüpft Baker für einen Augenblick die Decke. "Mir geht's nicht so gut." - Emmetts kleinlaute Selbstauskunft hat vordergründig mit einer Erkältung zu tun - "Ich hatte tatsächlich Fieber. ,Ich habe 38,4!' rief ich allen zu, die es hören mochten" -, aber der Befund legt andere Schlüsse nah. Obwohl Emmett in seiner freundlichen, weltbejahenden Naivität ein grundguter Charakter zu sein scheint, hat er doch eine Familiengeschichte. Er stammt aus einer positivistisch denkenden Medizinerfamilie. Sein Großvater, allen Sentimentalitäten abhold, war Pathologe, der ein Standardwerk über Obduktionstechniken sowie ein Handbuch der "Pilzerkrankungen des Menschen" verfaßt hatte. Die Zusammenarbeit mit dem Großvater - "Ich wurde einer der wenigen Teenager, die Rhinoenteromophthoromykose buchstabieren konnten" - brachte den Enkel in den Lektorenberuf.
Ohne es selbst wahrhaben zu wollen, ist Emmett von jener Krankheit erfaßt, die Leben heißt und die unweigerlich zum Tode führt. Hinweise auf einen gewissen morbiden Grundzug gibt der Ich-Erzähler genug. Einmal weint er auch beim Betrachten der Sterne. Eine ganze Weile, berichtet Emmett in seinen frühmorgendlichen Herzensergießungen, habe er nur mit Hilfe von Selbstmordphantasien einschlafen können. Er stellte sich vor, wie "ich mir eine Stricknadel ins Ohr hämmerte oder von einer Plattform einen Schwalbensprung ins Leere vollführte, an deren Grund ein Dutzend schwarze, glitschige Stalagmiten standen." Gleichzeitig weigert er sich, die Existenz des Todes anzuerkennen. "Wie viele Jahre sind es noch, bis ich kein Kind mehr habe, das so jung ist, daß ich ihm die Haare wasche? . . . Der Verlust genügt, um darüber die Fassung zu verlieren - und das ist kein Scherz."
Der am wenigsten kalkulierbare Faktor in dieser Versuchsanordnung ist die Erinnerung. Sie, die nie vom Willen gesteuert werden kann, gebiert Bilder, vor denen es kein Entrinnen gibt. So taucht - Emmett hat gerade eine Spinne vor dem Verbrennen gerettet - die Ameise Fides auf. Sie birgt die Leichen ihrer Artgenossen, schafft sie zur Seite und begräbt sie. Die Letzte ihrer Art, Überlebende einer Ameisenfarm, die Phoebe zum dritten Geburtstag geschenkt bekommen hatte. In ihrem gelebten Stoizismus war sie Emmett Trost und Vorbild: "Fides hielt sich durch Arbeit am Leben, daher war sie für mich ein gutes Beispiel."
Nicholson Baker hat seine detailbesessene Beschreibungskunst weiter verdichtet, er balanciert traumsicher auf dem schmalen Grat zwischen dem philosophischen Aphorismus und den banalen Spruchweisheiten eines gläubigen Sitzpinklers. Er erfüllt eine vornehme Aufgabe der Literatur, indem er deren vermeintlichen Zwang zur Handlung ignoriert. Mit gedehntem Zeitmaß schält er in schöner Präzision die Nachtgedanken dieses Nachfahren von Thoreaus Walden heraus (und findet in Eike Schönfeld erneut einen kongenialen Übersetzer). In der Masse der lauten, taghellen Bücher ist diesem wunderlichen Frühaufsteher fortan ein Platz in der Schublade "Helden, die man nicht vergißt" sicher. Freilich, man sollte ihn in kleinen Dosen zu sich nehmen. Langsam. Am besten in den kleinen Stunden, im schwachen Schein eines Kaminfeuers.
Nicholson Baker: "Eine Schachtel Streichhölzer". Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Eike Schönfeld. Rowohlt Verlag, Reinbek, 2004. 151 S., geb., 14,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Eine Schachtel Streichhölzer" ist dieser sonderbare kurze Roman überschrieben, und die dreiunddreißig Hölzchen, die diese Schachtel faßt, geben den Zeitrahmen der Erzählung vor. "Guten Morgen, es ist Januar, und es ist 4.17 Uhr, und ich bleibe nun hier im Dunkeln sitzen." Ein sehr frostiger Winter in einer Stadt namens Oldfield an der Ostküste. Emmett hat aus irgendeinem nicht näher erläuterten Grund beschlossen, sehr früh aufzustehen, und er wird diese Gewohnheit dreiunddreißig Tage lang beibehalten. Er müßte nicht aufstehen, er ist Lektor für medizinische Fachbücher, eine Arbeit, die sich mit dem Tageslicht besser verträgt. Seine Frau Claire schläft, seine beiden Kinder, die vierzehnjährige Phoebe und der achtjährige Henry, auch. Claire wird als wunderbar, warmherzig und klug gelobt; sie war es, die seinerzeit den ersten Schritt gemacht hat.
Die Kinder haben ihre Macken, wie alle Kinder. Die Ehe funktioniert, das Jahreseinkommen von siebzigtausend Dollar ist gesichert, im Auto hört Emmett Brahms. Es gibt eine Katze im Haushalt, eine Ente names Greta im Garten, die in der Hundehütte lebt. Die Idee, Küchenkrepp zu sammeln und so den Geschmacks- und Formatwandel dieses nur scheinbar unwichtigen Utensils zu dokumentieren, hat Emmett wieder fallengelassen. Das Leben des Vierundvierzigjährigen scheint ohne Gefährdung, aber auch ohne Höhepunkte - der gleichmäßige Fluß des Daseins zwischen nicht mehr jung, aber noch lange nicht alt.
Nicholson Baker ist mit mittlerweile fünf Romanen und drei essayistischen Bänden längst zu einem Fixstern am Firmament über den creative-writing-Prärien der amerikanischen Gegenwartsliteratur aufgestiegen. Dazu mag die Aufregung um den als pornographisch etikettierten Telefonsex-Roman "Vox" und um den mit ähnlichen Bewertungen versehenen Roman "Die Fermate" beigetragen haben. Dabei war es seit Bakers 1988 erschienenem Debüt "Rolltreppe oder Die Herkunft der Dinge" klar, daß hier einer schreibt, dessen Stärke weniger im epischen Panorama denn in der Mikroanalyse der Dingwelt des Industriezeitalters liegt - und in der proustischen Meditation über die Vergänglichkeit. Aber während sich Howie in der "Rolltreppe" noch hauptsächlich damit beschäftigte, warum innerhalb von achtundzwanzig Stunden zwei Schnürsenkel gerissen sind, ist fünfzehn Jahre später doch eine melancholischere Grundierung des Heldengemüts zu diagnostizieren. Und auch die Komik, die Bakers frühere Bücher auszeichnete, hat einer sanften Heiterkeit Platz gemacht, die zumindest eines nicht tut - den Protagonisten der Lächerlichkeit preiszugeben.
Auf Seite 108, bei Streichholz Nummer zweiundzwanzig, lüpft Baker für einen Augenblick die Decke. "Mir geht's nicht so gut." - Emmetts kleinlaute Selbstauskunft hat vordergründig mit einer Erkältung zu tun - "Ich hatte tatsächlich Fieber. ,Ich habe 38,4!' rief ich allen zu, die es hören mochten" -, aber der Befund legt andere Schlüsse nah. Obwohl Emmett in seiner freundlichen, weltbejahenden Naivität ein grundguter Charakter zu sein scheint, hat er doch eine Familiengeschichte. Er stammt aus einer positivistisch denkenden Medizinerfamilie. Sein Großvater, allen Sentimentalitäten abhold, war Pathologe, der ein Standardwerk über Obduktionstechniken sowie ein Handbuch der "Pilzerkrankungen des Menschen" verfaßt hatte. Die Zusammenarbeit mit dem Großvater - "Ich wurde einer der wenigen Teenager, die Rhinoenteromophthoromykose buchstabieren konnten" - brachte den Enkel in den Lektorenberuf.
Ohne es selbst wahrhaben zu wollen, ist Emmett von jener Krankheit erfaßt, die Leben heißt und die unweigerlich zum Tode führt. Hinweise auf einen gewissen morbiden Grundzug gibt der Ich-Erzähler genug. Einmal weint er auch beim Betrachten der Sterne. Eine ganze Weile, berichtet Emmett in seinen frühmorgendlichen Herzensergießungen, habe er nur mit Hilfe von Selbstmordphantasien einschlafen können. Er stellte sich vor, wie "ich mir eine Stricknadel ins Ohr hämmerte oder von einer Plattform einen Schwalbensprung ins Leere vollführte, an deren Grund ein Dutzend schwarze, glitschige Stalagmiten standen." Gleichzeitig weigert er sich, die Existenz des Todes anzuerkennen. "Wie viele Jahre sind es noch, bis ich kein Kind mehr habe, das so jung ist, daß ich ihm die Haare wasche? . . . Der Verlust genügt, um darüber die Fassung zu verlieren - und das ist kein Scherz."
Der am wenigsten kalkulierbare Faktor in dieser Versuchsanordnung ist die Erinnerung. Sie, die nie vom Willen gesteuert werden kann, gebiert Bilder, vor denen es kein Entrinnen gibt. So taucht - Emmett hat gerade eine Spinne vor dem Verbrennen gerettet - die Ameise Fides auf. Sie birgt die Leichen ihrer Artgenossen, schafft sie zur Seite und begräbt sie. Die Letzte ihrer Art, Überlebende einer Ameisenfarm, die Phoebe zum dritten Geburtstag geschenkt bekommen hatte. In ihrem gelebten Stoizismus war sie Emmett Trost und Vorbild: "Fides hielt sich durch Arbeit am Leben, daher war sie für mich ein gutes Beispiel."
Nicholson Baker hat seine detailbesessene Beschreibungskunst weiter verdichtet, er balanciert traumsicher auf dem schmalen Grat zwischen dem philosophischen Aphorismus und den banalen Spruchweisheiten eines gläubigen Sitzpinklers. Er erfüllt eine vornehme Aufgabe der Literatur, indem er deren vermeintlichen Zwang zur Handlung ignoriert. Mit gedehntem Zeitmaß schält er in schöner Präzision die Nachtgedanken dieses Nachfahren von Thoreaus Walden heraus (und findet in Eike Schönfeld erneut einen kongenialen Übersetzer). In der Masse der lauten, taghellen Bücher ist diesem wunderlichen Frühaufsteher fortan ein Platz in der Schublade "Helden, die man nicht vergißt" sicher. Freilich, man sollte ihn in kleinen Dosen zu sich nehmen. Langsam. Am besten in den kleinen Stunden, im schwachen Schein eines Kaminfeuers.
Nicholson Baker: "Eine Schachtel Streichhölzer". Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Eike Schönfeld. Rowohlt Verlag, Reinbek, 2004. 151 S., geb., 14,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Eine Schachtel Streichhölzer leuchtet vor Schönheit. Tages-Anzeiger
Sternstunde des Insignifikanten
Wer den Plot für einen wichtigen, unverzichtbaren Bestandteil einer Erzählung hält, dem beweist Nicholson Baker mit seinem Kurzroman «Eine Schachtel Streichhölzer» das Gegenteil. Eine Handlung ist nämlich nicht mal …
Mehr
Sternstunde des Insignifikanten
Wer den Plot für einen wichtigen, unverzichtbaren Bestandteil einer Erzählung hält, dem beweist Nicholson Baker mit seinem Kurzroman «Eine Schachtel Streichhölzer» das Gegenteil. Eine Handlung ist nämlich nicht mal rudimentär vorhanden, die Erzählung des US-amerikanischen Schriftstellers beschränkt sich einzig und allein auf Reflexionen seines Protagonisten, die ohne erkennbaren Zusammenhang aneinandergereiht sind. Und wie nicht anders zu erwarten polarisiert ein solcher Roman die Leserschaft, die Hälfte ist begeistert, die andere Hälfte entsetzt, Zwischentöne fehlen völlig, und auch das Feuilleton ist uneins oder ignoriert das Buch ganz einfach.
«Guten Morgen, es ist … Uhr». Mit diesen Worten begrüßt der Protagonist in jedem der 33 Kapitel seinen Leser, variiert wird nur die Uhrzeit, die jedoch immer «in aller Herrgotts Frühe» liegt. Emmett ist notorischer Frühaufsteher vom Schlaftypus Lerche, der uns eine plausible Antwort schuldig bleibt, warum er denn zu solch unchristlichen Zeiten aus den Federn steigt. Den 33 Kapiteln entsprechen 33 Tage, die mutmaßlich aufeinanderfolgen, - nur dass es Winter ist und kalt, soviel ist immerhin gewiss. Und deshalb ist das Feuermachen im Kamin auch die erste der allmorgendlichen Verrichtungen, die 33 Streichhölzer zum Anzünden sind auf dem Titelblatt zu sehen. Anschließend folgt dann Kaffeekochen und einen Apfel essen, ersatzweise eine Birne, erfahren wir. Dieser Morgenzauber findet in völliger Dunkelheit statt, um die noch schlafende Familie nicht aufzuwecken, und so hat er sich schließlich auch ganz unmännlich zum Sitzpinkler entwickelt, das morgendliche Zielen nach Gehör nämlich hat sich als unzuverlässige Methode erwiesen. Emmett ist ein 44jähriger Lektor medizinischer Lehrbücher, verheiratet, zwei Kinder, mit einem Jahresgehalt von siebzigtausend Dollar, von dem er gut leben kann, die Familie wohnt im eigenen Haus in Oldfield an der Ostküste. Es gibt dort auch eine Katze, eine Ente sowie die Ameise Fides, einzige Überlebende einer ganzen Ameisenfarm, die Tochter Phoebe zum dreijährigen Geburtstag geschenkt bekommen hat. Emmett ist jedenfalls mit sich und dem Leben zufrieden, ein gutmütiger, harmloser Zeitgenosse.
Diese allmorgendlichen Rituale verknüpfen assoziativ sämtliche Kapitel miteinander, wobei die Tagträume des Helden deren Inhalte bilden. All das ist unspektakulär Alltägliches, welches sich hier zu einer profanen Denklawine entwickelt. Nicholson Baker erweist sich als ein genialer Beschreibungskünstler, der sich an oberflächlich banal erscheinenden Dingen und Begebenheiten abarbeitet und den Leser mit dem verstörenden Stoizismus seines Protagonisten verblüfft. Das Banale jedoch erweist sich bei genauem Hinsehen als wunderbar stimmige Expedition in die Tiefe des Existentiellen, ins Innerste der Gefühle, ein narrativ als einfältige Erzählung kaschierter Bewusstseinsstrom des Protagonisten. Er ist ein Feuer hütender Alltagsphilosoph, dessen metaphysische Unbedarftheit fast schon sensationell ist, der als Figur jedenfalls ein Unikat darstellt in der heutigen Literatur. Und Vieles, was da gedacht, phantasiert und spintisiert wird erinnert einen an eigene Gedanken und Gefühle. Als harmloser, gutmütiger Tagträumer bringt Emmett einen ganz neuen, fast schon überirdischen Glanz in die Trivialität des Alltags, in die von uns allen so gern verleugneten Niederungen unseres Ichs.
Dieser Roman, der so selbstbewusst den vermeintlichen Zwang zur Handlung ignoriert, ist ein Triumph der Gelassenheit, immer besonnen, heiter und ironisch dem Profanen auf der Spur. In einem metaphernreichen Parcours durch die Gefilde gedanklicher Niederungen wird dabei, zuweilen fast unbemerkt, die US-amerikanische Gesellschaft gehörig kritisiert. Am Ende dieses Parforceritts ist die Streichholzschachtel jedenfalls leer und der Leser, wenn er denn in sich selbst hineinzuhören vermag, dem signifikant Insignifikanten deutlich näher als zu Beginn dieser heiteren Lektüre.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für