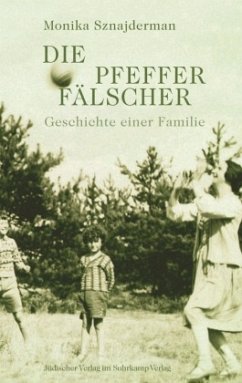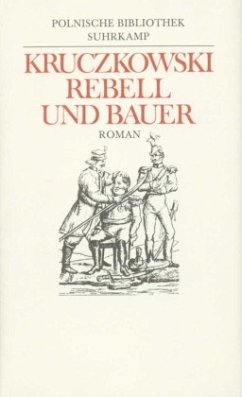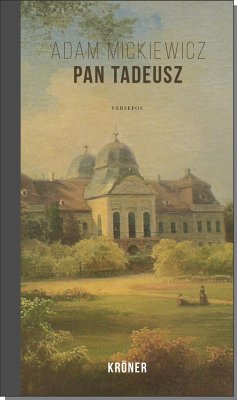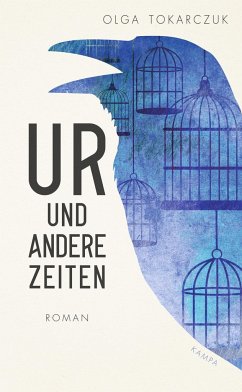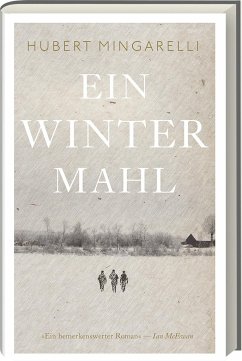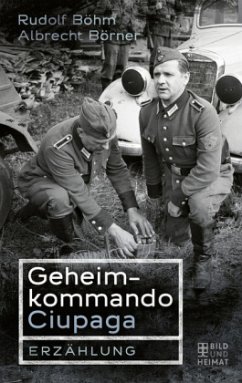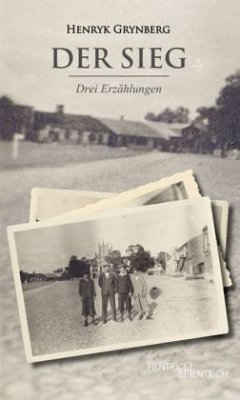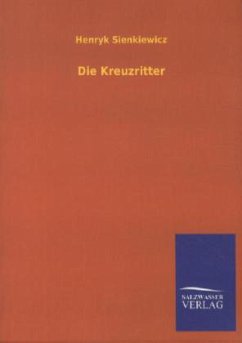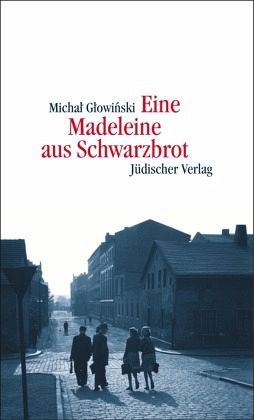
Eine Madeleine aus Schwarzbrot
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
9,95 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Je länger der Trauerzug für Stalin durch die Straßen Warschaus marschiert, desto heiterer wird die Stimmung jener, die daran teilnehmen müssen - die Hoffnung auf Befreiung nach dem Tod des Diktators bricht sich Bahn. Mit oft hintergründiger Ironie führt Michal Glowinskis Zyklus von Erzählungen eindringlich die Atmosphäre im Nachkriegspolen vor Augen - jene Jahre der staatlichen Repression, in denen auch der Antisemitismus im neuen kommunistischen Gewand wiederersteht. Glowinskis Reise durch die Erinnerung führt auch in die Zeit der Shoah zurück, die der bekannte polnische Literaturwi...
Je länger der Trauerzug für Stalin durch die Straßen Warschaus marschiert, desto heiterer wird die Stimmung jener, die daran teilnehmen müssen - die Hoffnung auf Befreiung nach dem Tod des Diktators bricht sich Bahn. Mit oft hintergründiger Ironie führt Michal Glowinskis Zyklus von Erzählungen eindringlich die Atmosphäre im Nachkriegspolen vor Augen - jene Jahre der staatlichen Repression, in denen auch der Antisemitismus im neuen kommunistischen Gewand wiederersteht. Glowinskis Reise durch die Erinnerung führt auch in die Zeit der Shoah zurück, die der bekannte polnische Literaturwissenschaftler als Kind und Jugendlicher im Warschauer Ghetto und dann in verschiedenen Verstecken überlebte. Im Mittelpunkt aber steht die Welt der Volksrepublik Polen nach 1945. Knappe, erhellende Momentaufnahmen machen die menschlichen Tiefendimensionen einer von vielen Traumata gezeichneten Gesellschaft einsichtig, die Glowinski als Schüler und Student erlebte und nun erzählend in Erinnerung ruft - eine Zeit des kollektiv verordneten Verdrängens wird vergegenwärtigt, in der schon das Wahrhaben von zerstörerischen Auswirkungen der »großen Geschichte« auf die Lebensgeschichten einzelner ein Zeugnis des Widerstehens war.