Abends, daß Bosie, sein Begleiter, ausgerechnet neben einem Deutschen sitzen mußte, "der in seltsamen Schwaden die ungewöhnlichsten Gerüche verströmte", als wolle er auf diese urtümliche Weise seinen Beifall für die Vorstellung (man gab die "Sappho" mit Georgette Leblanc) kundtun. "Bosie trug es mit Fassung, doch er saß mir praktisch auf dem Schoß." Das wird Wilde allerdings schon recht gewesen sein. Die Szene spielt im Juni 1898; ein Jahr zuvor erst war er aus dem Zuchthaus, wohin er Bosies wegen gehen mußte, freigekommen.
Ausdruck ernster Leidenschaften wie auch schrecklichster Erniedrigung, herrliche Gehässigkeit und kunstsinnige Betrachtungen, intime Selbstkundgabe sowie virtuoses Rampenspiel - in Oscar Wildes Korrespondenz, nicht anders als in seiner Existenz, treffen solche Gegensätze oft zusammen. Daß die Kunst dem Leben das Modell vorgebe, gehört zu seinen wichtigsten Maximen. Sein einziger Roman, "Das Bildnis des Dorian Gray", ist daher, wie er einmal erklärte, die perfekte Vorlage zur bevorzugten Daseinsform: "nur Konversation und keine Handlung". Und weil Briefe ihm nichts anderes als die Fortsetzung der Konversation mit bleibenden Mitteln waren, ist "Ein Leben in Briefen" unzweifelhaft die kongeniale Art, Oscar Wildes Autobiographie zu verfassen: als Nachvollzug eines Lebenden am Selbstbildnis dieses Künstlers.
Dafür hat Merlin Holland, der Herausgeber und Enkel, aus dem erhaltenen Material, das vor fünf Jahren erstmals vollständig veröffentlicht wurde, mit vierhundert Briefen ein gutes Viertel ausgewählt, durch hilfreiche Erläuterungen in Form von Zwischentexten kommentiert und durch zwei Briefe von Wilde nahestehenden Personen sparsam ergänzt. Für die deutsche Fassung, die dankenswerterweise außerhalb fälliger Klassikergedenkjahre erscheint, findet Henning Thies eine nuancenreiche, nur ganz vereinzelt etwas saloppe Sprache, bei der zwar die literarischen Echos des Englischen, aber keine Pointen auf der Strecke bleiben müssen. Ein eigentlicher Briefwechsel also wird nicht präsentiert, was sich jedoch um so leichter verschmerzen läßt, als die einseitige Dominanz des Austauschs sicher einen lebensnahen Eindruck von Wildes legendärer Konversationskunst gibt. Entstanden ist so jedenfalls ein wahrhafter Briefroman, der den Größten seiner Gattung wie dem "Werther" an Intensität nur wenig nachsteht und an abgründigem Witz naturgemäß weit überlegen ist.
Platon als Bettlektüre
Durchweg lebt er von der Spannung zwischen dem Erlebnis eines Augenblicks, den der Schreibende jeweils fixiert, und der Erkenntnis weiterer Konsequenzen, die wir als Lesende daraus ziehen, weil wir alles mit dem späterhin Erlebten in Beziehung setzen können. Dabei ist allerdings ein Hintersinn der Worte oft vom Verfasser bereits kalkuliert. Im Winter 1893 schrieb Wilde einen artigen Dankesbrief an Lady Mount-Temple, eine entfernte Verwandte seiner Frau, die ihm ihr Landhaus Babbacombe Cliff günstig zur Miete überlassen hatte. Während die Gattin in Florenz weile, arbeite er dort nicht nur an einem neuen Stück, teilt er mit, sondern habe auch "eine Art College" zum Griechischstudium eingerichtet: einem jungen Oxfordianer gewähre er vorübergehend Unterkunft und Unterstützung bei der schwierigen Arbeit an Platon. Dagegen mochte die Lady nichts weiter einzuwenden haben, zumal es sich beim Schüler um den Sproß einer bekannten Adelsfamilie, Lord Alfred Douglas, genannt Bosie, handelt. Einem anderen Adressaten schildert Wilde den Stundenplan von "Babbacombe School" dann etwas detaillierter, inklusive "Versteckspiel mit dem Rektor", Abendessen mit "Champagnerzwang" sowie mitternächtlicher "Bettlektüre (Pflichtfach)". Damit war das Platonische des Tages abgeschlossen.
In dem spektakulären Strafprozeß von 1895 wurde er als "Sodomist", wie die Viktorianer sagten, vorgeführt und hart verurteilt. Sein eigentlicher Fetisch aber, dessentwegen Oscar Wilde bis heute gelesen und geliebt wird, war nicht etwa Bosies honigblondes Haar, das er in verhängnisvollen Briefen rühmte, sondern war die Sprache, und zwar wegen ihres exquisiten Hangs zum Doppelsinn. Was Mittelklassesprecher gemeinhin Schlüpfrigkeit nennen mögen, zeigt ja nichts anderes als das zutiefst erregende Vermögen einfacher Wörter, ein Vielfaches zu bedeuten. Statt durch klare Referenz Ordnung zu stiften, leiten sie Leser wie die ehrenwerte Lady in die Irre, wenn Wortartisten wie Oscar Wilde damit ihre Pirouetten drehen. Solche Lust am verdrehten Aussprechen des Unaussprechlichen treibt alle seine Texte und regte sicher das erotische Rollenspiel mit den Griechenknaben an. Das Verbotene dadurch zu verbergen, daß er es auf die Bühne brachte, war eine bewußt riskante Strategie. Heute folgt ihr unsere Lust an der Lektüre.
Entdeckung der Einzigartigkeit
"Liebster aller Jungen - Dein Brief war köstlich - roter und goldener Wein für mich - aber ich bin traurig und verstimmt." Natürlich hat es bei aller zeitlichen Distanz etwas Voyeuristisches, wenn wir solche Zeilen wie über die Schulter des Empfängers mitlesen. Aber noch das innigste Gefühlsbekenntnis Oscar Wildes lebt von der Theatralik seiner Kundgabe, die das große Publikum sucht. Seine inkriminierenden Liebesbriefe wurden dadurch nur noch trunkener, daß er ihre Entdeckung weniger fürchten als geradezu verlangen mußte. Und tatsächlich gingen sie bald durch die Presse, während ihr Verfasser sich vor Gericht genötigt sah, der Öffentlichkeit seine Sprachbilder als artistische Lyrismen zu erklären. Die bittere Bestrafung, deren Folgen ihn drei Jahre nach Entlassung aus der Haft zugrunde richteten, nahm er auf sich, weil ihm nur das Doppelleben wie der Doppelsinn erlaubten, seine Singularität zu pflegen.
Man sollte daher Merlin Hollands Ansicht, in den Briefen zeige sich der Autor "unverstellt" nicht ohne weiteres Glauben schenken. Gerade weil sich jeder Brief an einen Adressaten richtet und oftmals diesem ein besonderes Anliegen - häufig ein finanzielles - vorträgt, wählt der Autor die jeweils passende Pose sicher mit Bedacht, denn "in einem so vulgären Zeitalter wie dem unseren braucht jeder seine Maske". Von den ersten illustrierten Reiseberichten aus Italien, die der hoffnungsvolle Oscar den Eltern nach Dublin schickte, über die brillanten Briefe, die der Autor gern als seine "Enzyklika" bezeichnete, bis zu den späten Bettelschreiben des Pariser Exilanten, der sich Sebastian Melmoth nannte, können wir diesen Maskenreigen über dreißig Jahre mitverfolgen.
Dabei erleben wir ihn mal als Liebhaber, Rechthaber, Bittsteller oder Bewerber, mal als Kritiker, Programmatiker, Spieler oder Spötter - immer aber auf der Höhe seiner Kunst, den Wendungen der Sprache wie des Lebens etwas Erstaunliches abzugewinnen. Der einzige Unterschied zwischen einem Heiligen und einem Sünder liege darin, daß jeder Heilige eine Vergangenheit, jeder Sünder aber eine Zukunft hat: So lautet eine seiner Einsichten. Wenn wir dieses mitreißende "Leben in Briefen", Oscar Wildes ungeschriebene Autobiographie, lesen, verstehen wir sogleich, warum.
Oscar Wilde: "Ein Leben in Briefen". Herausgegeben und kommentiert von Merlin Holland. Aus dem Englischen übersetzt von Henning Thies. Karl Blessing Verlag, München 2005. 587 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
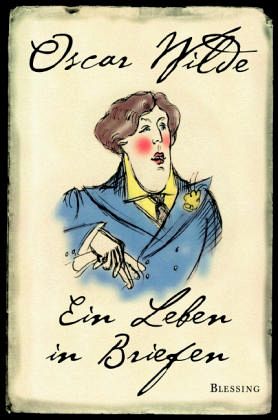






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.11.2005
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.11.2005