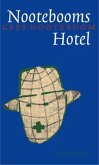Produktdetails
- Verlag: Wunderhorn
- 1999.
- Seitenzahl: 144
- Deutsch
- Abmessung: 220mm x 146mm x 20mm
- Gewicht: 416g
- ISBN-13: 9783884231555
- ISBN-10: 3884231553
- Artikelnr.: 22740746

Ursula März beschreibt die Welt der Ré Soupault
Sie war Fotografin, Modezeichnerin und -journalistin, Übersetzerin – und die Ehefrau von Philippe Soupault: Ré Soupault, als Erna Niemeyer 1901 geboren in Bublitz (Pommern). Sie hatte als Surrealisten-Gattin nie den Nimbus einer Gala Eluard, Simone Breton oder Elsa Triolet, gehörte als Journalistin nicht zum Kreis der „Frauen von der Left-Bank” des Seine-Ufers wie Janet Flanner oder Djuna Barnes. Erst spät, als zwischen 1988 und 1996 in Deutschland drei Bände mit ihren Fotografien aus den zwanziger und dreißiger Jahren publiziert wurden, erlangte sie eigene Berühmtheit, wollten Interviewer mehr wissen über das bewegte Leben und die Persönlichkeit dieser eher zurückhaltenden, unprätentiösen Frau.
Von 1921 bis 1923 war sie am Bauhaus in Weimar Schülerin des exzentrischen und umstrittenen Kunstpädagogen Johannes Itten. Besonders dessen puristische Lehren vom Sehen und Einfühlen in Kontraste, in die Beschaffenheit von Materie und Form, haben sie geprägt. Nach Ittens Weggang vom Bauhaus zog es Erna Niemeyer, die sich bald den Vornamen Renate zulegte, den sie später auf Anregung von Kurt Schwitters in Ré abänderte, nach Berlin. Dort arbeitete sie mehr als ein Jahr lang als Gehilfin des Künstlers Viking Eggeling, für dessen Visionen von kinetischer Malerei aus Licht, Zeit und Bewegung sie praktikable technische Realisierungen ersann. Bei Eggelings Beerdigung 1925 lernte sie den Experimentalkunstfilmer Hans Richter kennen, den sie 1927 heiratete. Mit ihm kommt sie zum ersten Mal nach Frankreich, trifft Man Ray, Fernand Léger – und den französischen Modekönig Poiret; dennfür die Berliner Zeitschrift Sport und Bild, unter einem stellvertretenden Chefredakteur Erich Maria Remarque, schreibt sie Artikel über Mode. Als Korrespondentin verdient sie sich damit, ähnlich wie ihre Freundin Helen Hessel, ihren Lebensunterhalt, als sie 1929 Richter verlässt und nach Paris zieht.
Schon Anfang der dreißiger Jahre hatte sich Ré Richter auch aufs Selber-Entwerfen verlegt, getreu ihrer Bauhaus-Maxime, dass gute Mode sich an den Kriterien „Zweckdienlichkeit, Einfachheit, Funktionalität und Materialqualität” orientieren sollte. Für die moderne, berufstätige Frau kreierte sie ein Verwandlungskleid, das mittels verdeckter Reißverschlüsse und Knöpfe vom streng dezenten Businessdress bis zum elegant dekolletierten Cocktailkleid mutieren konnte. Ein amerikanischer Bankier richtet der einfallsreichen jungen Designerin ein Modeatelier am Montparnasse ein. Drei Jahre existiert der Salon „Ré Sport” und die Prèt-à-porter-Kollektionen finden begeisterte Kritiker.
Oktober 1933 lernt sie auf einer Feier zum Jahrestag der Oktoberrevolution in den Räumen der Sowjetbotschaft Philippe Soupault kennen, bei beiden Liebe auf den ersten Blick. In der Rolle der Künstlergefährtin tippt sie fortan seine Manuskripte, steuert auf seinen Reportagereisen den Wagen, organisiert das „fliegende Büro”, aber ergreift auch instinktsicher die Gelegenheit zur neuerlichen eigenen Professionalisierung: Sie kauft sich eine Kamera und steuert nun oft die Bilder zu Soupaults Texten bei.
Auch als Fotografin bleibt sie einer schlichten Klarheit in der Formensprache treu, interessieren sie mehr Räume und Strukturen als Szenen, die Geschichten abbilden. Der vorliegende Text ist mit vielen Abbildungen gut dokumentiert. Aber bisweilen bedauert man doch, dass das eine oder andere großartige Foto nur noch als „Briefmarke” präsentiert wird, wie etwa bei der berühmten „Frau im ,Verbotenen Viertel‘, Tunis 1939”.
Fast vier Jahre hatte Ré mit Soupault der dort einen antifaschistischen Radiosender aufbauen wollte, in Tunis gelebt. 1942 wird er von Beamten des Vichy-Régimes verhaftet. Nach abenteuerlicher Flucht über Algier erreichen beide 1943 New York. In Amerika wird Ré Soupault nicht heimisch. Sie verlässt das Land 1946, allein, nach schmerzhafter Trennung von Philippe, der eine neue Liebesbeziehung eingegangen war.
Wieder fängt sie neu an, diesmal als bitterarme literarische Übersetzerin und Pariser Verlagsagentin für die Züricher Büchergilde. In einem winzigen Hotelzimmer übersetzt sie die Memoiren von Romain Rolland und seine Kriegstagebücher. 1948 übersiedelt sie nach Basel. Größtes Prestige als Übersetzerin bringt ihr die Übertragung der Gesänge des Maldoror von Lautréamont, ein Buch, das bis dahin in Deutschland als „Phantom der Literaturgeschichte” galt. Von 1959 an lebt sie wieder in Paris und seit 1972 wieder Wand an Wand mit Philippe Soupault. Ganz hatten sie sich all die Jahre nie aus den Augen und den Herzen verloren und verbrachten die letzten zwei Jahrzehnte wieder gemeinsam. Ein Foto vom 90. Geburtstag Philippe Soupaults zeigt ihn sitzend, den Arm seiner Frau wie beschwörend umklammernd, den Kopf ihr zugewandt, aufschauend zu der betont aufrecht stehenden Ré, die unverwandt in die Kamera blickt, diszipliniert, den anderen Arm selbstbewusst in die Hüfte gestemmt.
Sie hatte in schwierigsten Lebenslagen stets ihre Haltung bewahrt, war für sich gestanden, war, trotz des Vagebundierens durch Länder und Kontinente (52 verschiedene Quartiere seit dem Verlassen von Tunis), ohne eigentliches Talent zur Bohèmienne. Wie viele Frauen, nicht nur ihrer Generation, verfolgte sie nicht kompromisslos den Entwurf des eigenen Werks, sondern passte ihre berufliche Existenz den jeweiligen Umständen an. Dabei galten ihr selber später nicht die vom Zusammensein mit Soupault initiierten Fotografien als wesentlicher Teil ihrer beruflichen Identität, sondern die Übersetzertätigkeit der Basler Jahre.
Trotz oft ungelenker Formulierungen, trotz mancher Irrtümer (Maria Osten war nie die Ehefrau von Michail Kolzow, der nicht Chefredakteur sondern Starreporter der Prawda war) erhellt Ursula März’ biografischer Essay die historischen und individuellen Bedingungen einer sehr weiblichen Karriere dieses Jahrhunderts.
BARBARA VON BECKER
URSULA MÄRZ: „Du lebst wie im Hotel”. Die Welt der Ré Soupault. Verlag Das Wunderhorn, Heidelberg 1999. 140 Seiten. 38 Mark.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de