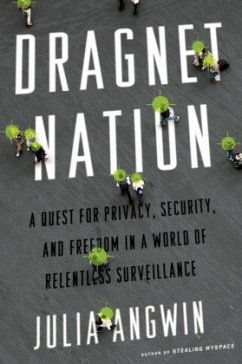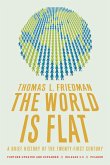Die Journalistin Julia Angwin hat ein Buch darüber geschrieben, wer was über sie weiß und wer sie wie überwacht. Eine Reise in den puren Horror.
NEW YORK, 26. Februar
Alles sehen, alles wissen, nichts erzählen: Nach dieser Devise operiert der detektivisch-industrielle Komplex der Sicherheitsbehörden und Internetkonzerne. In der Snowden-Affäre gaben sich die Kommunikationsdienstleister Mühe, sich als Opfer oder verhinderte Gegenspieler des Staates darzustellen. Aber wie die Journalistin Julia Angwin in ihrem soeben veröffentlichten Buch über ihre Erfahrungen mit der Überwachungswirtschaft darlegt, deutet schon die Chronologie darauf hin, dass Behörden und Unternehmen gemeinsame Interessen im Datenbankgeschäft haben, die ihnen nahelegen, gemeinsame Sache zu machen. Die Terroranschläge vom 11. September 2001 waren der Anlass für Gesetze, die von der National Security Agency als Ermächtigung zur vorsorglichen Totalerfassung des Fernmeldeverkehrs ausgelegt wurden. Gleichzeitig bildete sich nach dem Platzen der Dotcom-Blase ein neues Geschäftsmodell der Internetwirtschaft heraus: Die virtuellen Läden sollten sich nicht mehr durch Werbung finanzieren, sondern durch den Verkauf von Kundendaten.
"Dragnet Nation" ist im Buchverlag der "New York Times" erschienen. Der Titel spielt auf den investigativen Bestseller "Fast Food Nation" von Eric Schlosser aus dem Jahr 2001 an: Die massenhafte Preisgabe privater Informationen erscheint als nationales Laster, ein Ergebnis von Marketingstrategien, die bei der Bequemlichkeit der Konsumenten ansetzen, ihrer Neigung zum Vertrauten und scheinbar Billigen. Im Brennan Center der New York University, einer Forschungsstelle für Bürgerrechte, die nach William Brennan benannt ist, einem liberalen Richter des Obersten Gerichtshofs, stellte die Autorin ihr Buch vor.
Julia Angwin arbeitet seit neuestem für Pro Publica, eine aus Stiftungsgeldern finanzierte Reportergemeinschaft, die durch nachhaltige Recherchen dem Gemeinwohl dienen will. Vorher schrieb sie dreizehn Jahre lang für das "Wall Street Journal"; 2003 gehörte sie zu einem Team, das einen Pulitzer-Preis für Korruptionsermittlungen in der Privatwirtschaft bekam. Als sie jetzt für ihr Buch den Versuch unternahm, alle bei öffentlichen und privaten Stellen über sie gesammelten Daten einzusehen, stieß sie in den Akten der Grenzpolizei, der Customs and Border Patrol, auf interne Informationen über die Dienstreisen, die sie im Auftrag ihrer Zeitung absolviert hatte. Das Reisebüro, das der Dow-Jones-Konzern beschäftigte, hatte ohne Wissen des Auftraggebers die Angaben über die Reiseanlässe aus den Dienstreiseanträgen weitergegeben.
Im Datenaustausch zwischen Behörden und Privatfirmen gibt es einen Drehtüreffekt wie beim Personal jener Spezialisten, die zwischen öffentlichen und privaten Arbeitgebern wechseln und auch in offiziellen Dokumenten als "Geheimdienstgemeinschaft" ("intelligence community") bezeichnet werden. Einige Bundesstaaten verkaufen die Personendaten der Wählerverzeichnisse an Spezialfirmen, die sie aus anderen Quellen anreichern und anderen Regierungsstellen zurückverkaufen. Der nonchalante Umgang gerade mit diesen Daten wirkt besonders obszön vor dem Hintergrund schikanöser Wahlgesetze in republikanisch dominierten Staaten, die es im Namen der Bekämpfung des Wahlbetrugs Wählern aus minderbemittelten Schichten erschweren, den dokumentarischen Beweis ihrer Identität zu führen.
Etwa zweihundert Firmen betreiben den Handel mit sortierten Konsumentendaten im großen Stil. Nur zwölf dieser "Datenmakler" wollten Julia Angwin verraten, was sie über sie wissen. Es fehlt ein Datenschutzrecht mit Anspruch auf Akteneinsicht. Die Reporterin war schockiert darüber, wie viel Wissen über sie angehäuft worden ist, und mehr noch über die Fehlinformationen oder, genauer gesagt, die Fehldeutungen im Gewand von Informationen. Eine Firma führte sie als alleinerziehende arbeitslose Mutter ohne Collegeabschluss - wohl wegen ihrer Adresse in Harlem. Solche Angaben werden an Krankenhäuser verkauft, die wissen wollen, ob ein neuer Patient sich seine Behandlung leisten kann. Als Julia Angwin von den Datensammelfirmen verlangte, die über sie gespeicherten Informationen zu löschen, schickten einige für diese Leistung eine Rechnung. Andere forderten sie auf, in Daten zu bezahlen, mit einer Führerscheinkopie oder ihrer Kreditkartennummer.
Julia Angwin hat ihr Buch als Erfahrungsbericht angelegt, weil sie zeigen möchte, dass das Thema alle angeht, und erproben wollte, was der Einzelne tun kann. Aus der Sicht des Buchhandels fällt "Dragnet Nation" in ein populäres Untergenre der Memoirenliteratur: Erzählt wird von einem "stunt", einer Mutprobe - der Autor hat versucht, ein Jahr lang vegetarisch zu leben oder ohne Internet. Um die Herrschaft über ihre Daten zurückzugewinnen, verzichtet Julia Angwin auf die Nutzung des drahtlosen Internetzugangs in ihrem Arbeitszimmer. Sie durchsucht das Netz nicht mehr mit Google. Seit sie dort 2006 eine E-Mail-Adresse eingerichtet hatte, war ihre gesamte Such-Tätigkeit archiviert worden - 26 000 Suchvorgänge im Monat.
Den automatischen Steckbriefproduzenten will sie das Mosaikhandwerk legen, indem sie für Bestellungen bei verschiedenen Versandhäusern jeweils eigene E-Mail-Konten unterhält. Amazon boykottiert sie nicht, aber heikle Waren wie Bücher zur Geschichte der NSA bestellt sie unter einem Decknamen. Mit den digitalen Fußspuren, die sie als Ida Tarbell hinterlässt, setzt sie einer Pionierin der "muckrakers", der den Schmutz der Korruption umwendenden Journalisten des "progressiven" Zeitalters, ein Denkmal im Stil von Jochen Gerz. Sie besitzt auch eine Kreditkarte im Namen von Ida Tarbell. Die Bücher für die tote Kollegin werden an eine andere Adresse geliefert.
Tarnung ist mühselig. Die Kosten der Anonymität explodieren, sobald sie auch Dritten aufgebürdet werden. Julia Angwin verschlüsselt ihre E-Mails und muss von ihren Freunden erwarten, dass sie die unhandlichen Programme ebenfalls installieren. Ein Handtelefon lässt sich nicht mehr lokalisieren, wenn man es in eine Aluminiumhülle steckt. Aber dann kann man auch nicht mehr angerufen werden. Der Ertrag von Julia Angwins Experiment: Der Preis für die Rettung des Selbstherrschaftswissens wäre die Bereitschaft, das Leben eines Eremiten zu führen. Sie hat einen Aktivisten getroffen, der sich als "Überwachungsverganer" definiert und auch vor Freunden geheim hält, wo er wohnt.
Für einen blickgeschützten Elektropostkanal würde Julia Angwin durchaus zweihundert Dollar im Jahr zahlen. Die Nachfrage reicht nicht aus. Verfügbare Chiffrierprogramme sind auch deshalb umständlich, weil es Open-Source-Produkte sind, an denen die Erfinder weiterbasteln. Ein Zuhörer der Buchvorstellung in New York, der in den siebziger Jahren zum Stab des Senatsausschusses gehörte, der die gesetzgeberischen Konsequenzen aus dem Watergate-Schock zog, berichtet von einem Sinneswandel seiner liberalen Freunde. Sie hätten sich damit abgefunden, dass die Regierung ihren Gebrauch der Meinungsfreiheit protokolliere; die bloße Möglichkeit des Nutzens für die Terrorprävention genüge ihnen.
Der Rechtsprofessor Eric Posner, der Sohn des bekannten Richters Richard Posner, der von seinem Vater mit dem Verstand auch die pragmatische Denkungsart geerbt hat, schlug kürzlich in einer kritischen Anmerkung zum NSA-kritischen Urteil von Richter Richard Leon aus Washington vor, man solle sich darauf einstellen, dass die moderne Gesellschaft wieder zur kleinstädtischen Gemeinschaft werde, deren Bürger keine Geheimnisse voreinander hätten. Julia Angwin möchte sich daran nicht gewöhnen. Ihr Selbstversuch soll die Absurdität der Lage enthüllen. Kann es wirklich sein, dass man sich im eigenen Land konspirativ wie ein Spion verhalten muss, um nicht ausspioniert zu werden?
PATRICK BAHNERS
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main