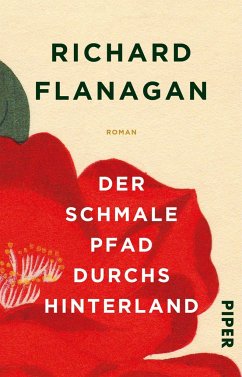geteilt. Kann man sich mit einem Dieb, Räuber, Mörder identifizieren? Der erstaunliche, 58 Seiten langen Brief, den er kurz vor seiner Festnahme 1879 einem Komplizen diktierte, dürfte für den fünften Kontinent einer der wichtigsten Texte der Epoche sein. Mit diesem Jerilderie Letter, der als Eingabe an einen Parlamentsabgeordneten adressiert war, hoffte der Bandit, sein Geschick zu wenden. Der Historiker Alex McDermott charakterisiert ihn aufgrund des Schreibens als hochintelligent und gefährlich, als verzweifelten Mann, der die Welt zwingen will, ihm zuzuhören. Carey hatte den Ton dieses Briefes mitsamt seiner fehlerhaften Grammatik, den er 1964 erstmals las, im Ohr. Er wurde zur Keimzelle seines Romans. Der Auslöser aber waren Sidney Nolans Bilder, die Kelly im Kampf mit den Ordnungsmächten zeigen. Der Verbrecher stampft einher wie eine mittelalterliche Kriegsmaschine.
Dieses Bild betrachten die Australier als eine der Ikonen ihrer Geschichte. Damit setzt Careys Roman ein. Der Gangster erzählt die Geschichte selbst, er legt Rechenschaft ab vor seiner nie gesehenen Tochter, die mit ihrer Mutter nach Amerika entkommen ist. Sie soll die wahre Geschichte wissen, damit sie nicht mit Lügen aufwächst. Lüge ist ein Schlüsselbegriff in Careys Werk. Mark Twain hallt darin nach, der 1897 schrieb, die australische Geschichte könne nicht als Geschichte gelesen werden, sondern als eine Folge von Lügen. Der Roman trägt das Gewand der Chronik: Er ist in dreizehn "Päckchen" aufgeteilt, die der fiktive Autor nach Abfassen jedes Kapitels schnürt. Der Befund von Papier, Tinte, Verpackung wird mit wissenschaftlicher Akribie wiedergegeben, zu der die treuherzige Inhaltsangabe jedes Päckchens einen reizvollen Kontrast bildet.
Ned Kellys Leben steht im Zeichen bitterer Armut. Seine früh verwitwete Mutter, die illegal Schnaps verkauft, weiß nicht, wie sie ihre ständig wachsende Kinderschar durchbringen soll. Alles, was Ned will, ist "ein bißchen Land und einen Herd an dem wir abends sitzen konnten". Die Liebe seines Lebens ist die Mutter, Ellen Kelly, immer schwanger von vorbeikommenden Kerlen, die Ned "großmäulige Halunken" und "Klosettratten" nennt. Zu den anrührendsten Szenen des Buchs gehört die Schilderung, wie der Elfjährige seiner Mutter hilft, auf dem Küchentisch ein Kind zur Welt zu bringen. Wehmütig schreibt er seiner Tochter: "Ich habe Mütter in ihrem Alter gesehen sie waren rundlich und weich mit schimmernder Haut von Sahne und Roastbeef verwöhnt aber die Hände von meiner Mutter waren groß und vertrocknet wie Wurzeln die man aus der harten Erde von Gretna ausgebuddelt hat." Die Mutter gibt Ned bei einem berüchtigen Buschklepper in die Lehre. Aber die Wegelagerei bringt nicht viel ein, wenn man sie nicht im großen Stil betreibt. Doch in die Gesetzlosigkeit treibt Ned erst die Bedrängnis der armen Farmer durch die Großgrundbesitzer, die Korruptheit der Polizei, welche die Reichen schützt, Verhaftete foltert.
Carey macht seinen Räuber zum Autor. Kelly liest die Bibel, Shakespeare, den volkstümlichen Roman "Lorna Doone" und wird selbst zum Schriftsteller. Da der Abgeordnete, der für die Rechte der Armen eintritt, Kellys Eingabe nicht druckt, zieht sich der inzwischen Gejagte noch einmal in die Wildnis zurück, um sein Buch zu schreiben. In einer Kleinstadt, wo die vierköpfige Bande vor dem letzten Gefecht die halbe Einwohnerschaft als Geiseln nimmt, übergibt der Autor sein Werk einem Lehrer, der ihn verrät. Der Mann räsoniert über Ned Kelly: "Fehlt uns ein Jefferson? Ein Disraeli? Können wir denn keinen Besseren als einen Pferdedieb und Mörder finden, den wir bewundern?" Dies sind Careys ureigene Fragen. Der Outlaw, der mit seinen Komplizen drei Polizisten erschossen hat, läßt seinen Gefangenen eine Passage aus Shakespeares "Heinrich V." vorlesen. In die Lesung flicht Carey sein Urteil über die Kelly-Gang ein: "Diese Jungs waren edel von echter australischer Art."
Er ist überzeugt, daß Ned aus Notwehr getötet hat; seine anderen Taten betrachtet er als läßliche Vergehen. In der australischen Reaktion auf das Buch fanden sich denn auch Stimmen, die ihm vorhielten, einen Verbrecher reingewaschen zu haben. Carey zitiert einen Polizeikommissar, der über Kelly sagte, er spiegle "das schwarze Herz des Nichts, welches das Zentrum des australischen Charakters" bilde. In England erhielt der Roman den Booker-Preis.
Der deutsche Leser kann das Buch wie eine geradlinig erzählte, melodramatische Wildwestgeschichte lesen. In dieser feindlichen Natur, die hautnah spürbar wird, ist immer ungeheuer viel los, was freilich auf über vierhundert Seiten auch ermüden kann. Eine unüberwindliche Barriere ist der "sound", das atemlose Kelly-Idiom mit seinen Manierismen, die Sprechweise in einer Region der Provinz Victoria in den sechziger und siebziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts. Carey, der behauptet, sie noch auf dem Kinderspielplatz gehört zu haben, wollte daraus bereits Joyce und Beckett heraushören. Dies kann die Übersetzung nicht wiedergeben. Doch William Faulkners Motto, das der Autor seinem Roman voranstellt, könnte auch über vielen deutschen Texten stehen. "Die Vergangenheit ist nicht tot. Sie ist nicht einmal vergangen."
Peter Carey: "Die wahre Geschichte von Ned Kelly und seiner Gang". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Regina Rawlinson und Angela Schmitz. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2002. 448 S., geb., 22,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
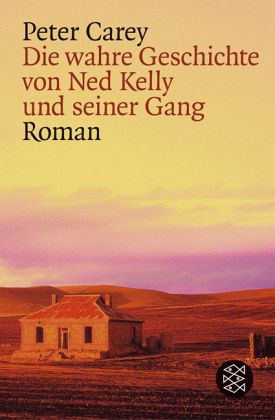




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.06.2002
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.06.2002