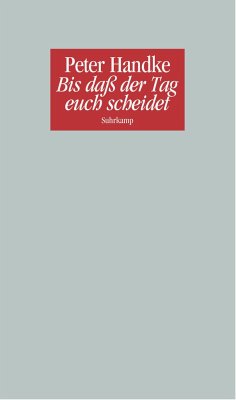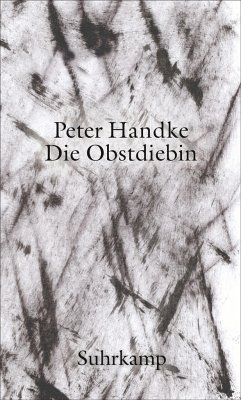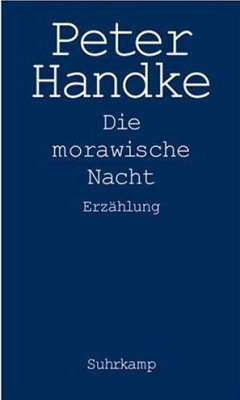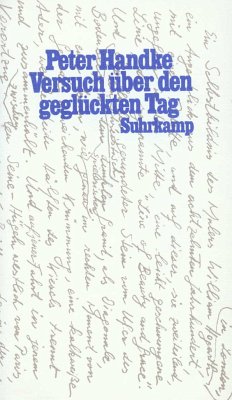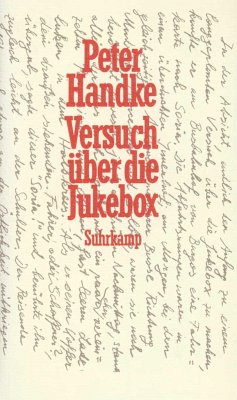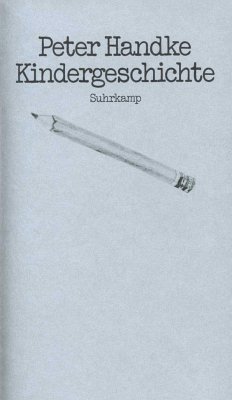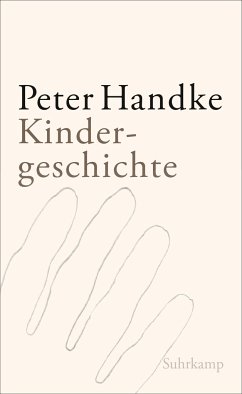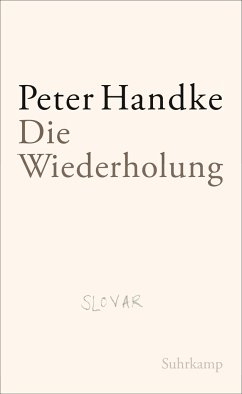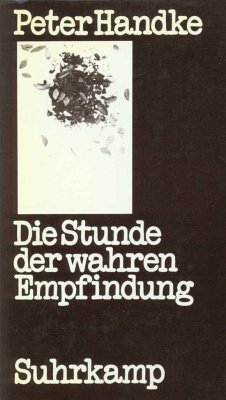spielerisch leicht wirkt dagegen sein neuestes Werk: "Der Himmel und ich, wir zwei schwofen!", ruft darin jemand. Es ist ein Sprachtanz unter ziemlich heiterem Himmel, den Handke hier aufführt: "Schauspiel in vier Jahreszeiten" nennt sich das im Untertitel, aber ob das wirklich Drama oder doch Epos ist, lässt sich gar nicht so leicht sagen. Denn das Ich, das dort spricht, kann sich selbst nicht entscheiden, es spaltet sich in "Ich, der Dramatische" und "Ich, der Epische" und gerät darüber mit sich selbst in Streit.
Das klingt nun schon wieder kompliziert, aber wissen muss man ja eigentlich nur, dass bei Handke wie eh und je die Wirklichkeit erst im Sprechen entsteht: Man hört live dabei zu, man beobachtet den Dichter im Moment seiner Inspiration: "Kommen lassen. Anfliegen lassen. Träumen lassen. Hellträumen. Umfassend träumen. Verbindlich!" Was Handke hier zu Beginn macht, kann man wie eine Art Umkehrung von Kafkas "Wunsch, Indianer zu werden" verstehen: In dieser Prosaskizze, wir erinnern uns, endet auf kürzester Sprachstrecke der träumerische Wunsch, wild durch die Gegend zu reiten, in einer Desillusionierung, denn plötzlich gibt es keine Sporen und auch keine Zügel mehr.
Handke dagegen illusioniert: "Und da kommt sie, da erscheint sie, da fliegt sie mich an, da erstreckt sie sich, die Landstraße, vorderhand leer. Und indem ich mir das laut vorerzähle, ist die Straße auch schon bevölkert in mir, der ICH am Rand der Straße daherschlendere, vorderhand allein."
Aber das bleibt nicht lange so, denn zu dem schelmischen Ich-Erzählerduo gesellt sich bald weiteres Personal, so natürlich noch ein "Doppelgänger" (alte Märchen und manche frühere Handke-Texte lassen grüßen), dann eine Gruppe der "Unschuldigen", dann wird es auch tatsächlich noch indianisch, denn es treten ein "Häuptling" und eine "Häuptlingin" auf und schließlich die große "Unbekannte von der Landstraße", eine veritable Traumfrau zunächst, die sich dem gestaltenden Träumer unter der Hand verformt. Aber so genau unterscheiden muss man diese Figuren vielleicht gar nicht, es sind Stimmen im Chor eines modernen Splitter-Ichs, Gespinste, die vor den Augen des Lesers erst ersonnen und gesponnen werden, und darin ist Handke schon lange ein Meister. In seinem "Don Juan, (erzählt von ihm selbst)" (2004) etwa hat er das schon sehr amüsant vorgeführt. Hier nun gibt es ein noch wilderes und freieres Durcheinanderpurzeln von Erfahrungen des wie immer mit dem Autor biographisch enggeführten Ich-Erzählers, von imaginierten Streitgesprächen über Fragen der Rechtschreibung und sogar surrealistisch anmutenden Passagen des assoziativen Schreibens - man könnte dieses Werk wohl auch ein Gedicht nennen.
Von Handlung zu sprechen wäre übertrieben, auch der Ort ist kein kleinerer als das Universum der Literatur. Es ist unklar, in welchem Land diese Landstraße liegt, ob sie "La strada. La carretera. Magistrala" ist oder "Tariq hamm". In diesem Universum wispert der Wind Shakespeare-Zitate und solche aus alten deutschen Schlagern, dann wieder ertönt große Oper: Eine Frau "lacht ein Koloraturlachen", der Erzähler singt plötzlich die Vogelfänger-Arie. Manchmal hat man auch das Gefühl, dass hier jemand Handkes mittlerweile großes Werk noch einmal nachträumt, durcheinander- und zusammenträumt, freudianisch gesagt: verschiebt und verdichtet. Wir bewegen uns zwischen Oberursel und Alaska, und lauter kleine Anspielungen auf frühere Werke sind eingestreut: "Freude, holder Niemandsfunken", ruft da einer, der wenig später in der dunklen Nacht aus seinem stillen Haus tritt. Und manchmal darf man sogar vermuten, dass Handke seine eigene Sprachkritik auf die Schippe nimmt, karikiert als Klugscheißerei der Ewiggestrigen, wenn jemand etwa salbadert: "Semikolon: Das Unwort des Jahres. Dagegen Strichpunkt: Das Wort sagt mir zu. Strichpunkt. Nur ist der Strichpunkt abgeschafft. Und das scharfe ,s' ist abgeschafft. Und Pommerland ist abgebrannt."
Es wäre natürlich noch kein richtiges Handke-Werk, wenn darin nicht auch Wut steckte. Sie richtet sich gegen die anonyme Masse der "Unschuldigen", die zu allem eine mutige Meinung haben, aber sich nie die Hände schmutzig machen. Der Erzähler verflucht diese Unschuldigen als Menschenplage, ihm wäre es viel lieber, sie wären Erzbösewichte.
Die regelrechte Lust am Schimpfen, die er dabei entwickelt, ist das Unterhaltsamste an diesem Buch: Als "Hirnschrott", "Zwetschgenröster", "Menschengewordene Fischgrätmuster" und "tätowierte Schwimmlehrer" werden die Unschuldigen geschmäht, schließlich auch als "Pack! Doppelpack! Tetrapack!". Dem gegenüber steht - alte Vorliebe des Autors für Western-Filme - der einsame Desperado, der Irrläufer. Aber verletzen kann das Geschimpfe eigentlich nur diesen selbst, befindet sich doch der Erzähler erklärtermaßen nur "im dramatischen Selbstgespräch", in dem er letztlich sein Heil vermutet.
JAN WIELE
Peter Handke: "Die Unschuldigen, ich und die Unbekannte am Rand der Landstraße". Ein Schauspiel in vier Jahreszeiten.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2015. 177 S., br., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
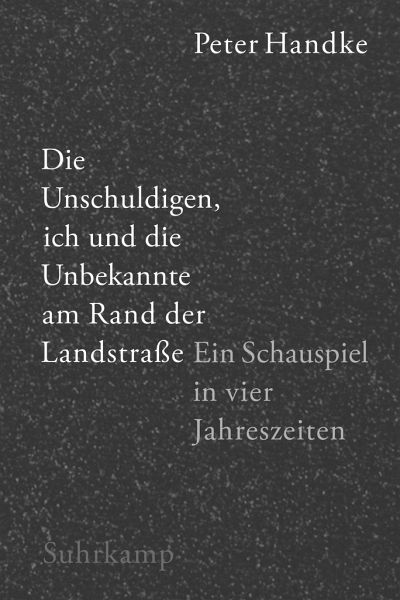





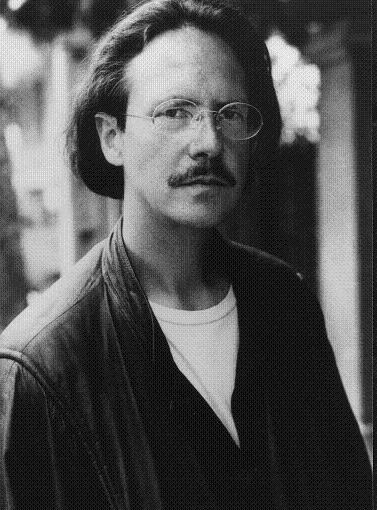
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.07.2015
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.07.2015