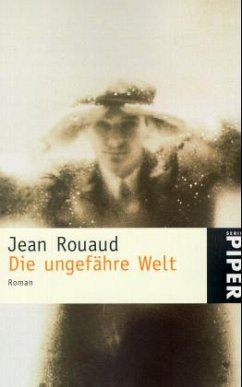Nach seinen ersten beiden Romanen "Die Felder der Ehre" und "Hadrians Villa in unserem Garten" erzählt Jean Rouaud seine persönliche Geschichte fort. Mit dem ihm eigenen leisen Humor und unverkennbarer Selbstironie porträtiert er sich selbst als eine Art Woody Allen der französischen Provinz, extrem kurzsichtig und deshalb die Welt um sich her nur "ungefähr" wahrnehmend.

Jean Rouaud kennt die Nöte des Kurzsichtigen · Von Friedmar Apel
Wer je ein Vélosolex gefahren ist, der hat diese liebenswerte Fehlkonstruktion nicht vergessen. Die Freuden dieser Fortbewegungsart nicht und auch nicht die Leiden, die bei Regen ihre sublimste Ausprägung erfuhren: "Mit dem quer auf den Gepäckträger des Vélosolex geschnallten schwarzen Geigenkasten, der zwischen die Beine geklemmten Sporttasche und der mit Klebstreifen am Lenker befestigten Wegbeschreibung zum großmütterlichen Bauernhof fiel es mir, die Beine auf dem kleinen Trittbrett, nicht gerade leicht, die Spur zu halten, zumal die Straße naß war, und abgesehen davon, daß ich jederzeit ausrutschen konnte, griff die Antriebsrolle des Motors am Reifen des Vorderrads nicht immer richtig, weshalb ich, während ich kräftig in die Pedale trat, den Motorblock mittels des senkrecht am Zylinder angebrachten und am oberen Ende mit einer schwarzen Bakelitkugel versehenen Hebels herunterdrücken mußte, damit ein ständiger Kontakt zwischen dem Antrieb und dem nassen Gummireifen gewährleistet war. Andernfalls heulte der Motor auf und drehte durch, so daß man kaum noch von der Stelle kam und das heikle Gleichgewicht von Mensch und Maschine aufgrund des hochliegenden Schwerpunkts nur mit Mühe halten konnte."
Mit solch detailversessener Sachkunde und einer chaplinesk umständlichen Aufmerksamkeit für die Tücken der Objekte und die kleinen Desaster des Alltags erzählt Jean Rouaud die Geschichte eines Provinzlers aus der Achtundsechziger-Generation, von den Widerstandsübungen der Internatszeit am regnerischen Atlantik bis zur höchst ambivalenten Befreiung im Paris der Studentenrevolution. Das beginnt mit vierzig köstlichen Seiten über die einsamen Erfahrungen eines Fußballspielers in der untersten Liga. Eindringlicher und dazu witziger ist seit Alan Silitoes "Die Einsamkeit eines Langstreckenläufers" nicht von der Rolle des Sports in der jugendlichen Sozialisation erzählt worden. Auch diese Beschreibung ist von höchster Kennerschaft, den Kundigen irritiert freilich ein Detail: Der eigenwillige Stürmer fixiert beim Dribbeln immer den Ball, was wie man bereits in der D-Jugend lernt dessen Besitz für gewöhnlich verkürzt. Des Rätsels Lösung ist einfach und doch der tragende Grund einer subtilen dialektischen Erzählerperspektive: "Als Kurzsichtiger nehme ich alles verwackelt wahr, und die Welt wird dadurch auf Distanz gehalten und auf einen engen Gesichtskreis voller Klarheit beschränkt, jenseits dessen die Formen ihre scharfe Konturierung verlieren und alles immer unbestimmter, nebulöser wird." Ein solcher Spieler agiert natürlich wenig mannschaftsdienlich, und auch das politische Kollektiv wird ihm fremd bleiben. Was aber seine Erzählung betrifft, so tritt die Sichtbarkeit der nahen Dinge zur Hörbarkeit der Welt in ein besonderes Verhältnis, das den Beschreibungsstil unverwechselbar prägt und dem Leser die Funktion poetischer Erinnerung in vollendeter Klarheit vor Augen und zu Gehör bringt. Die vor der Welt verheimlichte Kurzsichtigkeit fördert nämlich die Literaturfähigkeit, die Autonomie jenes inneren Raums, "der sich gegen Beweise und Neuerproben sperrt und in dem sich seltsame Gedanken regen".
"Schreiben ist eine einsame Angelegenheit"; das war schon immer so, für den Kurzsichtigen aber potenziert sich dies noch einmal, und so ist Rouauds erzählte Welt erfüllt von bitteren Erfahrungen der Isolation und der Kränkung durch eine blinde Mitwelt. Keiner der wiederkehrenden Tränenschleier aber kann den wunderbaren Klarblick des Erzählers auf Dauer trüben. Rouaud beherrscht die schöne Kunst des Scheiterns, die dem Zukurzgekommenen, der sich doch nach dem "Los der Normalen" sehnt, eine eigentümliche Würde verleiht, während die Welt die Gestalt der Groteske annimmt. In einer Erzählstrategie fiktiver Selbstbelehrung, die die eigene Unfähigkeit immer schon vorwegnimmt, wird gleichzeitig das Pathos der (Achtundsechziger-) Welt zum Absturz gebracht. Um die Erfahrungen der anderen zu teilen, lernt zum Beispiel der Erzähler Gitarre spielen, nämlich einige Akkorde herunterzudreschen, und geht nun zur nächsten Stufe über: "Du hast nun die Möglichkeit, zu ebendiesen Akkorden zu singen, nicht aus voller Kehle (als Anfänger neigt man eher dazu, die Dinge zurückhaltend anzugehen), sondern mit piepsiger, näselnder Stimme, und zwar kämpferische Protestlieder und zersetzende Hymnen, die die bestehende Ordnung in Frage stellen und dadurch der besitzenden Klasse großen Schaden zufügen."
Ein beherrschendes Thema der Literatur der siebziger Jahre war die Abrechnung mit den Vätern. Nichts davon bei Rouaud. Schon in den vorausgehenden Romanen "Die Felder der Ehre" (deutsch 1993) und "Hadrians Villa in unserem Garten" (deutsch 1994), die die Schicksale der Großeltern und Eltern vor einer ebenso präzisen zeitgeschichtlichen Folie beschrieben, wie sie auch hier geboten wird, war der Blick auf die Altvorderen so kritisch und ironisch wie zugewandt und liebevoll. Auch in dem neuen Text erscheint der frühe Tod des Vaters wieder als eine Chiffre des Traditionsverlusts und des Ausgeliefertseins an die Welt. In bester Manier literarischer (und politischer) Ironie löst Rouaud sein Traditionsproblem, indem er erzählt, während er von der Unmöglichkeit des Erzählens spricht. So kann von allem erzählt werden, auch von der Liebe mit und ohne Brille und wie amüsant!
Wie die Geschichte mit Théo ausgeht, die schöne Augen hat, wird hier selbstverständlich sowenig verraten wie der Ausgang des Ganzen. Rouauds Roman ist dem Inhalt nach eine "Éducation sentimentale" seiner Generation, der Form nach knüpft er so überzeugend wie charmant an die Erzählkunst in der Tradition des "Don Quijote" an: Wie die Narrheit des Ritters die Narreteien der beginnenden Neuzeit enthüllte, so gibt Rouauds Erzähler den Blick auf die Kurzsichtigkeit seiner Epoche und ihrer Akteure frei.
Jean Rouaud: "Die ungefähre Welt". Roman. Aus dem Französischen übersetzt von Carina von Enzensberg und Hartmut Zahn. Piper Verlag, München 1997. 275 S., geb., 36, DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Beste Unterhaltung und gleichzeitig große Literatur." (Neue Züricher Zeitung)