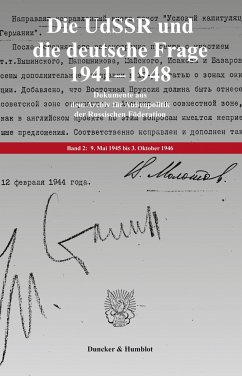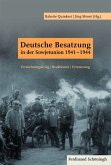Mit dieser Dokumentensammlung liegt erstmals in deutscher Sprache eine wissenschaftliche Edition maßgeblicher sowjetischer Quellen vor, die Hintergründe und Abläufe der sowjetischen Deutschlandpolitik von 1941 bis 1949 offenlegen. Die Edition ermöglicht detaillierte Einblicke in die Entwicklung der sowjetischen Kriegsziele gegenüber Deutschland, der Besatzungspolitik der UdSSR sowie ihrer Zusammenarbeit mit den westlichen Alliierten - bis zu deren Abbruch. So entsteht ein authentisches Bild der Sichtweise der UdSSR und ihres Anteils an jenem Prozess, der schließlich zur deutschen Teilung führte.
Die Auswahl basiert auf den für die Jahre 1941 bis 1949 betreffenden Akten des Archivs für Außenpolitik der Russischen Föderation (AVP RF). Der vierte Band bezieht darüber hinaus Quellen des Staatsarchivs der Russischen Föderation (GARF) und dem Russischen Staatsarchiv für soziale und politische Geschichte und zwei weiteren russischen Archiven in die Dokumentenauswahl mit ein. Insgesamt umfassen alle vier Bände 670 Dokumente. Ein umfangreicher wissenschaftlicher Apparat bietet zusätzliche Informationen über Forschungskontroversen (u.a. Zweite Front, Kriegsverbrechen, Friedensfühler, Reparationen, sowjetische Besatzungspolitik, Friedensvertrag, Berliner Blockade und doppelte Staatsgründung), weist auf weitere Quellen hin und enthält - vollständig oder in Auszügen - ebenfalls relevante Dokumente. Umfangreiche Einleitungen stellen die Quellenauswahl im Kontext der sowjetischen Deutschlandpolitik und deren Überlieferung im AVP RF thematisch zusammenhängend vor. Im vierten Band erhält der Benutzer in zwei selbständigen Einführungen Einblick in die aktuelle deutsch-russische Kontroverse über die Einordnung der sowjetischen Berlin-Politik. Jeder Band kann durch biographische und geographische Verzeichnisse sowie durch ein Sachregister erschlossen werden.
Damit ist diese Edition ein unentbehrliches Arbeitsmittel für alle Forschungen zur deutschen und sowjetischen Geschichte jener Zeit, aber auch zu den Beziehungen der Großmächte in den Anfangsjahren des Kalten Krieges.
Die Auswahl basiert auf den für die Jahre 1941 bis 1949 betreffenden Akten des Archivs für Außenpolitik der Russischen Föderation (AVP RF). Der vierte Band bezieht darüber hinaus Quellen des Staatsarchivs der Russischen Föderation (GARF) und dem Russischen Staatsarchiv für soziale und politische Geschichte und zwei weiteren russischen Archiven in die Dokumentenauswahl mit ein. Insgesamt umfassen alle vier Bände 670 Dokumente. Ein umfangreicher wissenschaftlicher Apparat bietet zusätzliche Informationen über Forschungskontroversen (u.a. Zweite Front, Kriegsverbrechen, Friedensfühler, Reparationen, sowjetische Besatzungspolitik, Friedensvertrag, Berliner Blockade und doppelte Staatsgründung), weist auf weitere Quellen hin und enthält - vollständig oder in Auszügen - ebenfalls relevante Dokumente. Umfangreiche Einleitungen stellen die Quellenauswahl im Kontext der sowjetischen Deutschlandpolitik und deren Überlieferung im AVP RF thematisch zusammenhängend vor. Im vierten Band erhält der Benutzer in zwei selbständigen Einführungen Einblick in die aktuelle deutsch-russische Kontroverse über die Einordnung der sowjetischen Berlin-Politik. Jeder Band kann durch biographische und geographische Verzeichnisse sowie durch ein Sachregister erschlossen werden.
Damit ist diese Edition ein unentbehrliches Arbeitsmittel für alle Forschungen zur deutschen und sowjetischen Geschichte jener Zeit, aber auch zu den Beziehungen der Großmächte in den Anfangsjahren des Kalten Krieges.

Stalin glaubte noch 1948, einen Friedensvertrag mit Deutschland durchsetzen zu können
Jochen P. Laufer/Georgij P. Kynin (Herausgeber): Die UdSSR und die deutsche Frage 1941-1948. Dokumente aus dem Archiv für Außenpolitik der Russischen Föderation. 3 Bände. Verlag Duncker & Humblot, Berlin 2004. 2400 Seiten, 240,- [Euro].
Im Januar 1944 hielt Iwan Majskij, einer der Stellvertreter Molotows im Amt des sowjetischen Außenministers, in einem Memorandum fest, wie man sich in Moskau die Welt nach dem Sieg über Hitler-Deutschland vorstellte. Danach sollte die Staatsordnung in den befreiten Ländern West- wie Osteuropas auf den "Prinzipien einer umfassenden Demokratie im Geiste der Volksfront" beruhen. Wo es vor dem Krieg keine Demokratie gab, in Deutschland also, aber auch in Ländern wie Polen oder Griechenland, sollten die Siegermächte sie einführen. Majskij hielt eine "Zusammenarbeit zwischen der UdSSR, den USA und England" bei der Demokratisierung Europas für ebenso möglich wie notwendig.
Majskijs Grundsatzpapier, das der Forschung seit Mitte der neunziger Jahre bekannt ist, kann man jetzt in der deutschen Fassung einer reichhaltigen Auswahl von Schriftstücken aus dem Archiv für Außenpolitik der Russischen Föderation nachlesen, die Jochen Laufer und Georgij Kynin im Rahmen einer deutsch-russischen Historikerkooperation erstellt haben. Sie bietet kein grundsätzlich neues Bild der sowjetischen Deutschlandpolitik nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Wohl aber wird vieles bekräftigt und präzisiert, was bislang nur in Grundzügen zu erkennen war. So geht aus den Dokumenten unzweideutig hervor, daß Stalin bis ins Frühjahr 1945 hinein auf die Aufteilung Deutschlands in mehrere, voneinander unabhängige Einzelstaaten setzte. In die Konferenz von Jalta ging die sowjetische Delegation mit einem Papier, das eine Aufteilung in sieben Staaten vorsah: ein im Osten und Norden reduziertes Preußen, einen norddeutschen Staat und einen rheinisch-westfälischen Staat, dazu dann Sachsen, Bayern, Württemberg und Baden als eigenständige Staaten im Süden. Die Sowjetführer waren bereit, sich eine weniger rigide Aufteilung abhandeln zu lassen; am Prinzip des dismemberment aber glaubten sie festhalten zu müssen.
Stalin gab die Aufteilungspläne erst auf, als er Widerstand bei den Westmächten registrierte. Um nicht von den Westmächten als Verfechter einer allzu harten Politik bloßgestellt zu werden, bestand er darauf, daß sich die westlichen Verbündeten als erste auf einen konkreten Teilungsplan festlegten. Nachdem eine solche Festlegung ausblieb, ging er vom Zeitpunkt der deutschen Kapitulation an mit einem öffentlichen Bekenntnis zu einem einheitlichen Nachkriegsdeutschland in die Offensive. Ganz offensichtlich war ihm bewußt, daß er die Kontrolle über das deutsche Kriegspotential nur in Kooperation mit den Verbündeten sichern konnte. Die Herausgeber sehen die sowjetische Forderung nach Errichtung deutscher Zentralverwaltungen taktisch bedingt und suggerieren, daß Stalin an einem Scheitern der deutschlandpolitischen Verhandlungen des Alliierten Außenministerrats 1947 interessiert war. Aus den Dokumenten läßt sich eine solche Deutung nicht ableiten. Tatsächlich bezeichnete Molotow die Ergebnisse der Potsdamer Konferenz, die die Errichtung von Zentralverwaltungen mit einem Programm zur Demokratisierung Deutschlands verbunden hatte, in einem Runderlaß als "im vollen Maße zufriedenstellend". Für die Sowjetische Militäradministration in Deutschland wurde ein detailliertes Programm zur Umsetzung der Potsdamer Beschlüsse ausgearbeitet, das weder Zweifel an ihrer Realisierung noch Mißtrauen gegenüber den Westmächten erkennen ließ.
Im Januar 1947 drängte Stalin im Gespräch mit den SED-Führern darauf, die SED "so schnell wie möglich" auch in Westdeutschland zu etablieren. Als Otto Grotewohl ihm entgegenhielt, dem stünde die Forderung der Westmächte nach Wiederzulassung der SPD in der Ostzone entgegen, insistierte der Kreml-Chef, dann müsse man dieser Forderung nachkommen; die SED dürfe die Konkurrenz der SPD nicht fürchten. Weiter verlangte er, eine Auffangpartei für ehemalige Nationalsozialisten zu gründen: Diese sollten nicht alle den Amerikanern in die Hände getrieben werden. Noch im März 1948, als die Westmächte schon über die Konditionen der Gründung eines westdeutschen Staates verhandelten, bestand Stalin, wiederum im Gespräch mit der SED-Führung, auf der Ausarbeitung einer gesamtdeutschen Verfassung. Daß sie in kurzer Frist Geltung erlangen könnte, glaubte er jetzt nicht mehr. Doch sollte die Diskussion über die Verfassung dazu dienen, "die Leute geistig auf die Einheit vorzubereiten. Wenn diese Idee in den Köpfen der Menschen verankert sein wird, kann man die Einheit nicht mehr zerstören."
Eher wird man davon sprechen können, daß Stalins übergroßes Mißtrauen einer konsequenten Verwirklichung seines Programms im Wege stand. Als der amerikanische Außenminister James F. Byrnes im September 1945 einen Pakt zur dauerhaften Entmilitarisierung Deutschlands anbot, witterte der Moskauer Diktator darin nur eine Entwertung der Bündnisse, die die Sowjetunion mit europäischen Staaten geschlossen hatte. Das amerikanische Angebot wurde nach langem Hinhalten als ungenügend zurückgewiesen.
Eine gesamtdeutsche Beratung aller Parteien "zur Frage der deutschen Einheit" hielt Stalin Anfang 1947 für hilfreich. Als der bayerische Ministerpräsident Hans Ehard im Mai die Initiative zu einer Konferenz der Ministerpräsidenten in München ergriff, untersagte Molotow jedoch eine Teilnahme der ostdeutschen Regierungschefs. Nur bei einer Beteiligung der Vertreter der Parteien, Gewerkschaften und gesellschaftlichen Organisationen schien der Kreml-Führung gewährleistet, daß die Zusammenkunft nicht im antisowjetischen Sinne instrumentalisiert würde. Darüber hinaus wurde der Erfolg des Stalinschen Deutschlandprogramms auch durch die Unzulänglichkeiten seiner autokratischen Regierungsweise beeinträchtigt. Eingaben der sowjetischen Vertreter in Berlin, die durchaus auf eine Verbesserung der Verständigung mit den Westalliierten zielten, blieben häufig unbeantwortet. Selbst die Vorlagen der zuständigen deutschlandpolitischen Abteilung des Außenministeriums fanden manchmal nicht die erforderliche Aufmerksamkeit des Kreml-Chefs, oder er zögerte, auf sie einzugehen.
Statt dessen setzte Stalin immer wieder spontan und ohne jede Beratung eigene Ideen in die Welt, die sich mit den Realitäten schlecht vertrugen. Wenn sie in die Form eines Politbüro-Beschlusses gegossen wurden wie eine Grundsatz-Direktive vom 13. Juni 1946, die die Bildung einer deutschen Regierung zeitlich vor den Abschluß eines Friedensvertrages setzte, wirkten sie wie ein Korsett, das die sowjetische Diplomatie in ihrer Handlungsfähigkeit einschränkte. Andernfalls blieben sie häufig folgenlos. Im Juli 1947 forderte Außenminister-Stellvertreter Andrej Wyschinskij bei Stalins zeitweiligem Günstling Andrej Shdanow eine Anweisung an, den Widerstand der SED-Führung gegen eine Wiederzulassung der SPD zu brechen. Eine Antwort blieb jedoch aus. Die sowjetischen Stellen in Deutschland wurden in der Wiederzulassungsfrage nicht weiter aktiv. Bis sie die Gründung einer Partei für ehemals aktive Nationalsozialisten ins Werk setzten, vergingen weitere elf Monate.
Die Dokumentation bestätigt damit einmal mehr, daß der Weg zur Ost-West-Teilung Deutschlands komplizierter war, als es nicht nur der Gründungsmythos der DDR wahrhaben wollte, sondern auch die Erinnerung der meisten Westdeutschen. Zu den Faktoren, die zur Zweistaatlichkeit führten, zählten auch der umfassende Kontrollanspruch eines Walter Ulbricht und das mit der Zeit immer stärkere Bestreben der SED-Führung, die Besatzungsherrschaft abzustreifen. Beides scheint auch in der hier vorliegenden Sammlung gelegentlich auf.
So schlug Ulbricht schon im September 1946 die Bildung eines zentralen deutschen Amtes für Wirtschaftsplanung in der sowjetischen Zone vor, das die Leitung der Wirtschaft in die Hand nehmen sollte. Bis zur Konstituierung dieses Amtes sollte die Militäradministration den Wirtschaftsplan mit kompetenten Mitgliedern des SED-Vorstands absprechen. SMAD-Chef Wassilij Sokolowskij und Politberater Wladimir Semjonow kritisierten in einem Bericht an die Moskauer Zentrale im Januar 1947 "unkorrektes" Verhalten von Ulbricht, vor allem gegenüber ehemals sozialdemokratischen Mitgliedern der SED. Er verfalle "häufig in einen Befehlston", der seinem Ansehen schade.
Die umfangreiche und sorgfältig edierte Dokumentation erzählt freilich immer noch nicht die ganze Geschichte. Sie beschränkt sich, arbeitstechnisch unvermeidlich, auf die Bestände des sowjetischen Außenministeriums und hier auf die Teile, die von den Regierungsstellen der Russischen Föderation für die Forschung freigegeben wurden. Aus dem Präsidentenarchiv konnten nur zwei Protokolle von Unterredungen Stalins mit der SED-Führung herangezogen werden; der Zugang zu den Archiven des Verteidigungsministeriums, der Geheimdienste und des Außenhandelsministeriums blieb den Bearbeitern verwehrt. Das ist insofern besonders bedauerlich, als dem sowjetischen Außenministerium keineswegs die Koordinierung der gesamten Deutschlandpolitik oblag. Allein auf der Grundlage seiner Akten können die Entscheidungsprozesse nur unvollständig erfaßt werden. Es bleibt zu hoffen, daß die Veröffentlichung der Aktenauswahl für die Jahre 1941 bis 1948 nicht nur zu einem realistischen Bild der sowjetischen Deutschlandpolitik beiträgt, sondern auch die Einsicht fördert, daß weitere Aktenfreigaben dringend notwendig sind.
WILFRIED LOTH
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Auch wenn hier keine einzelnen Details gewürdigt werden können, so sei doch erwähnt, daß sich jede künftige Beschäftigung mit dem beginnenden Kalten Krieg in Europa ohne die Berücksichtigung dieser Edition von Jochen P. Laufer und Georg P. Kynin dem Vorwurf aussetzen wird, die empirischen Möglichkeiten des Themas nicht ausgeschöpft zu haben. Es bleibt zu hoffen, daß dieses Projekt in Rußland die Freiheit durchsetzt, auch andere Überlieferungen für russisch-deutsche Kooperationsvorhaben freizugeben." Ilko-Sascha Kowalczuk, in: Jahrbuch Extremismus & Demokratie, 17/2005