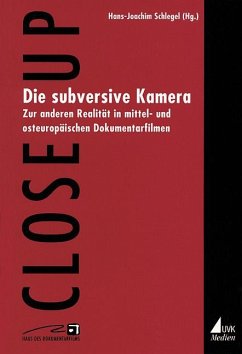Dokumentarfilme aus Ländern des 'RealenSozialismus' wurden im 'Westen' wohl auch deshalb so wenig beachtet, weil man sie von vornherein als Auftragsfilme offiziöser Wirklichkeitssicht und Propagandahielt. Doch neben den angepaßten 'Wegen zur Lüge' sind hier auch zahlreiche, mit List und Erfindungsreichtum eingeschlagene 'Wege zur Wahrheit' zu entdecken. Mit ästhetischem Eigensinn und gesellschaftspolitischen Widerspruchsgeist verstanden es polnische, ungarische, jugoslawische, tschechische und slowakische, aber auch bulgarische und sowjetische Dokumenatristen immer wieder, sich dem verordneten Auftrag zu entziehen und das offiziell vorgegebene Modell umzufunktionieren.

Der osteuropäische Dokumentarfilm jenseits der Dissidenz
"Ich möchte auch sagen, dass ich dem kommunistischen Regime keinen Vorwurf mache und keine Rechnung aufmache. Ich habe immer getan, was ich tun wollte." Dieses Bekenntnis des renommierten Petersburger Filmregisseurs Aleksandr Sokurov, der im Westen als Inbegriff eines Kunstdissidenten gilt, muss viele Teilnehmer des vom Stuttgarter Haus des Dokumentarfilms veranstalteten Symposions schockiert haben, war man doch zusammengekommen, um über "Die subversive Kamera" der mittel- und osteuropäischen Dokumentaristen zu diskutieren. Sokurov fügte noch eine zweite befremdliche Erklärung hinzu. Er bestritt, jemals Dokumentarfilme gedreht zu haben. "Kein Wort Wahrheit" stecke in seinem gesamten OEuvre. Als er zum Beispiel in dem Versuch "Sowjetische Elegie" in einer schier unendlich langen Einstellung zeigte, wie Boris Jelzin, damals, 1989, noch ein Hoffnungsträger der Erneuerung, am Küchentisch seiner Datscha in ein regloses Grübeln versinkt, benutzte er den künftigen Präsidenten als Folie für eine Meditation über den Weg Russlands.
Vier Jahre nach der Konferenz liegt nun endlich der Sammelband mit den überarbeiteten und ergänzten Referaten vor. Das Missverständnis zwischen dem Filmverständnis mancher westdeutscher Cineasten und der kinematografischen Realität des Ostens wird darin offenkundig. "Subversiv" bedeutet "umstürzlerisch, zerstörerisch", aber gerade das wollten die nonkonformen, oft lyrisch gestimmten Regisseure mehrheitlich nicht sein. Zwar entzogen sie sich den propagandistischen Aufgaben, zu denen sie ihre Anstellung in staatlichen Studios eigentlich verpflichtete, auf die Unterwanderung des Systems kam es ihnen indessen nicht an.
Weitab von der Moskauer Zentrale, in den baltischen Ländern oder im fernen Armenien, erst recht im zeitweise liberalen Klima Polens, Ungarns und auch der DDR (die hier ausgeklammert blieb, da dem ostdeutschen Dokumentarfilm schon eine frühere Tagung gegolten hatte), konnten die unverstellte Wirklichkeit und die Leiden des Subjekts an ihr immer wieder einmal in notgedrungen äsopische Bilder gefasst werden. Dass diese Sprache nicht zur offiziellen passte, verstand sich von selbst, denn nichts mussten die Machthaber mehr fürchten als unverfälschte Abbilder des Lebens oder, wie Abrahms Klechins aus Riga formulierte, "das Bestehen auf der eigenen Persönlichkeit". Das kommunistische Dogmensystem führte, nach den Worten des russischen Filmhistorikers Miron Tschernenko, dazu, dass "die Realität, die Wirklichkeit selbst, zum größten, strengstens bewachten Tabu . . ., dass jede mehr oder weniger wahrheitsgetreue Wirklichkeitsbeschreibung unweigerlich zu einer subversiven Aktion wurde". Doch diese Art von Subversivität hatte mit den lustvollen, oft experimentierfreudigen Tabubrüchen westlicher Autorenfilmer, wie sie jahrzehntelang auf den Oberhausener Kurzfilmtagen Triumphe feierten, kaum etwas zu tun.
Um den definitorischen Widerspruch zu überbrücken, schlug die ungarische Filmemacherin Livia Gyarmathy, deren bestechende Dokumentation "Recsk 1950 bis 1953: das ungarische Gulag" 1988 einen Generalangriff auf die untergetauchten Subversionen ihres Landes wagte, die Begriffsbildung "positive Subversionen der Kamera" vor. Hoffnungsvoll behauptete sie sogar, von der eigenen Ehrlichkeit ausgehend: "Im Dokumentarfilm kann nicht zusammenhängend gelogen werden."
Worum es dem zitierten Sokurov und worum es vor allem dem berühmten litauischen Dokumentarfilm geht, erhellte der tief gehende Vortrag der Wilnaer Filmpublizistin Zivile Pipinyte. "Der Kommunismus hinterließ ein anthropologisch falsches Welt- und Menschenbild, gegen das wir viel zu schwach kämpfen", zitierte sie den polnischen katholischen Theologen Jozef Tischner und begründete von daher, weshalb Regisseure wie Robertas Verba, Sarunas Bartas und Audrius Stonys am politischen Geschehen, seinerzeit auch an der nationalen Unabhängigkeitsbewegung vorbei auf die irrende Seele des Einzelnen schauen und in einer den Menschen einschließenden Landschaft, aber auch in fast aufgegebenen Stadtquartieren das Material für ihre Gleichnisse finden.
Dem Initiator der Veranstaltung und Herausgeber des Bandes, Hans-Joachim Schlegel, sind diese Denksysteme, die jenseits der auch dem Osten keineswegs fremden Konsumwerte die wahre Heimat des Menschen suchen, vertraut, wie seine an dieser Stelle fortgeführten Bemühungen um das Verständnis Andrej Tarkowskis beweisen. Zugleich jedoch wohnt in seiner Brust die voluntaristische Überzeugung der sowjetischen Avantgarde, dass - wie er einleitend darlegt - Dokumentarfilme nicht bloß Spiegel, sondern "Motoren grundlegend verändernder Gesellschaftsprozesse" zu sein haben. Daraus resultieren seine einschränkenden Urteile über Filme, die - wie die des jüdisch-lettischen Regisseurs Herz Frank - keineswegs "Motoren" einer ohnehin in die Sackgasse führenden Entwicklung sein wollten, und viele Warnzeichen für den neuen russischen Film. Begeistert erinnert Schlegel an Wertov und Medwedkin, muss sich jedoch von Tschernenko sagen lassen, dass beide von Stalin dann arg gezähmten Regisseure zum verbindlichen Lobpreis im sowjetischen Dokumentarfilm den Grundstein legten. Mag die "sozialistische Utopie", der sie zustrebten, in den zwanziger Jahren, wie Schlegel behauptet, tatsächlich noch nicht "staatsbürokratisch pervertiert" gewesen sein, sie wölbte sich bereits damals über den Gräbern unzähliger Opfer des vom Putsch der Bolschewiki ausgelösten Bürgerkrieges und den ersten Lagern. Womöglich sollte der Begriff "subversiv" den osteuropäischen Dokumentarfilm in ein westliches Denkschema einfügen, dem zufolge an Kunst und Kultur oder überhaupt an Lebensleistungen im Osten nur Respekt verdient, was in offener Opposition zum System stand. Womöglich wollte man sich aber auch, in einigen Beiträgen klingt es an, eines neuen Bundesgenossen im Kampf gegen das nun auch dort etablierte kapitalistische System vergewissern. Entdeckt haben Tagung und Buch indessen eine Filmkunst, die frei von ideologischen Vorzeichen nach dem Menschen fragt und aus der ihr eigenen geistigen Landschaft eine beeindruckende bildnerische Kraft schöpft.
HANS-JÖRG ROTHER
Hans-Joachim Schlegel (Hg.): "Die subversive Kamera". Zur anderen Realität in mittel- und osteuropäischen Dokumentarfilmen. UVK Medien, Konstanz 1999. 380 S., Abb., br., 54,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Eines der typischen Missverständnisse zwischen westeuropäischen Filmkritikern und osteuropäischen Filmemachern drehe sich, schreibt Hans-Jörg Rother, um den Begriff "subversiv". Er erinnert sich, wie bei einem Symposium in Stuttgart vor vier Jahren Aleksandr Sokurov die Anwesenden mit der Behauptung brüskierte, weder habe er je vom kommunistischen Regime Steine in den Weg gelegt bekommen, noch habe er so etwas wie Dokumentarfilme gedreht. Nachzulesen sind diese Äußerungen in einem Sammelband, der die Referate und Diskussionsbeiträge jener Tagung in überarbeiteter Form festhält. Rother referiert verschiedene Er- und Bekundungen osteuropäischer Filmemacher und -historiker zum "Tabuthema" Wirklichkeit, dem viele Filmemacher auf eher lyrische Weise ausgewichen sind. Ihnen kam es auf eine andere Realitätsbeschreibung, ein anderes Menschenbild an. Rother kommt dann auf die Einführung des Veranstalters Hans-Joachim Schlegel zu sprechen, der die eher "einschränkende Sichtweise" der sowjetischen Avantgarde übernommen habe: der Dokumentarfilm als Motor gesellschaftlicher Bewegung. Eine Sichtweise, der die Tagungsteilnehmer laut Rother auf höchst lebendige und vielfältige Weise widersprochen haben.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Die erste umfassende filmhistorische und kulturpolitische Publikation zur Situation des Dokumentarfilms in Ost- und Mitteleuropa." Medienwissenschaft "Eine Entdeckung." Moving Pictures "Insgesamt ein unverzichtbares Kompendium des mittel- und osteuropäischen Dokumentarfilms." Filmdienst "In einem beeindruckenden Materialreichtum und mit Liebe zum Detail werden die verschiedenen Aspekte und Arten subversiver Filmarbeit beleuchtet." Der Schnitt "Ein sorgfältig dokumentiertes Buch mit einer Fülle an Informationen und Reflexionen." epd Film