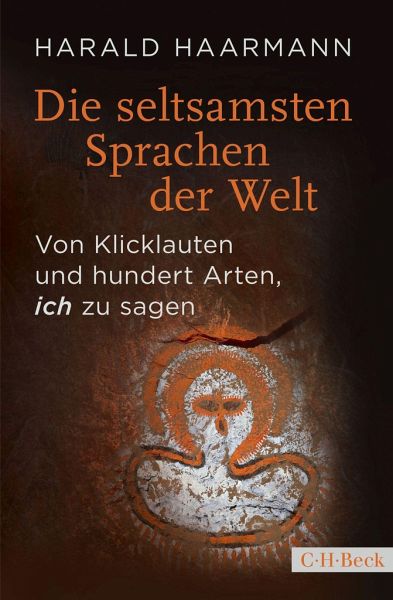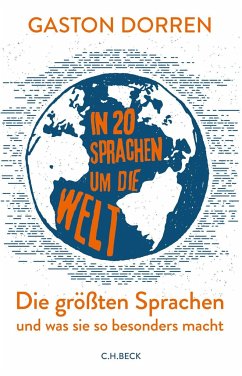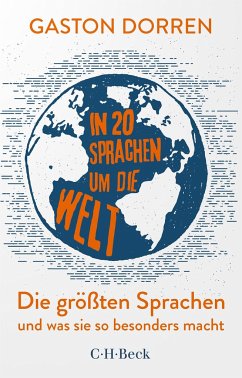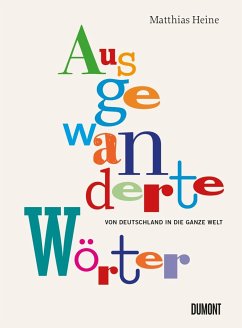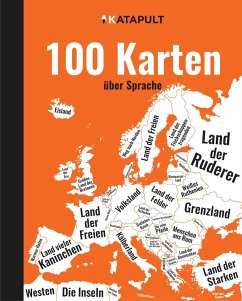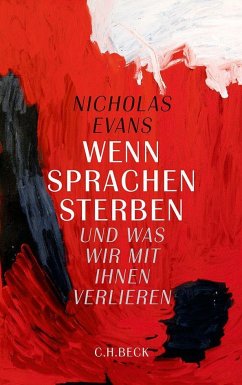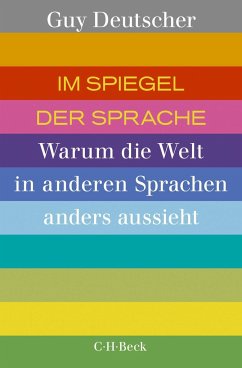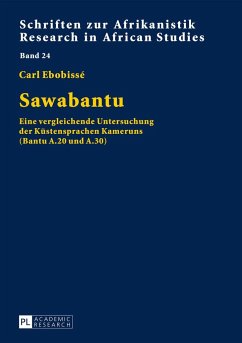Harald Haarmann
Gebundenes Buch
Die seltsamsten Sprachen der Welt
Von Klicklauten und hundert Arten, 'ich' zu sagen

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





EINE REISE ZU DEN SELTSAMSTEN SPRACHEN DER WELTViele Sprachen erscheinen uns fremdartig, weil wir ihre Schnalzlaute nicht hervorbringen oder ihren Satzbau mit den vertrauten grammatischen Rastern nicht erfassen können. Der renommierte Sprachwissenschaftler Harald Haarmann beschreibt 49 Sprachen mit seltsamen Eigenheiten und lässt uns über die Vielfalt der menschlichen Ausdrucksmöglichkeiten staunen.Von afrikanischen Klicklauten und deutschen Schachtelsätzen ? die wundersame Welt der Sprachen Was spezielle Wortschätze und sonderbare Satzkonstruktionen über ihre Sprecher verraten Für all...
EINE REISE ZU DEN SELTSAMSTEN SPRACHEN DER WELT
Viele Sprachen erscheinen uns fremdartig, weil wir ihre Schnalzlaute nicht hervorbringen oder ihren Satzbau mit den vertrauten grammatischen Rastern nicht erfassen können. Der renommierte Sprachwissenschaftler Harald Haarmann beschreibt 49 Sprachen mit seltsamen Eigenheiten und lässt uns über die Vielfalt der menschlichen Ausdrucksmöglichkeiten staunen.
Von afrikanischen Klicklauten und deutschen Schachtelsätzen ? die wundersame Welt der Sprachen
Was spezielle Wortschätze und sonderbare Satzkonstruktionen über ihre Sprecher verraten
Für alle Sprachinteressierten und Weltreisenden
Das ideale Buch zum Schmökern, Staunen und Lernen
Viele Sprachen erscheinen uns fremdartig, weil wir ihre Schnalzlaute nicht hervorbringen oder ihren Satzbau mit den vertrauten grammatischen Rastern nicht erfassen können. Der renommierte Sprachwissenschaftler Harald Haarmann beschreibt 49 Sprachen mit seltsamen Eigenheiten und lässt uns über die Vielfalt der menschlichen Ausdrucksmöglichkeiten staunen.
Von afrikanischen Klicklauten und deutschen Schachtelsätzen ? die wundersame Welt der Sprachen
Was spezielle Wortschätze und sonderbare Satzkonstruktionen über ihre Sprecher verraten
Für alle Sprachinteressierten und Weltreisenden
Das ideale Buch zum Schmökern, Staunen und Lernen
Harald Haarmann gehört zu den weltweit bekanntesten Sprachwissenschaftlern. Er wurde u.a. mit dem Prix Logos der Association européenne des linguistes, Paris, sowie dem Premio Jean Monnet ausgezeichnet. Seine Bücher wurden in viele Sprachen übersetzt.
Produktdetails
- Beck Paperback 6424
- Verlag: Beck
- 2. Aufl.
- Seitenzahl: 206
- Erscheinungstermin: 27. Januar 2021
- Deutsch
- Abmessung: 220mm x 149mm x 20mm
- Gewicht: 339g
- ISBN-13: 9783406767265
- ISBN-10: 3406767265
- Artikelnr.: 60392213
Herstellerkennzeichnung
C.H. Beck
Wilhelmstrasse 9
80801 München
produktsicherheit@beck.de
"Ein Panorama, das zeigt, wie lautliche, grammatische und semantische Eigenarten aus der Vielfalt der gesellschaftlichen Verhältnisse und kulturellen Muster hervorgehen. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Wolfgang Krischke
"Der Linguist Harald Haarmann hat ein höchst lesenswertes Buch () geschrieben.
Süddeutsche Zeitung, Burkhard Müller
"Ein Buch wie eine Weltreise.
Bayern 2, Hendrik Heinze
"Harald Haarmann versammelt in seinem neuen Buch die besten Fundstücke aus dem reichen Fundus seines Forscherlebens.
Deutschlandfunk Kultur, Sieglinde Geisel
"Man lernt immer eine Menge dazu bei der Lektüre eines Buchs von Harald Haarmann."
taz, Katharina
"Der Linguist Harald Haarmann hat ein höchst lesenswertes Buch () geschrieben.
Süddeutsche Zeitung, Burkhard Müller
"Ein Buch wie eine Weltreise.
Bayern 2, Hendrik Heinze
"Harald Haarmann versammelt in seinem neuen Buch die besten Fundstücke aus dem reichen Fundus seines Forscherlebens.
Deutschlandfunk Kultur, Sieglinde Geisel
"Man lernt immer eine Menge dazu bei der Lektüre eines Buchs von Harald Haarmann."
taz, Katharina
Mehr anzeigen
Granzin
"Kurzweilig und kenntnisreich. Bild der Wissenschaft
"Der hoch anerkannte Linguist () lädt dazu ein, die Vielfalt als Reichtum zu sehen, auch als persönliche Bereicherung, weil sie uns die Welt anders verstehen lässt. Das gelingt ihm mit seinem Buch.
Die Presse, Karl Gaulhofer
"Überraschende Fakten aus der Wunderwelt der Sprachen.
ORF.at, Sophie Menasse
"Voll mit lohnenden Erkenntnissen." Falter, Georg Renöckl
"So witzig und abstrus sich manches für uns anhört, so deutlich macht Haarmann aber auch, wie sehr Sprache immer auch die Gesellschaftsform abbildet, die Traditionen und die Gedankenwelt, die dahinter steht.
Badisches Tagblatt, Georg Patzer
Das ist so amüsant wie informativ () solch ein Buch kriegt man wahrlich nicht jeden Tag vor die Augen.
Wiener Zeitung, Edwin Baumgartner
"Kurzweilig und kenntnisreich. Bild der Wissenschaft
"Der hoch anerkannte Linguist () lädt dazu ein, die Vielfalt als Reichtum zu sehen, auch als persönliche Bereicherung, weil sie uns die Welt anders verstehen lässt. Das gelingt ihm mit seinem Buch.
Die Presse, Karl Gaulhofer
"Überraschende Fakten aus der Wunderwelt der Sprachen.
ORF.at, Sophie Menasse
"Voll mit lohnenden Erkenntnissen." Falter, Georg Renöckl
"So witzig und abstrus sich manches für uns anhört, so deutlich macht Haarmann aber auch, wie sehr Sprache immer auch die Gesellschaftsform abbildet, die Traditionen und die Gedankenwelt, die dahinter steht.
Badisches Tagblatt, Georg Patzer
Das ist so amüsant wie informativ () solch ein Buch kriegt man wahrlich nicht jeden Tag vor die Augen.
Wiener Zeitung, Edwin Baumgartner
Schließen
Ein sehr interessantes, bereicherndes Buch, das uns Lesern zeigt, wie eigenartig die Sprachen, wie fältig die Ausdrucksmöglichkeiten sind, wie die Menschen ihre Gedanken zum Ausdruck bringen können uvm. Ein sehr wohl geratener Blick über den Tellerrand, den ich jedem …
Mehr
Ein sehr interessantes, bereicherndes Buch, das uns Lesern zeigt, wie eigenartig die Sprachen, wie fältig die Ausdrucksmöglichkeiten sind, wie die Menschen ihre Gedanken zum Ausdruck bringen können uvm. Ein sehr wohl geratener Blick über den Tellerrand, den ich jedem wünsche.
Jedes Kapitel hat seinen eigenen Schwerpunkt:
1 Eigenartige Lautsysteme
2. Seltsamkeiten in Grammatik und Satzbau
3. Wortschätze
4. Seltsame Arten zu zählen
5. Status und Sozialverhalten sprachlich markieren
6. Sakral-, Ritual- und Tabu-Sprachen
7. Merkwürdige Schriften
8. Geplante Sprachen
Es gibt noch Unterkapitel, die 1-3 Seiten betragen und das Ganze noch weiter präzisieren. Für Details schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis. Das gibt einen guten Überblick über die Inhalte.
Sehr zugänglich und unterhaltsam wurde über die jeweiligen Besonderheiten erzählt. In jedem Kapitel gab es Highlights. Erstaunlich, welche Vielfalt an Nennmöglichkeiten es für Regen auf Hawaii-Inseln gibt, für Kamel auf Somali, für den Schnee bei den hoch im Norden lebenden Völkern. Die seltsame Zahlsysteme in Korea und Himalaya, die speziellen Ausdrucksmöglichkeiten für Frauen im Sumerischen, ie hundert Arten für Khmer „ich“ zu sagen, beeindrucken nicht weniger. Bei Sakral-Ritual- und Tabu-Sprachen fand ich sehr interessante Ausführungen zur Mythologie der uralischen Volker (Finno-Ugrier im östlichen europäischen Teil Russlands und Samojeden im nördlichen Sibirien).
Deutsch mit seinem seltsamen Satzbau, s. z.B. die Wortfolge in Nebensätzen, taucht hier auch auf. Englisch und Russisch (Haben vs. Sein) ebenso.
Die Ausführungen sind von s/w Abbildungen, Tabellen begleitet, die das Verständnis ungemein erleichtern.
Festeinband, gutes, helles Papier, angenehme Schriftgröße erfreuen ebenso wie die tollen Inhalte.
Ein schönes Mitbringsel oder Geschenk. Auch für sich selbst. Hier findet man allerhand Dinge, mit denen man auf Partys und ähnlichen Treffen angeben kann.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Die Rezensionen über das Buch 'Die seltsamsten Sprachen der Welt' sind allesamt positiv und. anerkennend. Leider kann ich mich diesen Meinungen nicht anschließen. Schon der Buchtitel 'Die seltsamsten Sprachen...' hat mich irritiert. Ist eine Sprache 'seltsam' , nur weil sie …
Mehr
Die Rezensionen über das Buch 'Die seltsamsten Sprachen der Welt' sind allesamt positiv und. anerkennend. Leider kann ich mich diesen Meinungen nicht anschließen. Schon der Buchtitel 'Die seltsamsten Sprachen...' hat mich irritiert. Ist eine Sprache 'seltsam' , nur weil sie indoeuropäischen Sprachgewohnheiten nicht entspricht? Das erinnert an die eurozentrische Arroganz, mit welcher Darwin einen Feuerländer als mögliches Bindeglied zwischen Tier und 'homo sapiens' eingestuft hat. Konkret, was ist an diesen Sprachen 'seltsam' und warum? Ein Verhalten mag uns seltsam erscheinen weil wir vielleicht seine Gestik nicht zu deuten wissen, oder weil es tatsächlich unanständig ist. Selbst europäische Musik ist den Zeitgenossen oft 'seltsam' erschienen, weil sie zu neu war. Der Begriff 'seltsam' birgt immer die Gefahr der Abwertung.
Anthropologen sind der Meinung, der moderne Mensch käme aus Afrika und hätte sich von dort aus über den ganzen Globus verteilt. Die gesamte Menschheit ist genetisch identisch. Was den Menschen u.a. vom Tier unterscheidet ist die Sprachfähigkeit. Stimmerzeugungsapparat (Kehlkopf, Ansatzrohr, Innervierung) und Stimmanalyseapparat( Ohr, neurale und zentrale Hörbahn ) sind bei allen Menschen anatomisch identisch. Sprache ist ein Code, welcher es ermöglicht, dass Menschen miteinander kommunizieren. Und was sich Menschen zu sagen haben ist rund um den Globus so ziemlich dasselbe. Sätze wie: 'ich mag dich', 'ich bin müde', 'ich habe Hunger' gehören überall zum Standard. Lachen und Weinen klingen bei allen Völkern identisch. Man sollte daher annehmen, dass alle Sprachen irgendwie ähnlich wären. Das ist nicht der Fall.
Dass Eskimos keine Begriffe für Giraffen, Elefanten, Krokodile, umgekehrt Bewohner des Äquators keine für Schnee, Rentiere, Eisbären haben ist logisch. Dasselbe trifft auf die Essgewohnheiten zu. Der Autor beschreibt seitenlang anekdotisch japanische Teezeremonien und Höflichkeitsrituale. Über die 'Seltsamkeiten' der japanischen Sprache erfährt man kaum etwas. Das Ketschua, eine äußerst formenreiche und differenzierte Sprache wird überhaupt nicht erwähnt.
Es folgen seitenlange Abhandlungen über Schriftsysteme. Sprache und Schrift sind völlig verschiedene Dinge. Ob eine Schrift Wort-, Silben- oder Lautschrift ist hat mit der Sprache selbst nichts zu tun.
Der Autor kann den 'Christengott' nicht leiden. Die fortschreitende Zerstörung der Umwelt wird dem 'Christengott' unterstellt: 'Macht euch die Erde untertan..' Das Zitat entstammt den hebräischen Schriften. Aber das dem 'Judengott' zu unterstellen würde dem Autor den Vorwurf des Antisemitismus einbringen! Die Zerstörung der Umwelt ist ein urmenschliches Phänomen. Die Anwohner des Mittelmeeres haben für den Schiffsbau systematisch Wälder abgeholzt was zur Erosion und Verkarstung geführt hat, lange vor der christliche Ära. Island war eine grüne Insel bis die Wikinger gekommen sind. Heute gibt es auf Island keinen Wald mehr. Die Maoris, bzw. deren Vorfahren ,welche der Autor sehr hoch einschätzt, haben die Moas ausgerottet und waren Kannibalen.
Dass den 'christlichen' Missionaren unverzeihliche Fehler unterlaufen sind steht außer Frage. Aber:
die ältesten schriftlichen Dokumente einer germanischen Sprache verdanken wir der Übersetzung des Wulfila. Die Entwicklung aller europäischen Hochsprachen verdanken wir den Bibelübersetzungen. Missionare waren es, welche sich die Mühe gemacht haben, 'Die seltsamsten Sprachen der Welt' zu lernen, zu verschriften, Wörterbücher und Grammatiken anzulegen und diese so vor dem Vergessen zu bewahren, den Eingeborenen Lesen und Schreiben beizubringen. Die Bewahrung des Guarani ist beispielhaft.
Selbstverständlich kann ein Buch nicht alle 7000 Sprachen abhandeln. Aber man kann versuchen, ein System in diese Vielfalt einzubringen. Z.B. nach der Erzeugung der Laute, der Artikulationszonen. Oder nach Morphologie, Syntax, Wortfolge, nach Deklination, Konjugation, Modus. Oder flektierend, agglutinierend, isolierend
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für