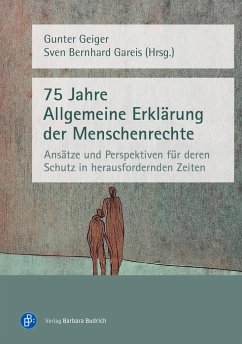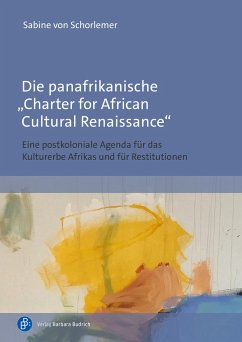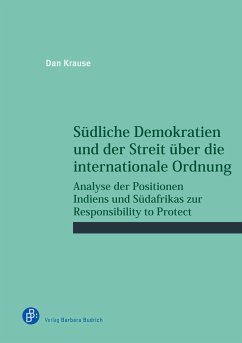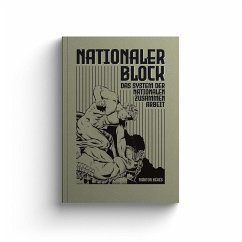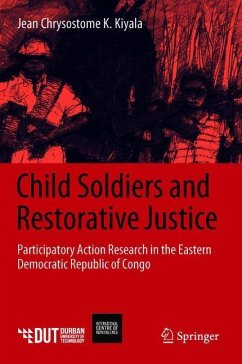Nicht lieferbar
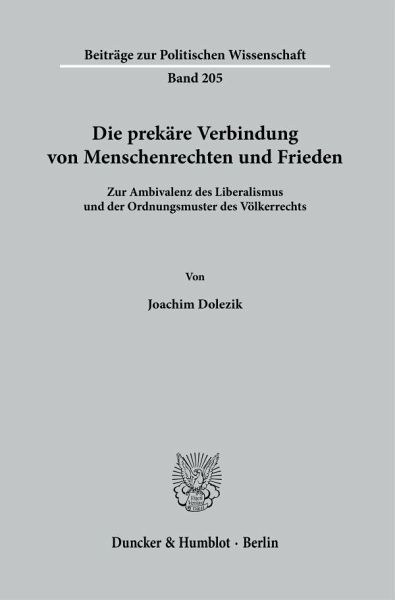
Die prekäre Verbindung von Menschenrechten und Frieden.
Zur Ambivalenz des Liberalismus und der Ordnungsmuster des Völkerrechts.
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Liberale Völkerrechtskonzeptionen hatten nach dem Fall des Eisernen Vorhangs Konjunktur. Kantisch inspirierte Erwartungen auf eine liberale internationale Friedensordnung sowie ein erreichtes »Ende der Geschichte« (Fukuyama), i.e. ein ideologischer Sieg der westlichen Werte der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit - ein Ende der ideologischen (Klassen-)Kämpfe - sind jedoch im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine bis auf Weiteres begraben worden. Auch wenn es spätestens seit dem Truppenabzug aus Afghanistan sowie im Hinblick auf den machtpolitischen Aufs...
Liberale Völkerrechtskonzeptionen hatten nach dem Fall des Eisernen Vorhangs Konjunktur. Kantisch inspirierte Erwartungen auf eine liberale internationale Friedensordnung sowie ein erreichtes »Ende der Geschichte« (Fukuyama), i.e. ein ideologischer Sieg der westlichen Werte der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit - ein Ende der ideologischen (Klassen-)Kämpfe - sind jedoch im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine bis auf Weiteres begraben worden. Auch wenn es spätestens seit dem Truppenabzug aus Afghanistan sowie im Hinblick auf den machtpolitischen Aufstieg Chinas wenig überzeugt, weiter unbeirrt von einem Siegeszug liberalen Denkens zu sprechen, so impliziert dies indes mitnichten die Schlussfolgerung, dass der Westen seinen Anspruch auf eine liberale Weltordnung aufgegeben hat (»the great battle for freedom: a battle between democracy and autocracy«). Der Forschungsansatz, inwieweit die Menschenrechte in einer ideologiekritischen Perspektive als Voraussetzung des Friedens gelten können, hat weiter an Berechtigung gewonnen. Eine zunehmend anthropozentrisch angereicherte internationale Rechtsordnung, die Eschatologie des Kantischen Friedensbegriffs sowie die Ambivalenz des Liberalismus, dessen Universalismusgedanke schon immer auch eine imperialistische Schlag- und Schattenseite sowie den Keim gewaltsamer Durchsetzung liberaler Ideen inkorporiert hat, sind hinsichtlich des prekären Verhältnisses von Menschenrechten und Frieden zur Disposition zu stellen.