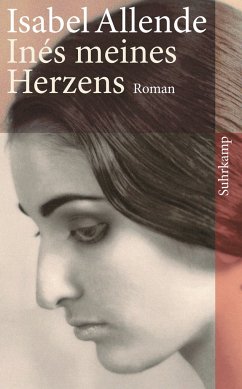ihrer groß angelegten Familienchroniken. Starke Frauenfiguren, politische Umwälzungen und hitzige Liebesgeschichten - all die erprobten Zutaten aus Allendes Erfolgsromanen sind auch hier vorhanden, doch dieses Mal gut kreolisch gewürzt. Das Haiti des ausgehenden achtzehnten Jahrhunderts hieß damals noch "Saint-Domingue" und war dank seiner Zuckerrohrplantagen die reichste unter Frankreichs Kolonien. Hier wird die neunjährige Zarité, eine mulattische Sklavin, an den französischen Plantagenbesitzer Valmorain verkauft. Sie soll als Haussklavin dessen Gattin Eugenia bedienen, die er aus Kuba auf die Insel gebracht hat. Wie eine tropische und etwas geistesschwache Effi Briest leidet Eugenia unter der Isolation und besonders unter den Spukgeschichten, die man sich auf der Plantage über die Zauberkräfte der Sklaven erzählt. Zermürbt von ihrer Angst vor deren Voodoo-Ritualen, vegetiert die lethargische Eugenia in ihrer Kammer dahin, bis sie schließlich stirbt.
Auch Valmorain selbst, der adlige "Grand Blanc", bleibt nur widerwillig auf seiner Zuckerrohrplantage. Die aus Frankreich mitgebrachten liberalen Ideen von Voltaire und Rousseau müssen pragmatischen Zwängen weichen. Die einst abgelehnte Sklaverei kostet auf Saint-Domingue jährlich Zehntausende Sklaven das Leben. Valmorain jedoch erscheint sie bald als notwendiges Übel, dessen grobe Seiten er seinem Aufseher überlässt: "Lieber sollte Cambray den Scharfrichter geben, dann konnte er den gütigen Herrn spielen, eine Rolle, die besser zu den menschenfreundlichen Vorstellungen seiner Jugendjahre passte." Frankreich, das bald darauf revolutionsgeschüttelte Mutterland, ist von Haiti aus gesehen bloß noch ein entfernter Erinnerungs- und Sehnsuchtsort, dessen Nachrichten, Moden und Befehle die Insel mit monatelanger Verzögerung erreichen.
Trotz all seiner theoretischen Menschenfreundlichkeit zwingt der frustrierte Valmorain bald die noch pubertierende Zarité in sein Bett. Diese fügt sich voll Abscheu in ihr Schicksal, ist aber schließlich durch Muttergefühle für die beiden ihr anvertrauten Kinder - Valmorains ehelichen Sohn und die eigene Tochter mit ihm - so sehr an ihren Herrn gebunden, dass sie trotz Fluchtmöglichkeiten bei ihm bleibt. Aus Sorge um die Kinder rettet sie ihm gar das Leben, als 1791 die Sklavenrevolte in einem blutigen Gewaltausbruch gelingt. Da die Plantagenbesitzer daraufhin fluchtartig die Insel verlassen müssen, flieht die aufopferungsvolle Zarité mit Valmorain und den Kindern nach New Orleans, wo ihre Odyssee in die Freiheit weiter andauert.
Um Zarités Lebensgeschichte herum malt Isabel Allende routiniert und souverän ein Tableau der haitianischen Revolution mit all ihren verwirrenden, bürgerkriegsartigen Frontverläufen. Die vierjährige Recherchearbeit, die die Autorin laut der chilenischen Tageszeitung "El Mercurio" für den Roman aufgebracht hat, macht sich bemerkbar: "Die Insel unter dem Meer" entfaltet mit großem Detailreichtum jenen Sklavenaufstand, der zur Gründung der ersten unabhängigen Republik Lateinamerikas führte.
Das komplexe soziale Gefüge der Kolonie mit seinen Hierarchien zwischen reichen Kolonialherren, den "Grands Blancs", Mulatten und schwarzen Sklaven nimmt anhand der diversen Figuren aus Zarités Umfeld Gestalt an: Da sind die schöne Kurtisane Violette, die schließlich trotz ihrer Hautfarbe und Vergangenheit einen französischen Offizier heiratet, die alte Sklavin Tante Rose, die mit Kräutern und Voodoo die schrecklichsten Tropenleiden kuriert und der weiße Arzt, der von ihr lernen will, sowie Zarités jüngerer Liebhaber Gambo, der sich den Aufständischen unter Toussaint L'Ouverture anschließt.
Doch gerade durch die ausgewogene Vollständigkeit dieses Panoramas wirkt Isabel Allendes Haiti eher wie ein gut aufgeräumtes Museumsdorf als wie lebendige Geschichte. Die in der Anlage oft interessanten Charaktere erscheinen bald als bloße Illustrationen der historischen Recherche: Jede Gesellschaftsschicht erhält einen oder zwei prototypische Vertreter, wobei die Charakterzeichnung kaum je übers Typenhafte hinausgeht. Trotz des üppigen Detailreichtums wirken die Figuren in ihren Seiden- oder Sklavenkleidern zuweilen regelrecht kostümiert, was wohl an dem gleichförmigen und heutigen Duktus liegt, in dem sie miteinander reden. Historisch einordnende Passagen durchsetzen immer wieder die Handlung, und am Ende muss eine ganze Menge Zufälle bemüht werden, um Zarités multikulturelle Patchworkfamilie noch einmal in Louisiana zusammenzuführen.
Auch die zwischengeschalteten Kapitel, die aus Zarités Perspektive erzählt sind, bieten da keinen befriedigenden Kontrapunkt. Für ihre Hauptfigur habe sie lange nach einer passenden Stimme gesucht, sagt Isabel Allende. Die, die sie schließlich fand, versucht durch Wiederholungen und eine naive Formelhaftigkeit die Sprechweise primitiven oralen Erzählens nachzuahmen: "So weiß ich es noch", "So ist es gewesen", heißt es immer wieder. Doch der Versuch schlägt fehl. Selbst wenn Zarité verzweifelt ihre afrikanische Liebesgöttin "Erzuli" anruft, bleibt ihre Sprache kontrolliert und beinahe träge.
Die afrikanischen Götter, der Voodoo und der Animismus, mit dem die Sklaven die Natur betrachten, erscheinen bei Isabel Allende nur als exotische Interpretation einer Wirklichkeit, die ebenso gut rational erschließbar wäre. Die Brille des distanzierten Historiographen setzt Isabel Allende an keiner Stelle ab: Ein magischer Realismus, der die fremde Weltsicht der Sklaven ernst nähme und poetisch nutzte, entsteht so nicht. Literarische Magie auch nicht: Die Tropen bleiben trocken.
KATHLEEN HILDEBRAND
Isabel Allende: "Die Insel unter dem Meer". Roman. Aus dem Spanischen von Svenja Becker. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2010. 557 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
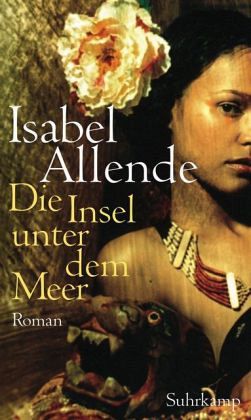






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 30.08.2010
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 30.08.2010