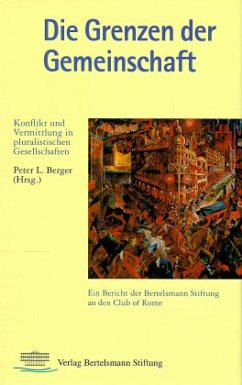Der vorliegende Bericht an den Club of Rome entstand im Rahmen der Projektarbeitder Bertelsmann Stiftung zum Thema "Geistige Orientierung". In zahlreichen innerdeutschen und international vergleichenden Studien sucht die Stiftung hier nach Wegen und Modellen, wie sozialer Zusammenhalt gefestigt und das Zusammenleben unter pluralistischen und sich schnell verändernden Bedingungen gestaltet werden kann. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie individuell sinnvolles Leben mit Verantwortungsbewußtsein für die Gemeinschaft vereinbar ist.

Gesellschaft bitte in die Sprechstunde: Peter L. Berger verschreibt der Welt eine Gesprächstherapie
Die Suche nach Regeln des Zusammenlebens erzeugt Streit. In modernen Gesellschaften werden solche normativen Konflikte permanent geführt. Modernisierung ist begleitet von der Erosion überlieferter Selbstverständlichkeiten. Je moderner eine Gesellschaft ist, desto fragiler wird ihr innerer Zusammenhalt. Sie kann die Frage nach Konzepten guten Lebens nicht im Rückgriff auf allseits anerkannte Traditionen beantworten. Auch kann sie kollektive Identität nicht durch Religion stiften, weil sich die religiösen Lebenswelten selbst pluralisiert haben. So muß eine moderne Gesellschaft ihre Identität in diskursive Verständigung immer neu zu gewinnen versuchen. Dies provoziert Dauerdebatten über die Grenzen des Pluralismus und das "ethische Minimum", ohne das ein friedliches Zusammenleben unmöglich scheint.
Seit der Implosion des kommunistischen Machtsystems haben sich normative Konflikte weltweit verschärft. Feindbilder sind verschwunden, die zur internen Kohäsion vieler Gesellschaften beigetragen hatten. Huntingtons "Kampf der Kulturen" läßt ebenso wie der Streit um Grenzen der Religionsfreiheit (etwa gegenüber Scientology) erkennen, daß klassische Strategien, Wertkonflikte zu neutralisieren, kaum noch funktionieren.
Auf die konfessionellen Bürgerkriege hatten die Aufklärer durch Privatisierung der Religion reagiert. Die öffentliche Ordnung begründeten sie auf eine allgemeine Vernunft, die Kant als strikt formal dachte. Das liberale Konzept verliert jedoch an friedensstiftender Kraft, wenn einzelne Gruppen formale Rationalität als immer schon wertgeprägt ablehnen oder die Privatisierung der Religion aus Glaubensgründen bekämpfen. Dann führt der Versuch, Legitimität allein durch legale Verfahren zu erzeugen, zur Verschärfung normativer Konflikte. Kontraproduktiv wirken auch konservative Programme, ein partikulares Ethos der Vergangenheit wieder für alle verbindlich machen zu wollen.
Die Bertelsmann-Stiftung weist dem Club of Rome einen dritten Weg zwischen liberalem laissez-faire und konservativer Umkehrstrategie. Ihre Forschungsgruppe um den Bostoner Wissenssoziologen Peter L. Berger will eine Strategie zur Eindämmung normativer Konflikte entwickeln. Die Verschiedenartigkeit konkurrierender Werthaltungen sei unhintergehbar. Im radikalen Pluralismus bedürfe es jedoch fester Vermittlungsmechanismen, damit normative Zusammenstöße nicht gewaltsam ausgetragen werden. In der Tradition Burkes und Tocquevilles setzen Berger und seine Mitautoren zunächst auf die versöhnende Kraft spontan gebildeter Vereinigungen, in denen freie Bürger sich unabhängig vom Staat und häufig auch gegen ihn vergesellschaften. In den Institutionen der Zivilgesellschaft soll jenes "kollektive Gewissen" (Durkheim) sich bilden, ohne das ein Gemeinwesen keinen Bestand hat.
Die Pointe ihres Berichts liegt aber in der bemerkenswerten Bereitschaft, den eigenen Soziologenglauben an die Vermittlungsleistungen intermediärer Institutionen zum Problem zu machen. In faszinierenden Fallstudien zu elf sehr unterschiedlichen Ländern zeigen die Autoren, daß intermediäre Institutionen Wertkonflikte häufig selbst erzeugen und bis hin zur Gewalttätigkeit verschärfen. Umgekehrt können vermeintlich abstrakte Institutionen des Staates oder der Marktwirtschaft in Wertkonflikten zwischen den Parteien ausgleichen. Wer politische Makroinstitutionen als solche für böse, weil entfremdend, hält und die Zivilgesellschaft per se für gut, verschärft nur die normativen Konflikte, die er durch zivile Vergesellschaftung aufheben will.
Auch in den vermeintlich säkularen Gesellschaften des Westens bleiben religiöse Überlieferungen das wichtigste symbolische Kapital. Die Auseinandersetzungen um die Definition gesellschaftlicher Identität sind im Kern Religionskonflikte, in denen alle Parteien jeweils ihrem Gott zum Sieg verhelfen wollen. Dafür repräsentativ ist der "amerikanische Kulturkrieg" zwischen Traditionalisten und Fortschrittsdenkern. Im Streit um Abtreibung, Todesstrafe, Schulgebet oder Schwulenehe geht es den Beteiligten um sehr viel mehr als nur den konkreten Konflikt. Alle wollen ihre individuelle "kognitive Landkarte" als einziges Muster kollektiver Weltdeutung durchsetzen.
Versuche, die religiösen Letzthorizonte abzublenden und zwischen Religiösem, Moralischem und Rechtlichem funktional zu unterscheiden, scheitern in den Vereinigten Staaten inzwischen daran, daß diese Differenz mit religiösen Gründen kritisiert wird. Selbst liberale Meisterdenker argumentieren häufig als progressive Fundamentalisten, die ihrem geschlechtsneutralen (also feminismuskompatiblen) guten Gott ergeben sind. Da der Gnadengott der Liberalen, der im Regenbogen sein Symbol gefunden hat, und der zornig strafende, strenge Vatergott der Konservativen einander ausschließen, werden durch religiöse Legitimation von Wertoptionen Konflikte nur verschärft. Beide Gruppen bedürfen aber religiöser Rechtfertigungen, um ihre besonderen Werte für allgemein erklären zu können.
Für die Wertkonflikte innerhalb einer Gesellschaft empfiehlt Berger deshalb abgestufte Vermittlungsverfahren. "Imperative Vermittlung" soll über politische und rechtliche Institutionen, insbesondere die Verfassungsgerichtsbarkeit, mit Rechtszwang durchgesetzt werden. In Akten "pragmatischer Vermittlung" suchen die Konfliktparteien selbst nach Kompromissen. Mit wachsender Verschärfung normativer Konflikte gewinnt schließlich "die dialogische Vermittlung" an Gewicht. Hier sollen Intellektuelle Formulierungsvorschläge für einen inhaltlichen Konsens sorgen. Im gelungenen Fall hätte eine Gesellschaft ihr kollektives Gedächtnis einvernehmlich neu definiert. Faktisch geschieht dies nur sehr selten.
Vermittlung in Wertkonflikten zwischen verschiedenen Gesellschaften ist noch sehr viel schwieriger als innergesellschaftliche Friedensstiftung. Wer solche Konflikte durch einen kleinen gemeinsamen Moralnenner lösen will, erzeugt eine gefährliche Illusion. Ein Weltethos dient nicht dem Frieden, sondern bedroht ihn, weil es durch abstrakte Universalisierung partikularer Normen die besonderen Identitäten einzelner Gesellschaften schwächt. Dennoch fordert Berger für internationale normative Konflikte dialogische Vermittlung. Angesichts der unaufhebbaren Verschiedenheit der Religionen könne solcher Dialog zwar kein substantielles Einverständnis über universelle Normen erzeugen. Aber im Dialog sollen die Beteiligten einsehen, daß es neben ihrer Kultur noch andere Kulturen gibt. Kulturen, die sich solcher Anerkennung legitimer Differenz aus Gründen der eigenen religiösen Tradition verweigern, nehmen Berger und seine Mitstreiter allerdings nicht in den Blick.
Die Bertelsmann-Stiftung preist ihren Bericht als strategisches Konzept zur Lösung normativer Konflikte. Doch genaugenommen sind die Autoren eher ratlos. Wenn interne Kohäsion nur über externe Abgrenzung gewonnen werden kann, droht die innergesellschaftliche Vermittlung von Wertkonflikten Spannungen zwischen den Kulturen zu verstärken. Wenig überzeugend ist zudem die abstrakte Innen-Außen-Unterscheidung. Das Fremde begegnet schon im eigenen Land. Identität durch starke externe Grenzziehungen gewinnen zu wollen, wirkt auch innerhalb der Gesellschaft polarisierend. FRIEDRICH WILHELM GRAF
Peter L. Berger (Hrsg.): "Die Grenzen der Gemeinschaft". Konflikt und Vermittlung in pluralistischen Gesellschaften. Ein Bericht der Bertelsmann Stiftung an den Club of Rome. Aus dem Englischen von Karlheinz Dürr und Ursel Schäfer. Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 1997. 656 S., geb., 58,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main