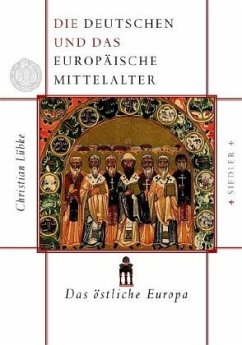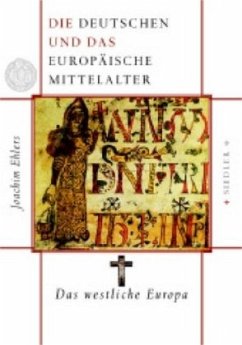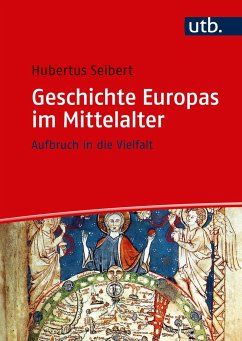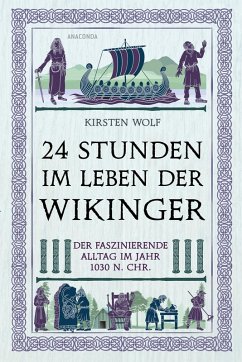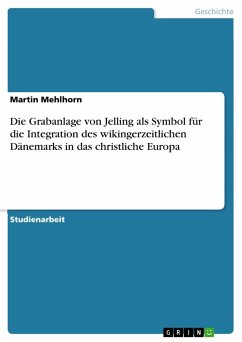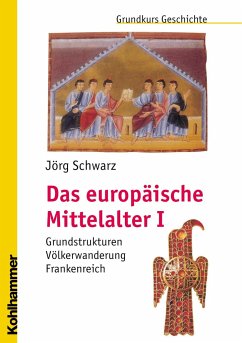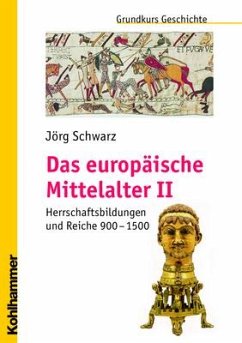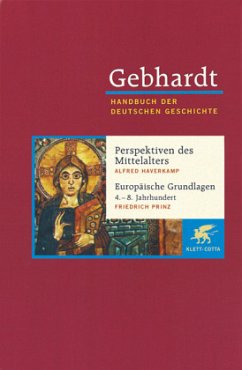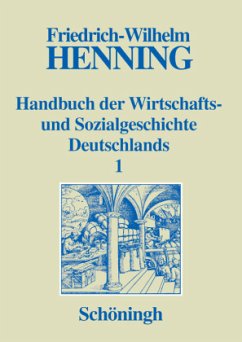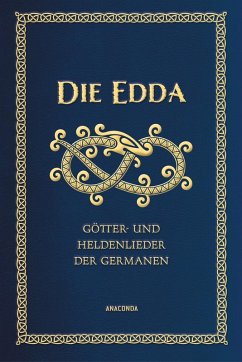Northumbriens, überfallen - "Niemals vorher hat Britannien ein so großer Schrecken heimgesucht" -, sie hatten das Blut der Priester vergossen, allen Schmuck geraubt und die Reliquien der Heiligen zertrampelt wie den Mist in der Gosse.
Nein, was Alkuin, den Gelehrten am Hof des großen Karl, bewegte, war, ob man daheim wohl verstanden hatte, was das Geschehen vom frühen Junitag 793 bedeuten sollte. Gewiß mußte er auch Trost spenden, denn "woher sollten die Kirchen Britanniens Zuversicht nehmen, wenn schon Cuthberht und so viele andere Heilige die ihre nicht zu schützen verstanden"? Aber war nicht auch Rom, von den Gräbern der Apostel und unzähliger Märtyrer umgeben, nach Verwüstung durch die Heiden mit Gottes Barmherzigkeit bald zurückgewonnen worden? Und war nicht "fast ganz Europa durch das Schwert und die Flammen der Goten und Hunnen entvölkert worden, um dann doch durch Gottes Gnade mit dem Sternenkleid der Kirchen aufzuleuchten und in der christlichen Religion neu zu erblühen"? Für Ermutigung bestand also Anlaß, aber vorher mußte das Unglück begriffen werden.
Bald darauf griffen die Seeräuber gar das Frankenreich an. Noch im Jahr seiner Kaiserkrönung zog Karl der Große von Aachen an die Küste Galliens, um eine Flotte zu bauen und Wachen aufzustellen. Indessen versagten jetzt und später Gebete und Wehren. Die "Wikinger" aus dem Norden, aus Dänemark und Norwegen, kamen immer wieder und fielen in dieses oder in jenes Land ein, mit Unterbrechungen bis zur Mitte des elften Jahrhunderts; weder die Angelsachsen noch die Franken waren zu einem entscheidenden Gegenangriff auf dem Wasser in der Lage. Die Heiden überfielen Märkte und Städte, vor allem aber Klöster, plünderten sie, erpreßten Tribute und ließen sich Rechte übertragen. In Britannien bildeten sie Reiche und auf Island das einzige Staatswesen der Zeit ohne Monarchie, in Irland gründeten sie Städte, die "Normandie" machten sie zum Ausgangspunkt neuer Herrschaften, die "England" und "Frankreich" jahrhundertelang überlagerten und die Zersplitterung Unteritaliens überwanden.
Im Osten Europas haben handeltreibende Wikinger aus Schweden mit den einheimischen Slawen die Fürstentümer der Rus gegründet und ihren Waren- und Geldaustausch mit Juden und dem Kalifat von Bagdad gepflegt. Harald "der Harte" aber, später König von Norwegen, konnte sich als kriegstüchtiger Söldner und Liebling der Frauen sogar am Kaiserhof von Konstantinopel einnisten. Selbst zur Niederlassung in Amerika (Neufundland) haben die Wikinger angesetzt, wenn sie das Unternehmen auch nach drei Jahren aufgeben mußten, aber auf Grönland konnten sie jahrhundertelang Viehzucht treiben und Karibus, Robben und vor allem Walrosse jagen. Mit ihren Segelschiffen haben sie zur See und auf Flüssen geradezu die Grenzen des mittelalterlichen Europa markiert, auch im Mittelmeer, wo sie zwar das islamische al-Andalus sowie Sizilien attackierten, aber Afrika und Kleinasien nur kurz berührten. Als Ergebnis ihrer Kulturkontakte entwickelten sich in Dänemark, Norwegen und Schweden christliche Königreiche wie sonst im Okzident, die, wo es möglich war, nur noch ins Baltikum expandierten, und im dreizehnten Jahrhundert mußten selbst die Isländer ihre Sonderrolle aufgeben.
Lediglich zu Europas Mitte, mit dem ostfränkischen Reich, das später "deutsch" genannt wurde, hatten die Wikinger recht wenige Bezüge gehabt. Überrascht nimmt man deshalb ein neues Buch zur Hand, das der "Welt der Wikinger" gewidmet ist und doch eine neue Reihe "Die Deutschen und das europäische Mittelalter" eröffnen soll. Welche Ziele der Verlag verfolgt hat, wird an den Titeln der anderen drei Bände deutlich, die "Das östliche Europa", "Das westliche Europa" und "Italien" lauten. Es soll also um die Wechselbeziehungen des mittelalterlichen Deutschland mit seinen Nachbarn in allen vier Himmelsrichtungen gehen, vielleicht sogar um Vergleiche. Die Wikinger passen in dieses Schema offenkundig nicht hinein, denn sie hatten weder mit den Deutschen zu tun, die es erst seit dem späten elften Jahrhundert gab, noch hatten sich mit deren Vorgängern, besonders Ostfranken und Sachsen, enge Kontakte ergeben wie mit Angelsachsen oder Westfranken/Franzosen. Wenn zwischen Deutschen und Skandinaviern eine längerfristige Beziehung im Mittelalter bestanden hat, dann zweifellos erst nach den Wikingerzügen; seit der Neugründung Lübecks 1159 haben die norddeutschen Kaufleute der Hanse nämlich mit ihrem Handel über Ost- und Nordsee die Nachfolge der Skandinavier angetreten und sind dabei "eine politische Macht ersten Ranges in Nordeuropa" (Philippe Dollinger) geworden.
Birgit und Peter Sawyer, die Verfasser des neuen Buches, genießen für ihr Thema hohe internationale Reputation; Peter Sawyer, der zuletzt an der Universität Leeds lehrte, hat schon vor vierzig Jahren sein Standardwerk zum Thema publiziert, und die Schwedin Birgit Sawyer, jetzt Professorin an der Universität in Trondheim, machte sich durch ihre Studien zur Geschichtsschreibung, zu Runeninschriften und zur sozialen Stellung der Frau bei den Wikingern einen Namen. Als "Wikinger" können sowohl die Seefahrer als auch die Bewohner Skandinaviens im ganzen aufgefaßt werden, die zur Zeit der Züge ins westliche Europa lebten. In diesem Sinne geht es dem Ehepaar Sawyer in seinem neuen Buch eher um eine Gesamtgeschichte Skandinaviens als um eine Geschichte der Wikingerzüge.
Die Frühmittelalterforschung des europäischen Nordens trägt schwer an ihrer Quellenlage, aber fast noch mehr am Verdikt über die reiche volkssprachliche Sagaliteratur, die seit dem zwölften Jahrhundert retrospektiv die Frühzeit Norwegens und Islands vergegenwärtigt hat. Seit kritizistische Positivisten am Beginn des vorigen Jahrhunderts diese Überlieferung pauschal verworfen hatten, sah sich die Wikingerforschung fast ausschließlich auf die Auswertung der Überreste, der Bodenfunde, Münzen, Runeninschriften, aber auch der Ortsnamen beschränkt. Nur allmählich werden jetzt die Sagas als historische Zeugnisse wiedergewonnen, so für die Geschichte des Königtums oder, im Hinblick auf Island, für die Erfindung einer neuen Gesellschaft. Der "linguistic turn" dürfte künftig weitere Perspektiven eröffnen.
Die Sawyers setzen freilich auf die Authentizität der materiellen Kultur. Sie verwerfen die Kirchengeschichte Adams von Bremen, der im elften Jahrhundert die alten Rechte der Hamburger Erzbischöfe in Skandinavien darlegen wollte. In diesem Zusammenhang sollte man allerdings den Anachronismus vermeiden, die Ansprüche Hamburg-Bremens hätten eine "deutsche Großmachtpolitik" symbolisiert, die "eine ernsthafte Bedrohung der dänischen Unabhängigkeit darstellte". Überzeugend werden die nachhaltigen Einflüsse Englands und Frankreichs auf die Länder des Nordens hervorgehoben. Tausende von Gedenksteinen mit Runeninschriften belegen nach Meinung des Ehepaars Sawyer ein frühes Stadium der Christianisierung sowie den Anspruch der Stifter auf Besitznachfolge der kommemorierten Toten; viele Folgerungen für die Verwandtschaftsstruktur, die an die lakonischen Zeugnisse geknüpft werden, wirken aber überzogen.
Neben eigenen Forschungsergebnissen haben die Verfasser bis zuletzt aktuelle Beiträge anderer in ihre Darstellung einbezogen. So konnten sie auf eine neue Deutung des "leding", des militärischen Aufgebots, durch Niels Lund verweisen. Danach hat es ein systematisches System der Küstenverteidigung in Bezirken und mit Schiffsgestellung, terminierten Dienstzeiten und Abgaben erst unter dem hochmittelalterlichen Königtum gegeben; vorher hatte das "leding" im Sinne von "expeditio" hingegen ein bewaffnetes Offensivunternehmen bezeichnen sollen.
Wirklich aufregend sind die Erkenntnisse, die Agnar Helgason unlängst am genetischen Material Skandinaviens, Islands und der Britischen Inseln gewonnen hat. Nach Untersuchungen des Y-Chromosoms, das nur von Vätern auf Söhne übertragen wird, und des mitochondrialen Chromosoms (mtDNA), das ausschließlich von Frauen weitergegeben werden kann, sollen demnach fünfundsiebzig Prozent der männlichen Vorfahren der Isländer aus Skandinavien gekommen sein, während der Anteil weiblicher Vorfahren aus diesem Raum nur bei 37,5 Prozent gelegen habe. Die meisten Frauen, die sich im neunten und zehnten Jahrhundert auf Island niederließen, stammten hingegen offenbar von Kelten auf den Britischen Inseln, besonders auf den Hebriden, ab.
Was diese Befunde für die Kritik der schriftlichen Überlieferung und für das herkömmliche Geschichtsbild bedeuten, haben die Autoren verständlicherweise nur kurz ansprechen können. Entgegen den vielfach bezeugten engen Verbindungen Islands mit Norwegen und dem weitverbreiteten Bewußtsein der Isländer, Nachkommen der Bewohner dieses Landes zu sein, wären die sonst nur schwach belegten Beziehungen zu keltischen Völkern viel höher einzuschätzen. Zu Recht haben sich die Sawyers gefragt, ob die skandinavischen Neusiedler Islands ihren Weg etwa über Irland genommen und dabei keltische Frauen mit sich geführt haben. Aber auch Quellenzeugnisse über die Hebriden erhalten nun neues Gewicht. So wird in einer Saga von einem Kalman berichtet, der von dorther stammte und auf Island in der Hvítá ertrank, als er seine Konkubine (frilla) besuchen wollte. In diesem Punkt können also neue Forschungen mit naturwissenschaftlichen Methoden dazu beitragen, die diskriminierten Sagas als historische Quellen zu rehabilitieren.
Birgit und Peter Sawyer: "Die Welt der Wikinger". Die Deutschen und das europäische Mittelalter, Band 1. Aus dem Englischen von Thomas Bertram. Siedler Verlag, Berlin 2002. 473 S., 104 Abb., geb., Subskr.-Pr. 48,-, sonst 60,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.11.2002
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.11.2002