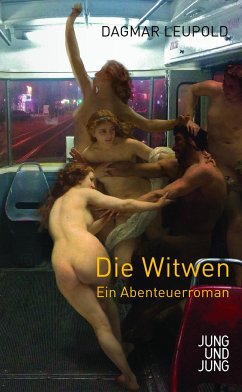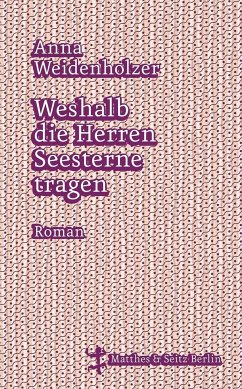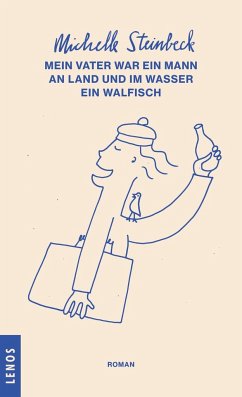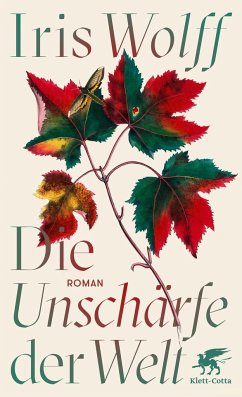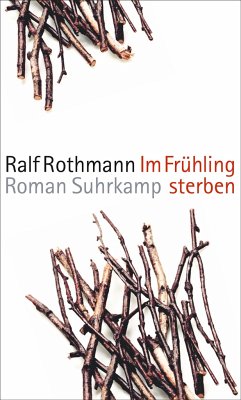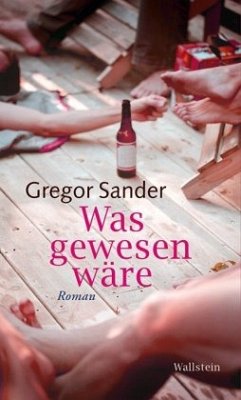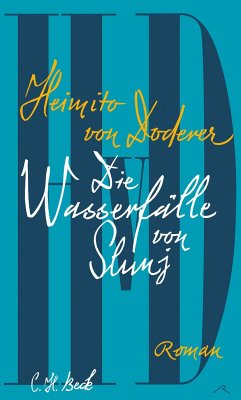selbst ist mit seinen Eltern als Vierzehnjähriger aus Ungarn geflohen.
Gerade diese Gleichzeitigkeit von Nähe und Ferne zu den heutigen Geschehnissen macht den Roman interessant. Zwar scheint er nicht darauf abzuzielen, ein Kommentar zur Gegenwart zu sein. Gleichzeitig kann man aber nicht anders, als ihn vor der Folie der Bilder zu lesen, die uns täglich erreichen.
"Der Weg der Wünsche" schildert das halb freiwillige, halb unfreiwillige Fortgehen und das erzwungene Verweilen im menschenunwürdigen Provisiorium der Flucht, in einem Zwischenraum, in anonymen Lagern, in denen noch nicht einmal die Ratten und der Schmutz das Unmenschlichste sind, sondern die Tatsache, dass es sich um verlorene Zeit handelt. Eine Zeit, in der die Tage einförmig dahinziehen, während man tatenlos herumsitzen muss und auf die innig ersehnten Visa wartet, eine Zeit, in der man keine Spuren hinterlassen haben wird, nachdem man, mit etwas Glück, doch seine Sachen aus einer jämmerlichen Baracke hat holen dürfen, um weiterzureisen. Die in den zwanziger Jahren kursierende Formel vom "Wartesaal Europa" kommt unweigerlich in den Sinn bei der Lektüre von Domas Roman. Dessen ambivalenter Titel "Der Weg der Wünsche" ist passend, denn ob die Familie jemals ans Ziel ihrer Wünsche gelangen wird, bleibt immerhin in einer gewissen Schwebe.
Was gewinnt man, was verliert man, wenn man sich für das Verlassen der Heimat entscheidet? Domas Roman ist eine melancholische Verlustbeschreibung. Auch wenn das Dachzimmer viel zu klein ist, das sich die Eltern, Teréz und Károly, mit ihren beiden Kindern teilen, dem siebenjährigen Misi und der fünfzehnjährigen Bori, oder wenn Károly eine Laufbahn als Arzt verwehrt wird, schildert Doma diese Familie doch auf fast sentimentale Weise als harmonische Gemeinschaft. Und während die Kinder naturgemäß ohnehin einverstanden und froh sind mit der Welt, in der sie leben, so mögen die Eltern zwar mit den politischen Umständen hadern, aber in einem sind sie unerschütterlich: in ihren Überzeugungen. Menschlichkeit und Moral sind die Werte, die für Doma wesentlich sind. Beinahe antiquiert mag das in heutiger Zeit anmuten, Doma entstaubt diese Vorstellungen aber auf unangestrengte Weise. Dass er dafür eine klassische, besonnene, einfühlsame Erzählweise gewählt hat, ist nur konsequent.
Dass die Familie ihre Heimat verlässt, erscheint von Beginn an als Entschluss, der vor allem auf Betreiben von Teréz erfolgt, entsprungen aus einer Mischung aus Überdruss und Demütigung, nachdem sie nicht nur zwangsversetzt worden ist, sondern ihr Vater sie vor der parteitreuen Schwester zurückweist. Vollends naiv, als würden sie zu einem Sommerurlaub aufbrechen, fährt die Familie erst zur jugoslawischen, dann zur italienischen Grenze und schafft es wider alle Wahrscheinlichkeit, dank Nachgiebigkeit einzelner Beamter durch die Kontrollen zu schlüpfen.
Aber genau in dem Moment, als das Eigentliche geschafft scheint, als die Grenzen überwunden sind, beginnt erst der Schrecken. Jetzt steht die westliche kapitalistische Welt den Eltern als etwas vor Augen, das all ihren Überzeugungen widerspricht. Allen voran den Leiter des italienischen Flüchtlingslagers, in dem die Familie lange Zeit verbringen muss, schildert Doma als eine Figur, in der die vermeintlich typisch westlichen Züge wie Rücksichtslosigkeit und Egoismus sich hinter einer polierten eloquenten Fassade verbergen.
Streiten lässt sich gewiss darüber, ob Doma es sich nicht etwas zu einfach macht mit dem pauschalen Bild, das er zeichnet, dem zufolge die Charaktere im Westen per se verkommen sind, während im Osten zwar das System ungerecht ist, die meisten Menschen sich aber ihre Integrität haben bewahren können. Wesentlich und tragisch indes mutet etwas anderes an, das Doma im Verlauf seiner immer weiter in die Vergangenheit zurückblendenden Familiengeschichte freilegt: eine fatale, nachgerade unheimlich anmutende Struktur der Wiederholung. Sowohl Teréz als auch Károly tragen die tief eingesunkenen Spuren einer früheren Vertreibung aus ihrer Heimat mit sich, über die sie erst nach und nach zu sprechen beginnen. So hat es den Anschein, als wäre es vor allem diese Vergangenheit, die zum Motor ihres Handelns in der Gegenwart wird - wider alle Vernunft und wider besseres Wissen.
Vielleicht ist es nur das Erzählen selbst, das ein Ausbrechen aus diesen Mustern und Wiederholungsschleifen ermöglicht. Insofern wäre Domas Roman, wenngleich er im Auge des Abgrunds abbricht, dennoch eine Art Erlösungserzählung.
WIEBKE POROMBKA
Akos Doma: "Der Weg der Wünsche". Roman.
Rowohlt Berlin Verlag,
Berlin 2016. 336 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
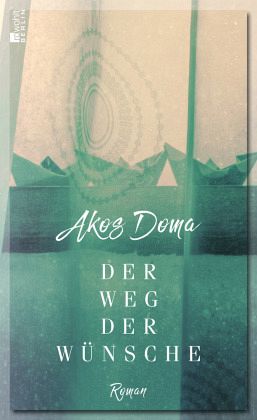





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.12.2016
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.12.2016