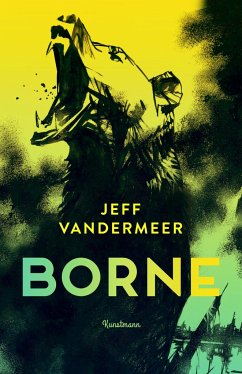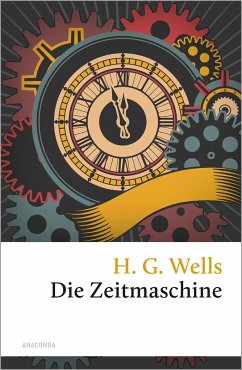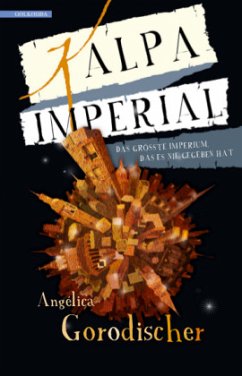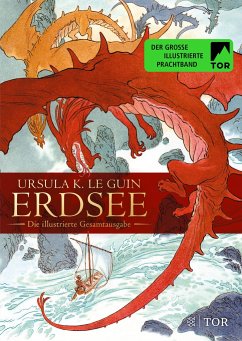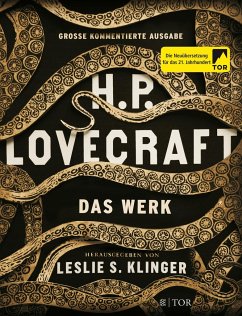verschrieben. In "Der unmögliche Roman", in dem auf knapp fünfhundert Seiten fünf Erzählungsbände Zivkovics aus den Jahren 1997 bis 2003 versammelt sind, geht er die Möglichkeiten von Erzählen und Suggestion, die Zusammenhänge von Fiktion und Wirklichkeit nach Kräften durch, biegt sie mindestens einmal in jede Richtung und verknüpft sie mit Reflexionen über das Wesen von Literatur an sich.
So führt er im Zyklus "Zeitgeschenke" in vier Variationen vor, wie auf der Textebene die Gesetze der Zeit außer Kraft gesetzt und Figuren vom Autor zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hin und her transferiert werden können. Ein Uhrmacher, dessen Leben von der Trauer über den frühen Unfalltod seiner Verlobten geprägt ist, wird in die Vergangenheit versetzt und bekommt die Chance, den Unfall zu verhindern. Auch eine Paläolinguistin darf in die Vergangenheit reisen, wo sich ihr das Geheimnis, um das all ihre Forschung zur Ursprache kreist, enthüllen soll. Glücklich werden sie beide dadurch nicht. Ebenso wenig wie ein königlicher Astronom, der, sollte er seine ketzerischen Thesen nicht widerrufen, auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden wird. Über sein Leben entscheiden darf er selbst - zuvor zeigt ihm allerdings ein Ausflug in die Zukunft, dass ihm durch den Widerruf auch der Nachruhm verwehrt bleibt. Nur zufällig befinden sich die Figuren auf einem bestimmten Ast des, wie Zivkovic es nennt, Zeitbaums, auf dessen parallel laufenden Verzweigungen gleichzeitig jeweils etwas anderes passiert. Dem Autor ist es möglich, sie beliebig von einem auf den anderen Ast zu versetzen.
Darin steckt natürlich eine gute Portion der Musilschen Idee vom Möglichkeitssinn. Dort, wo bei Musil das Aufbrechen althergebrachter Konzepte von Wirklichkeit und Ästhetik betrieben wird, ist das Ganze bei Zivkovic indes, auch wo es sich spielerisch gibt, überzogen mit reichlich Patina. Nicht nur werden dem Autor selbst - in seiner Funktion als Herr der Zeitzweige - diabolische Züge zugeschrieben. Er tritt auch immer wieder als Teufel selbst in Erscheinung. Zivkovics Erzählungen, die gern mal in Dachkammern von Geigenbauern oder kleinen Uhrmacherstübchen spielen, haftet deshalb ein Hauch von E. T. A. Hoffmanns Phantastik an, die aber gerade da, wo Zivkovic nicht nur über die Mittel der Literatur, sondern auch noch über ihre Bedeutung räsoniert, reichlich eindimensional ist.
Wenn etwa die Hölle als eine Bibliothek erscheint, in der alle Menschen zum Lesen verdammt sind. Oder wenn, im umgekehrten Fall, ein Mann immer neue Bücher in seinem Briefkasten findet, sie in seine Wohnung trägt, wo sich immer höhere Stapel bilden, bis er schließlich all seine Möbel in den Keller schaffen muss, um Platz für den nicht versiegenden Strom von Büchern zu bekommen. Das mag zwar seine schönen, traumgleichen Momente haben. Am Ende aber sagen diese Geschichten wenig über den Stellenwert von Literatur. Sie sind aber auch deshalb wenig überraschend, weil Zivkovic immer wieder nach demselben Muster verfährt und beispielsweise wiederholt die letzte Erzählung eines Zyklus zu einer Art Meta-Erzählung werden lässt, in der die Figuren der vorangehenden Erzählungen wiederauftauchen.
Womöglich gibt Zivkovic selbst die Antwort darauf, warum seine magischen Erzählungen über die Möglichkeiten der Literatur kaum mehr als kurzweilige Zerstreuung bieten. Im Zyklus "Sieben Berührungen der Musik" scheint Musik wahre Wunderdinge zu bewirken. Als ein Klavierkonzert von Chopin gespielt wird, beginnt ein autistischer Junge plötzlich Zahlen auf ein Blatt zu schreiben. So hartnäckig der Lehrer allerdings versucht, diese vermeintliche Erleuchtung seines Schülers zu wiederholen, es will ihm nicht gelingen. Offenbar hat die Kunst doch nicht eine solch lebens- und bewusstseinsverändernde Kraft, wie es für Momente den Anschein hatte. So wechselt auch der Junge nur für einen kurzen Moment auf einen anderen Ast des Zeitbaums.
WIEBKE POROMBKA
Zoran Zivkovic: "Der unmögliche Roman".
Aus dem Serbischen von Margit Jugo und Astrid Philippsen. Dumont Buchverlag, Köln 2011. 480 S., geb., 24,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
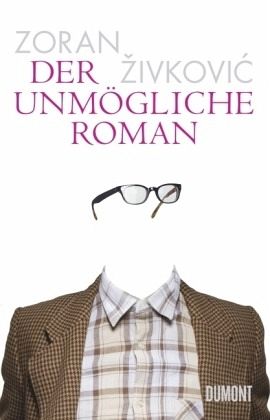



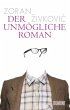

 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.03.2012
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.03.2012