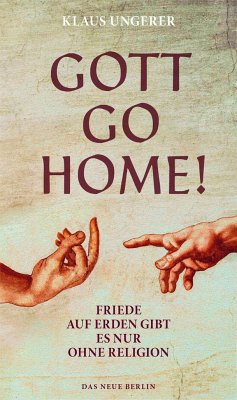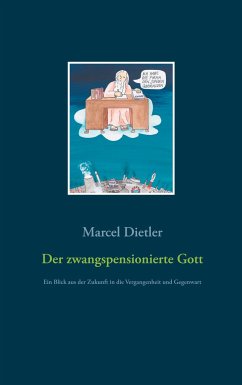Nicht lieferbar
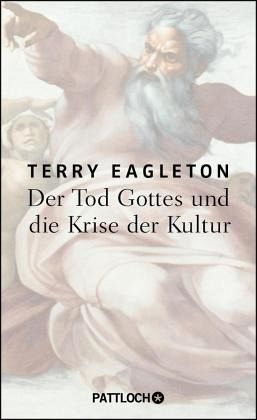
Terry Eagleton
Gebundenes Buch
Der Tod Gottes und die Krise der Kultur
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar





Terry Eagleton setzt sich mit Religion und Kultur seit der Aufklärung auseinander. Was als Siegeszug des Atheismus erscheint, ist die Ursache für die Krise der westlichen Kultur: Am 11. September 2001 stürzten auch die Hoffnungen der Atheisten in sich zusammen. Das Bedürfnis zu glauben wächst seitdem umso stärker, je deutlicher der spirituelle Bankrott der kapitalistischen Ordnung sichtbar wird. Daraus entwickelt Eagleton seine Überzeugung als Linkskatholik: Er fordert keine religiöse Wohlfühlmoral, sondern eine radikale Änderung unserer Lebensweise. Am Anfang müsste die Solidaritä...
Terry Eagleton setzt sich mit Religion und Kultur seit der Aufklärung auseinander. Was als Siegeszug des Atheismus erscheint, ist die Ursache für die Krise der westlichen Kultur: Am 11. September 2001 stürzten auch die Hoffnungen der Atheisten in sich zusammen. Das Bedürfnis zu glauben wächst seitdem umso stärker, je deutlicher der spirituelle Bankrott der kapitalistischen Ordnung sichtbar wird. Daraus entwickelt Eagleton seine Überzeugung als Linkskatholik: Er fordert keine religiöse Wohlfühlmoral, sondern eine radikale Änderung unserer Lebensweise. Am Anfang müsste die Solidarität mit den Armen und Machtlosen stehen - als Voraussetzung für ein längst überfälliges neues Verhältnis von Glaube, Kultur und Politik.
Eagleton, Terry
Terry Eagleton, geboren 1943, Professor für englische Literatur an der Universität von Lancaster , ist ein britischer Intellektueller, profilierter Vertreter der marxistischen Literaturtheorie und stimmgewaltiger Kritiker der Postmoderne. Er hat mehr als 40 Bücher veröffentlicht und wurde zunächst mit einem Fachbuch bekannt: Literaturtheorie. Eine Einführung (1983), das mittlerweile ein Standardwerk ist und mehr als 750.000 mal verkauft wurde. Eagleton besuchte als Kind eine katholische Klosterschule in Manchester. In den 1960er Jahren engagierte er sich in der linkskatholischen Gruppe Slant und verfasste eine Reihe theologischer Artikel und ein Buch zur Theologie der New-Left-Bewegung. Als Radikaler sowohl in der marxistischen als auch in der katholischen Tradition verwurzelt, steht er dennoch neueren Denkströmungen nicht ablehnend gegenüber. Sein Marxismus ist weit mehr als nur theoretisches Interesse: Er war aktives Mitglied marxistischer Organisationen und m
eldet sich immer wieder mit Einschätzungen zu politischen Ereignissen zu Wort.
Terry Eagleton, geboren 1943, Professor für englische Literatur an der Universität von Lancaster , ist ein britischer Intellektueller, profilierter Vertreter der marxistischen Literaturtheorie und stimmgewaltiger Kritiker der Postmoderne. Er hat mehr als 40 Bücher veröffentlicht und wurde zunächst mit einem Fachbuch bekannt: Literaturtheorie. Eine Einführung (1983), das mittlerweile ein Standardwerk ist und mehr als 750.000 mal verkauft wurde. Eagleton besuchte als Kind eine katholische Klosterschule in Manchester. In den 1960er Jahren engagierte er sich in der linkskatholischen Gruppe Slant und verfasste eine Reihe theologischer Artikel und ein Buch zur Theologie der New-Left-Bewegung. Als Radikaler sowohl in der marxistischen als auch in der katholischen Tradition verwurzelt, steht er dennoch neueren Denkströmungen nicht ablehnend gegenüber. Sein Marxismus ist weit mehr als nur theoretisches Interesse: Er war aktives Mitglied marxistischer Organisationen und m
eldet sich immer wieder mit Einschätzungen zu politischen Ereignissen zu Wort.
Produktdetails
- Verlag: Pattloch
- Originaltitel: Culture and the Death of God
- Artikelnr. des Verlages: 3007588
- Seitenzahl: 288
- Erscheinungstermin: 23. Oktober 2015
- Deutsch
- Abmessung: 209mm x 130mm x 23mm
- Gewicht: 408g
- ISBN-13: 9783629130761
- ISBN-10: 3629130763
- Artikelnr.: 42706633
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Thomas Assheuer weiß nicht genau, wie er diese Schrift des alten Marxisten Terry Eagleton eindordnen soll, denn die Behauptung, mit dem Fundamentalismus kehre die verdrängte Religion zurück, kennt er bisher nur aus konservativen Denkschulen. Aber doch, ja, Eagleton beklagt die "symbolische Lücke", die Aufklärung, Moderne und Postmoderne hinterlassen haben. Diese Lücke sei mal mit dem Glauben an die göttliche Nation, mit einem Sonntagschristentum oder mit staatstragenden Nützlichkeitsreligionen gefüllt worden, referiert Assheuer, doch erst das "Anything Goes" der Postmoderne habe sich als authentischer Atheismus ausgebildet und mit dem fortgeschrittenen Kapitalismus verschmolzen. Assheuer liest Eagletons Parforceritt durch die Geschichte von Aufklärung und Idealismus durchaus fasziniert und mit intellektuellem Gewinn, aber letzten Endes doch recht ungläubig, vielleicht auch ein wenig verstimmt: Für linksliberale Religionsverächter interessiere sich Eagleton, der anscheinend gläubige Marxist, nämlich überhaupt nicht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.10.2017
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.10.2017Das Konzept der Höflichkeit ist politischer Natur
Vielfalt hat einen erschreckend hohen Preis: Terry Eagleton meidet akademische Gummibegriffe, wenn er Kultur als gelingende Zivilisation beschreibt.
Von Magnus Klaue
Ein Akademiker, der ein nur zweihundert Seiten umfassendes Bändchen mit dem Titel "Kultur" auf den Markt bringt, muss entweder sehr mutig oder sehr naiv sein. Der vierundsiebzigjährige Literaturtheoretiker Terry Eagleton verkörpert die glückliche Personalunion beider Eigenschaften. Absolvent einer Klosterschule in Manchester und Schüler von Raymond Williams, dem Doyen der Kulturwissenschaften in Großbritannien, bekennt sich Eagleton ebenso selbstverständlich zu seiner Prägung durch den
Vielfalt hat einen erschreckend hohen Preis: Terry Eagleton meidet akademische Gummibegriffe, wenn er Kultur als gelingende Zivilisation beschreibt.
Von Magnus Klaue
Ein Akademiker, der ein nur zweihundert Seiten umfassendes Bändchen mit dem Titel "Kultur" auf den Markt bringt, muss entweder sehr mutig oder sehr naiv sein. Der vierundsiebzigjährige Literaturtheoretiker Terry Eagleton verkörpert die glückliche Personalunion beider Eigenschaften. Absolvent einer Klosterschule in Manchester und Schüler von Raymond Williams, dem Doyen der Kulturwissenschaften in Großbritannien, bekennt sich Eagleton ebenso selbstverständlich zu seiner Prägung durch den
Mehr anzeigen
Katholizismus, wie er sich im postkommunistischen Zeitalter als Marxist bezeichnet. Die kindliche Spontaneität, die in solchem Festhalten an historisch überholten Erfahrungen zum Ausdruck kommt, prägt auch seine theoretischen Schriften. Was deutschen Geisteswissenschaftlern in ihrem Bemühen, Popularität und akademischen Konformismus in Einklang zu bringen, regelmäßig zur Peinlichkeit missrät, gelingt Eagleton mit der scheinbaren Leichtigkeit eines Zauberkünstlers.
Schon in früheren Veröffentlichungen über "Ästhetik" (1990), "Ideologie" (1991) und "Die Illusionen der Postmoderne" (1996) hat Eagleton die Fähigkeit bewiesen, einen zugleich überblickshaft-orientierenden und polemisch-urteilenden Blick auf gängige Gummibegriffe des akademischen Betriebs zu werfen. Mit "Kultur" widmet er sich in seinem neuesten Buch dem vielleicht beliebtesten unter ihnen. Seine zentrale These, dass "Kultur" als "eine Art soziales Unbewusstes" fungiere und dass in dieser Irreduzibilität aufs Bewusstsein ebenso das bedrohliche wie das zivilisierende Potential von Kultur liege, entlehnt Eagleton bei Williams. Dabei behält er die Differenz zwischen dem angloamerikanischen Kulturbegriff, der Kultur als alltägliche gesellschaftliche Praxis versteht, und dem deutschen, der sie zum die Gesellschaft transzendierenden Wert stilisiert, im Blick. In Opposition zu "Zivilisation" bezeichne "Kultur", vor allem in der deutschen Tradition, meist vormodern konnotierte "Werte", die vom gesellschaftlichen Fortschritt zerstört zu werden drohten.
Diese Tradition, die in der Kritik der englischen Romantiker am "Industriekapitalismus" fortwirke, wird von Eagleton nicht einfach verworfen. Vielmehr sind seine Referenzautoren - Johann Gottfried Herder, Edmund Burke und T. S. Eliot - in vieler Hinsicht der romantischen Zivilisationskritik verpflichtet. Nur liest Eagleton ihre Kritik nicht nostalgisch, sondern mit historisch-materialistischem Blick. Den aus der romantischen Zivilisationskritik entstandenen "romantischen Nationalismus" lehnt er ab - im Gegensatz zum "bürgerlichen Nationalismus", der die Nation, statt sie der Kultur zu subsumieren, als Agens von Zivilisation ansehe. Zugleich aber macht Eagleton in der Kulturemphase der englischen Romantik, etwa bei Thomas Carlyle und John Ruskin, den Impuls aus, durch "Verbreitung von Freude und Vernunft" die Allianz von Triebunterdrückung und Fortschritt im Namen diesseitigen Glücks zu zerschlagen.
Damit diene der romantische Kulturbegriff zwar "ganz unverhohlen der Verhinderung des Klassenkampfes", indem er mit dem ebenfalls auf Versagung beruhenden Fortschrittsbegriff der Arbeiterbewegung im Widerspruch stehe. Zugleich erinnere er jedoch daran, dass Zivilisation nur gelingt, wenn sie sich nicht in verordneten politischen Regeln erschöpft, sondern den Individuen zum selbstverständlichen Gestus wird.
Festgehalten ist dieser Überschuss des Kulturbegriffs für Eagleton in der "Höflichkeit", die einer spezifischen historischen Konstellation entsprungen sei: "Der Impuls, der dem Konzept der Höflichkeit zugrunde lag, war politischer Natur. Das postrestaurative England war bestrebt, eine neue öffentliche Sphäre als Gegengewicht zu Kirche und Hof zu schaffen. Auf diesem Schauplatz sollten traditionelle aristokratische Tugenden (Noblesse, Umgänglichkeit, Eleganz, verfeinerte Umgangsformen) der entstehenden städtischen Mittelschicht vermittelt werden." In den Clubs, Parks, Theatern und Zeitschriften, die im England des achtzehnten Jahrhunderts zu "Austragungsorten eines aufgeklärten Mittelschichtsdiskurses" wurden, habe sich die Höflichkeit vom aristokratischen Privileg zum demokratischen Habitus emanzipiert.
Jener Habitus, der die bürgerliche Gesellschaft jenseits ihrer ökonomischen und juristischen Form auszeichne, fasse sich im Begriff der Kultur zusammen. Indem Eagleton "Kultur" als Ergebnis gelungener Zivilisation bestimmt, nimmt er dem Begriff das Pathos, das ihm vor allem in der deutschen Tradition innewohnt und das Eagleton im Ethnopluralismus der Postmoderne fortleben sieht. Als Symptom dieser Tendenz erkennt er die Neigung, "kulturelle Diversität zu preisen, ohne über ihren erschreckenden Preis zu reden". Begegnet werden könne dem Kulturalismus freilich nur im Beharren darauf, dass Kultur auch die glückliche Kehrseite der Zivilisation, Zweckfreiheit und sinnliche Erfüllung, verkörpere. Es ist die überraschendste Pointe von Eagletons Essay, dass er diesen Gehalt des Kulturbegriffs vor allem in irischstämmigen Briten wie Edmund Burke und Oscar Wilde verkörpert sieht, die in ihrem Alltag zwischen der von ihnen geliebten irischen "Kultur" und britischen "Zivilisation" zu vermitteln gezwungen waren.
Wildes zwischen Ironie und Identifikation schwankende Fähigkeit als "geschickter Imitator" hat für Eagleton größeres kritisches Potential als jede Klassenkampfrhetorik. Dass er dessen Schrift "Die Seele des Menschen unter dem Sozialismus" ein eigenes Kapitel widmet, ist insofern konsequent. Es erinnert daran, dass die radikalsten Gedanken oft am Rand der bürgerlichen Gesellschaft entstehen.
Terry Eagleton: "Kultur".
Aus dem Englischen von Hainer Kober.
Ullstein Verlag, Berlin 2017. 208 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schon in früheren Veröffentlichungen über "Ästhetik" (1990), "Ideologie" (1991) und "Die Illusionen der Postmoderne" (1996) hat Eagleton die Fähigkeit bewiesen, einen zugleich überblickshaft-orientierenden und polemisch-urteilenden Blick auf gängige Gummibegriffe des akademischen Betriebs zu werfen. Mit "Kultur" widmet er sich in seinem neuesten Buch dem vielleicht beliebtesten unter ihnen. Seine zentrale These, dass "Kultur" als "eine Art soziales Unbewusstes" fungiere und dass in dieser Irreduzibilität aufs Bewusstsein ebenso das bedrohliche wie das zivilisierende Potential von Kultur liege, entlehnt Eagleton bei Williams. Dabei behält er die Differenz zwischen dem angloamerikanischen Kulturbegriff, der Kultur als alltägliche gesellschaftliche Praxis versteht, und dem deutschen, der sie zum die Gesellschaft transzendierenden Wert stilisiert, im Blick. In Opposition zu "Zivilisation" bezeichne "Kultur", vor allem in der deutschen Tradition, meist vormodern konnotierte "Werte", die vom gesellschaftlichen Fortschritt zerstört zu werden drohten.
Diese Tradition, die in der Kritik der englischen Romantiker am "Industriekapitalismus" fortwirke, wird von Eagleton nicht einfach verworfen. Vielmehr sind seine Referenzautoren - Johann Gottfried Herder, Edmund Burke und T. S. Eliot - in vieler Hinsicht der romantischen Zivilisationskritik verpflichtet. Nur liest Eagleton ihre Kritik nicht nostalgisch, sondern mit historisch-materialistischem Blick. Den aus der romantischen Zivilisationskritik entstandenen "romantischen Nationalismus" lehnt er ab - im Gegensatz zum "bürgerlichen Nationalismus", der die Nation, statt sie der Kultur zu subsumieren, als Agens von Zivilisation ansehe. Zugleich aber macht Eagleton in der Kulturemphase der englischen Romantik, etwa bei Thomas Carlyle und John Ruskin, den Impuls aus, durch "Verbreitung von Freude und Vernunft" die Allianz von Triebunterdrückung und Fortschritt im Namen diesseitigen Glücks zu zerschlagen.
Damit diene der romantische Kulturbegriff zwar "ganz unverhohlen der Verhinderung des Klassenkampfes", indem er mit dem ebenfalls auf Versagung beruhenden Fortschrittsbegriff der Arbeiterbewegung im Widerspruch stehe. Zugleich erinnere er jedoch daran, dass Zivilisation nur gelingt, wenn sie sich nicht in verordneten politischen Regeln erschöpft, sondern den Individuen zum selbstverständlichen Gestus wird.
Festgehalten ist dieser Überschuss des Kulturbegriffs für Eagleton in der "Höflichkeit", die einer spezifischen historischen Konstellation entsprungen sei: "Der Impuls, der dem Konzept der Höflichkeit zugrunde lag, war politischer Natur. Das postrestaurative England war bestrebt, eine neue öffentliche Sphäre als Gegengewicht zu Kirche und Hof zu schaffen. Auf diesem Schauplatz sollten traditionelle aristokratische Tugenden (Noblesse, Umgänglichkeit, Eleganz, verfeinerte Umgangsformen) der entstehenden städtischen Mittelschicht vermittelt werden." In den Clubs, Parks, Theatern und Zeitschriften, die im England des achtzehnten Jahrhunderts zu "Austragungsorten eines aufgeklärten Mittelschichtsdiskurses" wurden, habe sich die Höflichkeit vom aristokratischen Privileg zum demokratischen Habitus emanzipiert.
Jener Habitus, der die bürgerliche Gesellschaft jenseits ihrer ökonomischen und juristischen Form auszeichne, fasse sich im Begriff der Kultur zusammen. Indem Eagleton "Kultur" als Ergebnis gelungener Zivilisation bestimmt, nimmt er dem Begriff das Pathos, das ihm vor allem in der deutschen Tradition innewohnt und das Eagleton im Ethnopluralismus der Postmoderne fortleben sieht. Als Symptom dieser Tendenz erkennt er die Neigung, "kulturelle Diversität zu preisen, ohne über ihren erschreckenden Preis zu reden". Begegnet werden könne dem Kulturalismus freilich nur im Beharren darauf, dass Kultur auch die glückliche Kehrseite der Zivilisation, Zweckfreiheit und sinnliche Erfüllung, verkörpere. Es ist die überraschendste Pointe von Eagletons Essay, dass er diesen Gehalt des Kulturbegriffs vor allem in irischstämmigen Briten wie Edmund Burke und Oscar Wilde verkörpert sieht, die in ihrem Alltag zwischen der von ihnen geliebten irischen "Kultur" und britischen "Zivilisation" zu vermitteln gezwungen waren.
Wildes zwischen Ironie und Identifikation schwankende Fähigkeit als "geschickter Imitator" hat für Eagleton größeres kritisches Potential als jede Klassenkampfrhetorik. Dass er dessen Schrift "Die Seele des Menschen unter dem Sozialismus" ein eigenes Kapitel widmet, ist insofern konsequent. Es erinnert daran, dass die radikalsten Gedanken oft am Rand der bürgerlichen Gesellschaft entstehen.
Terry Eagleton: "Kultur".
Aus dem Englischen von Hainer Kober.
Ullstein Verlag, Berlin 2017. 208 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
"Eagleton ist ein bemerkenswerter Stilist, vor allem die schwierige Darstellung von Aufklärung und Idealismus ist hinreißend gut geschrieben." Die Zeit 20160323
Eine anspruchsvolle Streitschrift
In dem Buch geht es „weniger um Gott als vielmehr um die Krise, die sein scheinbares Verschwinden ausgelöst hat.“ (9) Daher beginnt Eagleton seine Betrachtungen in der Zeit der Aufklärung und zeigt deren Grenzen auf. Der Autor macht …
Mehr
Eine anspruchsvolle Streitschrift
In dem Buch geht es „weniger um Gott als vielmehr um die Krise, die sein scheinbares Verschwinden ausgelöst hat.“ (9) Daher beginnt Eagleton seine Betrachtungen in der Zeit der Aufklärung und zeigt deren Grenzen auf. Der Autor macht deutlich, dass Kultur im weitesten Sinne die Lücke füllt, die Gott hinterlassen hat. Er resümiert, dass diese Lücke nicht überzeugend geschlossen wird.
„Die Aufgabe bestand nicht so sehr darin, das Höchste Wesen vom Thron zu stoßen, als vielmehr darin, eine geistig umnachtete Version des religiösen Glaubens durch eine neue Form zu ersetzen, … .“ (19) Es ging eher um die Machenschaften der Priester und weniger um das Christentum an sich. Die Kirche hat an Macht verloren. Dennoch hat die Aufklärung Grenzen aufgezeigt: „Ein rein technischer Rationalismus ist zu einer Aussage über Werte nicht in der Lage.“ (61)
Eagleton schlägt den Bogen von der Zeit der Aufklärung über den Idealismus, die Romantik, bis hin in die Neuzeit. Die Idealisten und Romantiker finden ihre Antwort in Form eines natürlichen Supernaturalismus: Der Geist ist die Grundlage der Welt, dieser hat die Realität erschaffen. Auf diese Weise gelingt es, „den Geist als einen recht exakten Ersatz für Gott zu sehen“. (66) Einige Romantiker kritisierten den Idealismus als reine Kopfgeburt, der es schwer fiel, „seine Wahrheiten in Alltagssprache zu übersetzen“. (77)
Letztlich scheitert jedes Modell am Selbstbezug. „Keine Form des Wissens kann zu sich selbst zurückkehren und die Bedingungen begreifen, die sie hervorgebracht haben.“ (81) Dennoch entwickelte sich die Kultur zu einer Ersatzform der Religion. Sie „half bei der Legitimation von Herrschaft, wurde aber auch zur Quelle des Protests gegen die Herrschenden“. (104)
„Nicht an Gott zu glauben ist wesentlich mühsamer, als man im Allgemeinen vermutet.“ (150) Eagleton ironisiert und provoziert. „Die Menschheit erträgt nicht besonders viel Realität, und das gilt nicht zuletzt für ihre untergeordneten Mitglieder.“ (152) „Man darf die Illusionen der Menschen über die Religion nicht immer angreifen.“ (167) Die Freiheit hat ihre Grenzen. „Man darf nicht so entsetzlich offen denken, dass man die politische Ordnung in Frage stellt.“ (164)
Ist Gott tot? Eagleton setzt sich mit Marx, Nietzsche, Freud und Schopenhauer auseinander, um nur Beispiele zu benennen. Ist Schopenhauers Wille („Die Welt als Wille und Vorstellung“) eine grausige Parodie des Allmächtigen? Nietzsche erkennt, dass man Gott nur dann eliminiert, wenn man den angeborenen Sinn aufgibt. Die Abschaffung von Bedeutung zerstört auch die Vorstellung von Tiefe. Letztlich sind alle Versuche gescheitert, Gott zu beseitigen.
Der Kapitalismus in seiner heutigen Form ist eine Gesellschaftsordnung ohne Glauben. Dennoch suchen sich manche Menschen im Westen Ersatzreligionen in Esoterik, Okkultismus, Scientology und Transzendentaler Meditation. Ja, ganz ohne Transzendenz geht es nicht. Und so, wie in der Physik eine Kraft eine Gegenkraft erzeugt, entwickelt sich diametral zum atheistischen ausbeuterischen Kapitalismus ein radikales islamisches System. „Der Triumphalismus dieser Lehre spiegelte die immer rücksichtslosere weltweite Politik des Westens nach dem Ende des Kalten Krieges, die letzten Endes auch die radikale islamische Gegenreaktion auslöste.“ (241) Die Ironie in dieser Betrachtung ist unverkennbar.
„Der Tod Gottes und die Krise der Kultur“ ist kein Einsteigerbuch. Eagleton referiert im Stil einer Vorlesung, streut zahlreiche Namen ein, bildet laufend Bezüge zur Literatur und Philosophie und glänzt mit Wissen, welches er nur grob in eine ansprechende Form transformiert. Neben den Hauptabschnitten fehlen gliedernde Unterabschnitte. Seine Ausführungen sind subjektiv, provozierend, ironisch und teilweise schwer nachvollziehbar. Es handelt sich eher um eine anspruchsvolle Streitschrift als um ein Fachbuch.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für