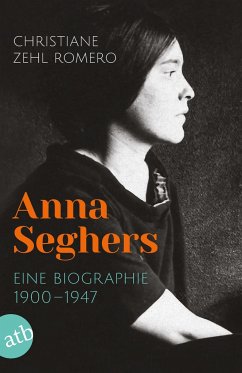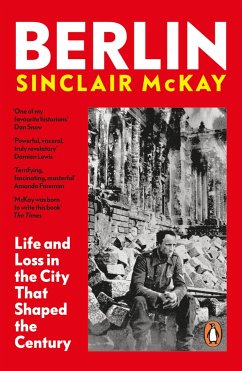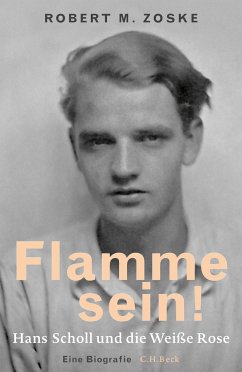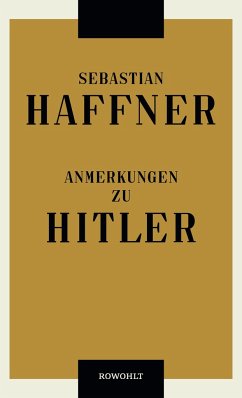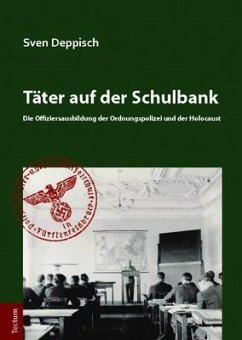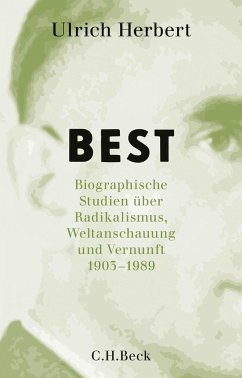Nicht lieferbar

Der Reichstagsbrand
Wiederaufnahme eines Verfahrens. Deutsche Erstausgabe
Übersetzung: Hielscher, Karin
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Benjamin Carter Hett rollt in diesem Buch einen der größten und rätselhaftesten Kriminalfälle des 20. Jahrhunderts neu auf: den Reichstagsbrand von 1933.Adolf Hitler war noch keine vier Wochen an der Macht, als am Abend des 27. Februar das Reichstagsgebäude in Berlin in Flammen aufging. Kaum war das Feuer gelöscht, erließ die Reichsregierung eine Notverordnung, die einen permanenten Ausnahmezustand schuf und die bis zum Ende des Nazi-Regimes die Grundlage zur Verfolgung politischer Gegner bleiben sollte. Somit markierte der Reichstagsbrand den eigentlichen Beginn des "Dritten Reiches". ...
Benjamin Carter Hett rollt in diesem Buch einen der größten und rätselhaftesten Kriminalfälle des 20. Jahrhunderts neu auf: den Reichstagsbrand von 1933.
Adolf Hitler war noch keine vier Wochen an der Macht, als am Abend des 27. Februar das Reichstagsgebäude in Berlin in Flammen aufging. Kaum war das Feuer gelöscht, erließ die Reichsregierung eine Notverordnung, die einen permanenten Ausnahmezustand schuf und die bis zum Ende des Nazi-Regimes die Grundlage zur Verfolgung politischer Gegner bleiben sollte. Somit markierte der Reichstagsbrand den eigentlichen Beginn des "Dritten Reiches". Noch am Tatort wurde der mutmaßliche Brandstifter verhaftet, der niederländische Kommunist Marinus van der Lubbe. Die nationalsozialistische Regierung behauptete umgehend, der junge Mann gehöre einer kommunistischen Verschwörung an. Doch handelte van der Lubbe wirklich auf eigene Faust, wie sich die meisten Historiker seit langem einig sind? Oder steckten die Nazis selbst hinter dem Anschlag, um ihn für ihre Zwecke zu instrumentalisieren?
Benjamin Carter Hetts Auswertung der Originalquellen wirft neues Licht auf diesen Fall und entlarvt nicht nur die Schwächen der Einzeltäterthese, sondern auch, welche große Deutungsmacht NS-Seilschaften in der Geschichtswissenschaft noch lange nach 1945 hatten.
Adolf Hitler war noch keine vier Wochen an der Macht, als am Abend des 27. Februar das Reichstagsgebäude in Berlin in Flammen aufging. Kaum war das Feuer gelöscht, erließ die Reichsregierung eine Notverordnung, die einen permanenten Ausnahmezustand schuf und die bis zum Ende des Nazi-Regimes die Grundlage zur Verfolgung politischer Gegner bleiben sollte. Somit markierte der Reichstagsbrand den eigentlichen Beginn des "Dritten Reiches". Noch am Tatort wurde der mutmaßliche Brandstifter verhaftet, der niederländische Kommunist Marinus van der Lubbe. Die nationalsozialistische Regierung behauptete umgehend, der junge Mann gehöre einer kommunistischen Verschwörung an. Doch handelte van der Lubbe wirklich auf eigene Faust, wie sich die meisten Historiker seit langem einig sind? Oder steckten die Nazis selbst hinter dem Anschlag, um ihn für ihre Zwecke zu instrumentalisieren?
Benjamin Carter Hetts Auswertung der Originalquellen wirft neues Licht auf diesen Fall und entlarvt nicht nur die Schwächen der Einzeltäterthese, sondern auch, welche große Deutungsmacht NS-Seilschaften in der Geschichtswissenschaft noch lange nach 1945 hatten.