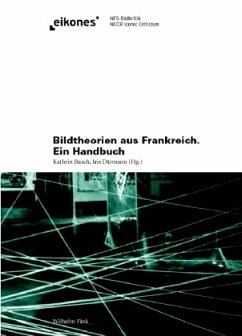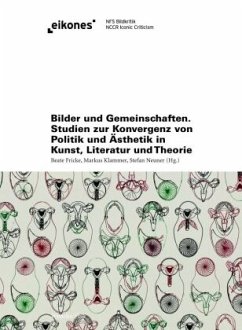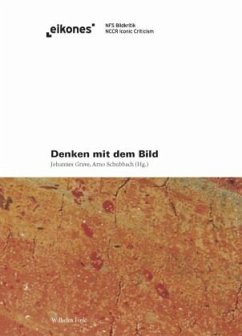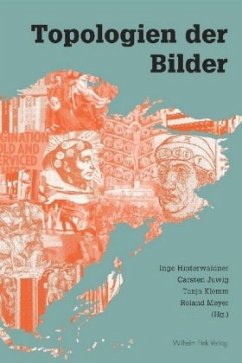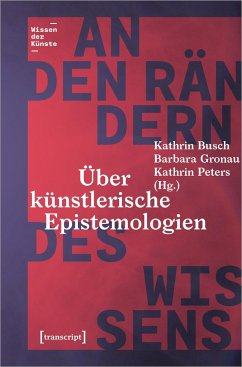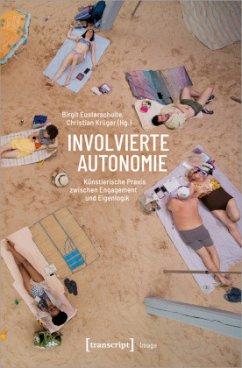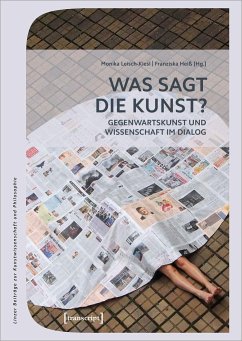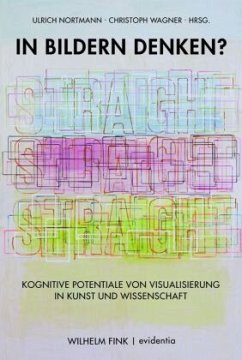Pygmalion allerdings nicht zur Ruhe, sondern entfaltete eine Wirkungsgeschichte, die über den Rosenroman, die Künstlerbiographik der Renaissance und die Kunsttheorie der Aufklärung bis in die Gegenwart anhält und auch die aktuelle Faszination für Simulakren nährt. In seinem neuesten Buch über den "Pygmalion-Effekt" unternimmt der in Fribourg lehrende Kunsthistoriker Victor I. Stoichita eine erneute Sichtung dieses vielkommentierten Mythos der Kunst. Sein Ausgangspunkt ist eine einfache, sogar naiv anmutende Frage, die sich jedoch als überaus ergiebig erweist: Wodurch wurde die Statue denn eigentlich lebendig?
Genau diese Frage mussten Dichter, Schauspieler, Tänzer, Maler und erst recht Bildhauer, die den antiken Bildhauer und seine Skulptur darstellen wollten, auf ganz konkrete Weise beantworten. Von ihnen war mehr verlangt als eine Feier des lebendigen Bildwerks. Keine geringere Herausforderung lag darin, auch den Vorgang der Verlebendigung zu beschreiben und die Gründe für sein Gelingen zu bestimmen. Die Künstler interessierten sich daher für die Verfahren und Prozesse, die ein wirksames Trugbild hervorbringen: zunächst natürlich für die Arbeit des Bildhauers, seine Werkzeuge, sein Atelier und sein Material, darüber hinaus aber auch für die Rituale des Venuskults und der Liebe, für die Prozeduren des Schmückens, Bekleidens und Posierens, für die Gesten des Berührens und Umarmens, für Küsse und Gegenküsse, für das Pulsieren des Blutes, die Phantasien des sein Werk betrachtenden Bildhauers und nicht zuletzt für den entscheidenden Schritt hinab vom Sockel, den die Statue tut, um auf dem Boden der Realität anzukommen.
Stoichita unterzieht diese verschiedenen Formen der Interaktion von Göttern, Menschen und Artefakten einer sorgfältigen Analyse und zeigt anhand von historisch weit auseinanderliegenden Beispielen, dass ein überraschend schmales Repertoire von Kunstgriffen immer wieder zum Einsatz kommt, wenn sich eine weibliche Figur unter den Augen eines männlichen Betrachters in das lebendige Bild von dessen Begehren verwandelt. Besonders Ankleiden und Schmücken, aber auch eine gemütliche Zimmertemperatur und nicht zuletzt das Betatschen galten den Pygmalionikern aller Epochen als effektive Mittel, dem kalten Material Lebenswärme zuzuführen. In den verschiedenen Neubearbeitungen, die der Pygmalionmythos zwischen Ovid und Hitchcock erfuhr, kamen allerdings auch neue Verfahren der Verlebendigung ins Spiel.
So versuchte sich im Rosenroman der Bildhauer als Sänger, um die Statue zu beleben. Die Illustratoren deuteten das Bildwerk als liegende Figur, vergleichbar einer Sepulkralplastik, womit der Künstlermythos in den symbolischen Bezugsrahmen von Tod und Auferstehung geriet. Um 1800 wurde die Belebung als Resultat eines "feinen magnetischen Fluids" begriffen, das zwischen Körper und Seele zirkuliert. Im späten 19. Jahrhundert hatte Pygmalion durch die Fotografie erneut Konjunktur. Die fotografische Dokumentation des Ateliers erlaubte, diesen von den erotischen Mysterien umwitterten Schauplatz der Kreativität als massenhaft reproduziertes Bild zu vermarkten. Niemand verstand sich darauf besser als Jean-Léon Gérôme in seinen vielfach den Pygmalionmythos aufnehmenden Atelierbildern. In Villiers de l'Isle-Adams zur selben Zeit publizierter "Eve future" wird das weibliche Simulakrum von einem unheimlichen Schwarzweiß umhüllt, das ebenfalls von der Fotografie herrührt.
Maler, Literaten, Fotografen und auch Filmemacher konnten sich die mediale Differenz zunutze machen, die ihre Kunst von jener des Pygmalion unterschied. Dagegen standen die Bildhauer vor einer ungleich größeren Herausforderung. Denn war es nicht das Ziel jeder Skulptur, eben jene Lebendigkeit zu suggerieren, die Pygmalion an der seinen verzauberte? Als Etienne-Maurice Falconet eine Statuengruppe im Pariser Salon von 1763 ausstellte, die "Pygmalion zu Füßen seiner Statue im Augenblick ihres Lebendigwerdens" (so der Titel) zeigte, musste er sich diesen Einwand gefallen lassen. Denis Diderot verteidigte das Werk dagegen enthusiastisch, indem er die nuanciert dargestellte Körperoberfläche von Statue, Bildhauer und Amor besonders hervorhob: "Aus einer einzigen Art von Gestein gehauen, hat der Bildhauer es verstanden, drei verschiedene Arten von Fleisch darzustellen." Falconets Entscheidung, Pygmalion als Betrachter zu zeigen, der nach getaner Arbeit vor seinem Werk niederkniet, bringt den Philosophen auf die Idee eines Gegenentwurfs. Im Zentrum dieser imaginären Skulpturengruppe stehen drei verschiedene Proben, die von der Erfahrung des Gegenübers zur intensivierten Selbsterfahrung führen: Pygmalion fühlt den Puls seiner Statue, sucht in den Augen nach ihrem Blick und umklammert den Meißel in seiner Rechten, so, als müsste er sich durch die Berührung dieses Gegenstandes der Wirklichkeit seiner eigenen Erfahrung versichern.
Wer, wie Ovids Pygmalion, das selbstverfertigte Püppchen heiratet, kann eine wirkliche Ehe führen und einen echten Sohn zeugen. Wer, wie Diderots Pygmalion, mit allen Sinnen von seinem Trugbild absorbiert ist, erfährt sich selbst und seine Welt auf neue Weise. Die Pygmalionik ist sicher keine Lehre vom geglückten Leben, umfasst aber eine vielfältige Topik zu dem Kunst und Leben so produktiv ineinander verflechtenden Vermögen der Selbsttäuschung. Die Geschichte der Trugbilder, die Stoichita anhand gelehrter und beobachtungsreicher Einzelinterpretationen aufspannt, liest sich auch deswegen mit großem Vergnügen, weil sie ganz unberührt ist vom überspannten Ton der Apologeten oder Apokalyptiker der Simulation. Sie erinnert uns vielmehr daran, wie geübt wir im Umgang mit Trugbildern sind.
RALPH UBL
Victor I. Stoichita: "Der Pygmalion-Effekt". Trugbilder von Ovid bis Hitchcock.
Aus dem Französischen von Ruth Herzmann. Wilhelm Fink Verlag, München 2011. 267 S., Abb., br., 39,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.11.2011
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.11.2011