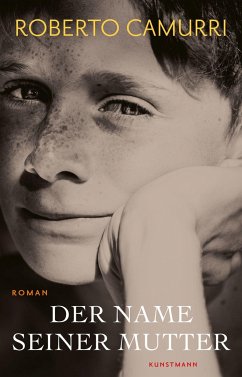Die Erinnerungen an seine Frau lassen Ettore nicht los. Sein Sohn aber kennt nicht einmal ihren Namen: Als sie ging, war Pietro noch ein Baby, und seitdem spricht niemand mehr von ihr. Eine Vater-Sohn-Geschichte von großer emotionaler Wucht und Eindringlichkeit. Pietro wächst bei seinem Vater in Fabbrico auf, einem Provinznest in der norditalienischen Tiefebene. Inmitten von Feldern, Hügeln und unfertigen Neubauten scheint die Zeit stillzustehen. Schweigend trinken die Alten in der Bar an der Piazza ihren Kaffee, spielen bedächtig ihre Karten. Auch Pietros Vater Ettore kümmert sich ohne viel Worte um ihn, zwischen den beiden liegt die Kluft einer unausgesprochenen Abwesenheit: Pietros Mutter hat Mann und Kind wenige Monate nach der Geburt verlassen. Niemand weiß, wo sie ist, niemand spricht über sie, selbst bei Livio und Ester, den liebevollen Großeltern, ist ihr Bild aus den Familienfotos verschwunden. Bleischwer lastet ihr Fehlen auf den beiden Männern und macht es dem heranwachsenden Pietro fast unmöglich, sich anderen zu öffnen, den eigenen Gefühlen zu trauen. Als Pietro die Stadt verlässt und selbst Vater wird, will er endlich wissen, was wirklich geschah. In prägnanten, wirkmächtigen Bildern erzählt Roberto Camurri von Zugehörigkeit und Selbstbestimmung. Ein ungewöhnlicher Familienroman von großer emotionaler Wucht und Eindringlichkeit.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensentin Maike Albath denkt über literarische Selbstbefragungen aus Italien nach, in denen "la mamma" eine zentrale Rolle spielt. In Roberto Camurris Roman glänzt sie durch eine "quälende" Abwesenheit, erläutert die Rezensentin. So schmal das Buch ist, so bedrängend scheint es Albath, die mit dem Erzähler und seiner Sehnsucht nach der bald nach der Geburt verschwundenen Mutter mitzufühlen scheint. Wie der Autor die Erzähler-Kindheit unter Obhut des Vaters und mit der Leerstelle der Mutter entfaltet, mit "angespannter Ruhe", in messerscharfen Bildern und mit Hang zum Ungefähren, beeindruckt Albath sichtlich. Die Verlorenheit des Erzählers macht ihr der Text nachvollziehbar.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Drei Generationen suchen eine Erklärung: Roberto Camurris Roman über das ländliche Italien
Roberto Camurri, 1982 geboren, wuchs in Fabricco auf, einem kleinen Ort in der Emilia-Romagna, der fruchtbaren, vom Apennin begrenzten Provinz in der Poebene. Fabricco ist auch der Schauplatz seines zweiten Romans, "Der Name seiner Mutter", in dem er vermutlich viel Autobiographisches verarbeitet hat. Der Inhalt des Buches in einem Satz: Drei Generationen einer traditionellen Handwerker- und Bauernfamilie leiden unter einem Trauma, verursacht durch das Verschwinden der Tochter, Ehefrau und Mutter, deren Namen niemals genannt wird.
Am meisten von dem Verlust betroffen ist Pietro, den seine Mutter als Baby in der Obhut seines Vaters Ettore und der liebevollen Großeltern zurückgelassen hat. Die Gründe für die mütterliche Flucht erfährt das Kind nicht. Dieses Nichtwissen verunsichert, aber vor allem sind es die Sprachlosigkeit der zurückgebliebenen Familie und das Fehlen aller Zeichen der Erinnerung an die geliebte Tochter und Ehefrau, die Pietro verstören. Einmal fällt in der Dorfkneipe das Wort Hure, und dass sie sehr schön gewesen sei, erzählt man sich hier. Aber Pietro wagt nicht, seinen Vater Ettore zu fragen: Warum ist er seiner schönen Frau nicht hinterhergelaufen, warum hat er sie nicht zurückgeholt?
Ettore ist die Hauptfigur von Camurris Roman. Hat er seine Frau umgebracht? Dessen verdächtigt ihn der Sohn insgeheim. Dass der seiner Mutter so ähnlich sieht, bringt den sonst so sanften Vaters manchmal auf bis zu Wutanfällen. Wenn er sich jedoch wieder beruhigt hat, überschüttet er sein Kind mit Zärtlichkeit.
Ettore bleibt wie sein Sohn ein Außenseiter in der Dorfgemeinschaft, empfindsam, wortkarg und jederzeit bereit zum Rückzug. Konfrontation oder Klärung meidet er. Diese Empfindsamkeit geht oft in Trauer über. Camurri beschreibt sie ebenso zartfühlend wie die Begegnung mit einer Bärin, die mit ihrem Jungen spielt. Sie wird im Roman zum Symbol inniger Zusammengehörigkeit von Mutter und Kind. Pietro sehnt sich danach, er hat so etwas nie kennengelernt.
Schließlich gelingt ihm der Ausbruch in die nächste Universitätsstadt. Und vielleicht wird es ihm auch gelingen, die Unsicherheit zu überwinden und seine Liebe festzuhalten. Der Schluss des Romans kommt unvermittelt, als hätte er hastig angehängt werden müssen. Immerhin erklärt er in Stichworten das Verschwinden. Und dann weiß Pietro auch endlich den Namen seiner Mutter: Anna.
Es gibt nicht viele Schriftsteller, die die archaische dörfliche Welt und den Zerfall einer Familie so genau beobachten und wiedergeben wie Camurri. Die meisterliche Übersetzung von Maja Pflug ist eine zusätzliche Garantie, dass dieses Buch etwas Besonderes ist.
MARIA FRISÉ
Roberto Camurri: "Der Name seiner Mutter". Roman.
Aus dem Italienischen von Maja Pflug. Verlag Antje Kunstmann, München 2021, 207 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

ein Albtraum
Über ein besonders auffälliges Motiv der italienischen
Literatur: die abwesende Mutter
VON MAIKE ALBATH
La mamma: Schon das Wort hat etwas Schmatzendes mit seinem doppelten „m“, außerdem kann man beim „a“ den Mund schön weit aufreißen. Und wer hat nicht sofort Sophia Loren vor Augen, wie sie mit einem Kind auf dem Arm und einem anderen am Rockzipfel im Spaghetti-Topf rührt? Oder Pier Paolo Pasolinis „Mamma Roma“ auf der Vespa mit ihrem Sohn, für den sie sich schier zerreißt? Mütter sind ein unerschöpfliches Thema der italienischen Kulturgeschichte. Die allgegenwärtige Imago der Jungfrau Maria scheint die Stilisierung der tiefen Symbiose zwischen Müttern und Söhnen noch zu verstärken.
In der Nachkriegszeit sprach der Schriftsteller Corrado Alvaro von einem zunehmenden „mammismo“ – Italien sei voller junger Männer, die von ihren Erzeugerinnen wie Prinzen behandelt werden. Der römische Psychoanalytiker Ernst Bernhard, behandelnder Arzt von Federico Fellini und etlichen Schriftstellern, prägte Ende der 1960er-Jahre den Begriff der „großen mediterranen Mutter“: Aus einem tiefen Instinkt verwöhne sie ihre Kinder übermäßig und steigere dadurch deren Bedürftigkeit. Das Ergebnis sei immer größere Abhängigkeit.
Umso erstaunlicher ist es, dass es in Italien seit jeher auch Geschichten über flüchtige Mütter gab, über Frauen, die sich genau dieser Rolle verweigerten. 1906 landete die schillernde Sibilla Aleramo mit ihrer autobiografischen Anklage „Una donna“, das als erstes Manifest einer feministischen Literatur gilt, einen Skandalerfolg: Die Autorin, eine bekannte Journalistin, schilderte hier, wie sie ihre Freiheit nur um den Preis ihres zurückgelassenen Sohnes erringt. Einige Jahrzehnte später drehte Elsa Morante, selbst in äußerst verwirrenden Familienverhältnissen aufgewachsen und kinderlos, die Perspektive um: In „Aracoeli“ (1982) beschreibt ihr Held Manuele, wie ihn seine Mutter verstieß, als er dem Kleinkindalter entwachsen war. Von dieser Zurückweisung hat er sich nie wieder erholt.
Es gibt also einen literarischen Hallraum, der in neueren Romanen zu diesem Sujet anklingt. Wie bei Morante ergreifen die betroffenen Kinder das Wort: Der 1982 in der Emilia Romagna geborene Schriftsteller Roberto Camurri kreist in „Der Name seiner Mutter“ um eine quälende Abwesenheit. Der schmale, bedrängende Roman beginnt mit der Geburt, die von der Erzählerstimme als ein Moment der Nähe zwischen dem Vater Ettore und dessen Frau imaginiert wird. Auf einmal wissen sie wieder, was sie verbindet: die Sorge um ein Kind. Doch nach kurzer Zeit stellt sich heraus, dass die junge Mutter genau dies nicht kann: den kleinen Pietro auf den Arm nehmen, ihn trösten, Tag und Nacht für ihn da sein. Ettore übernimmt diese Aufgaben, und als der Arzt einen Aufenthalt in den Bergen empfiehlt, fährt er mit dem Kind allein dorthin. Als sie zurückkommen, ist seine Frau verschwunden.
Mit angespannter Ruhe fächert die auktoriale Stimme eine Kindheit in scharf umrissenen Bildern auf und schildert die Lage von Vater und Sohn. Die Mutter ist eine Leerstelle, ein Tabu, ihr Name wird nie erwähnt. Wie ein untergründiges Magnetfeld lenkt sie dennoch alle emotionalen Kräfte. Was ist mit ihr passiert? Weder der verlassene Ehemann, der Pietro großzieht, noch die Großeltern, die den Verlust der Tochter bewältigen müssen, erzählen von ihr. Momente blitzen auf, in denen das Ausmaß der Verlorenheit deutlich wird. Auf einer Wanderung in den Bergen scheucht Ettore eine Bärenfamilie auf und beobachtet gebannt, wie Mutter und Vater ihr Junges verteidigen. Ähnlich emblematisch ist die Szene, wie Ettore und Pietro von einem Bauern einen Welpen holen, den sie von der Mutter trennen müssen. Sein Geheul liegt ihnen stundenlang in den Ohren. Als der Hund viele Jahre später stirbt, fragt Pietro seinen Vater, ob das Tier den Schock der Trennung je verwunden habe. Ohne Sentimentalität vermittelt Camurri den prekären Zustand seiner Figuren. „Der Name seiner Mutter“ wirkt wie mit Pastellfarben gemalt, ein vorsichtiger, tastender Roman, der vieles im Ungefähren lässt.
Eine stilistisch ganz anders gelagerte Selbstbefragung unternahm 2018 der sizilianische Schriftsteller Roberto Alajmo in „L’estate del ’78“, „Der Sommer ’78“. Dieses Buch gibt es nicht auf Deutsch, obwohl es perfekt in das gerade so populäre Genre der Autofiktion passen würde. Der Anfang ist besonders prägnant: Als Alajmo mit Freunden fürs Abitur lernt und hinterher ein Eis essen gehen will, findet er vor dem Haus seine längst von der Familie getrennte Mutter vor, wie sie in ihrem besten Kleid auf dem Bürgersteig sitzt. Eine Mischung aus Peinlichkeit, Schuldgefühlen und Wut auf das unkonventionelle Verhalten lässt ihn nur wenige Worte mit ihr wechseln. Dass es ihr letztes Treffen sein wird, weiß er noch nicht. Mithilfe von Fotos, Briefen und Tagebüchern unternimmt der Autor später eine Recherche, die nicht nur von der Verliebtheit eines kleinbürgerlichen sizilianischen Paares Ende der 1950er-Jahre handelt, sondern auch die Zwänge nachvollzieht, denen seine Mutter ausgesetzt war. Die Grundschullehrerin Elena Alajmo musste mit Onkel, Tante und später auch noch dem Schwiegervater in einer Wohnung leben. Es gibt ein Bild von ihr, wie sie auf ihrem Bett herumlümmelt, offenkundig ihr einziger Rückzugsort. Dem kleinen Sohn schien es deswegen normal, sie meistens dort vorzufinden.
Alajmo geht in seinem Memoir nicht chronologisch vor, sondern nähert sich der Mutter in immer neuen Anläufen. Der Augenblick auf dem Bürgersteig, in ein gleißendes Sommerlicht getaucht, kehrt mehrfach wieder, so als würde er seine Vergangenheit durch ein Fernrohr betrachten und jedes Mal neu fokussieren, bis die Konturen scharf sind. Eingebettet ist dieses Erinnerungsbild in Schilderungen von Weihnachtsritualen, Fernsehabenden, einer Reise nach Paris, der Beerdigung des Vaters und seiner eigenen, emphatischen Vaterschaft.
Es geht Alajmo aber nicht um Genealogien; vielmehr bemüht er sich um die die Rekonstruktion der Krankheitsgeschichte seiner Mutter, Anamnesen inbegriffen. Bei der Lektüre drückt es einem nach und nach die Luft ab: Erst in der Mitte des Buches stellt sich heraus, dass Elena medikamentenabhängig war und mehr Zeit in der Psychiatrie als zu Hause verbrachte. Spasmo Oberon, ein codeinhaltiges Barbiturat gegen Menstruationsbeschwerden, war bis 1986 frei verkäuflich und weitverbreitet. Bei Elena führte es zu so schweren Persönlichkeitsstörungen, dass es die Familie zerrüttete.
Ein Jahr vor Alajmos Mutterprotokoll war in Italien der Roman „Arminuta“ von Donatella Di Pietrantonio auf enorme Resonanz gestoßen. Hier muss die Ich-Erzählerin, die als Säugling zu entfernten Verwandten kam und mit dreizehn in die ihr unbekannte Herkunftsfamilie zurückkehrt, einen doppelten Verlust verkraften: den der sozialen Mutter, bei der sie aufwuchs, und den der biologischen, die sie weggeben hatte. Schon Michela Murgia hatte in „Accabadora“ (2010) von der sardischen Gepflogenheit erzählt, kinderlose Frauen mit Töchtern aus fremden Familien zu versorgen, und es fällt auf, wie viele italienische Romane der vergangenen Jahre von Elena Ferrante bis zu Wanda Marasco von Müttern erzählen, die ihre Kinder manipulieren oder verstoßen. Allen Formen moderner Elternschaft zum Trotz besitzt die Mutter-Kind-Bindung eine archaische Exklusivität mit vielen Schattierungen.
Wie traumatisch Erfahrungen dieser Art für die Mütter selbst sind, zeigen die biografischen Verwicklungen zweier Frauen, die in der Öffentlichkeit standen und ihre Kinder nicht behalten wollten oder durften: Eine war ausgerechnet die gefeierte Reformpädagogin und engagierte Feministin Maria Montessori, die schon 1896 für die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern eintrat und bahnbrechende Erziehungsmethoden entwickelte. Von allen unbemerkt, bekam sie einen Sohn, brachte ihn bei einer Pflegefamilie unter und nahm ihn erst mit vierzehn als ihren „Neffen“ bei sich auf. Wer er wirklich war, erfuhr man aus ihrem Testament. Für ein Kind, noch dazu ein uneheliches, war in einer weiblichen Karriere offenkundig kein Platz.
Das war selbst 1957 noch so. Damals bekam die neunzehnjährige Claudia Cardinale erste größere Filmrollen angeboten. Sie wurde durch eine Vergewaltigung schwanger und entschied sich, das Kind zu behalten. Aber auf Geheiß ihres Produzenten und Liebhabers Franco Cristaldi, bei dem sie fest angestellt war, musste sie ihren Sohn heimlich in London zur Welt bringen, zu ihren Eltern verfrachten und als jüngeren Bruder verleugnen. Die Sehnsucht blieb für alle unstillbar.
Vielleicht gerade weil Mutterschaft kulturell so stark aufgeladen war, kam es zu extremen Ausprägungen: verzückte Verhätschelung bis zum Pensionsalter oder Beziehungsabbruch. Scheidung wurde erst von 1970 an möglich. Und bis 1975 galt in Italien das Familiengesetz 151 aus dem Faschismus: Die Ehefrau hatte weder das Recht, ihren Wohnsitz frei zu wählen, noch durfte sie über die Erziehung der Kinder entscheiden. Dass es abgeschafft wurde, lag an der Frauenbewegung. Die Frauen hatten Sibilla Aleramo gelesen.
Jahre später umkreist das
verlassene Kind die Zwänge,
denen die Mutter ausgesetzt war
Folgen der Idealisierung:
Verhätschelung bis ins hohe Alter
oder Beziehungsabbruch
Roberto Camurri:
Der Name seiner Mutter. Roman. Aus dem
Italienischen von Maja Pflug. Kunstmann,
München 2021.
208 Seiten, 20 Euro.
Frühezeit einer Ikone der Mütterlichkeit: Sophia Loren mit Clark Gable und Carlo Marietto (als ihr Neffe Nando) im Film „Es begann in Neapel“ von 1960.
Foto: imago
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de