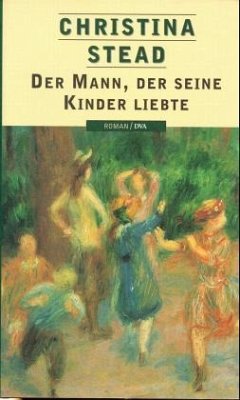Christina Stead (1902-1983) zählt zu den wichtigsten australischen Autorinnen. Der vorliegende Roman, ein Familiendrama von geradezu epischen Ausmaßen, spielt in Washington und Baltimore. Henrietta Pollit, der besseren Gesellschaft angehörend, ist nach etlichen Schwangerschaften vom Leben an der Seite eines ehrgeizigen, selbstverliebten Ehemannes bitter enttäuscht. Die fortschreitende Frustration führt schließlich zu einer offenen Auseinandersetzung.

Christina Stead erzählt vom "Mann, der seine Kinder liebte"
Große Kunst soll unerbittlich und unergründlich wie das Leben selbst sein. Von solcher Art jedenfalls ist Christina Steads Roman "The Man Who Loved Children", nur daß es lange gedauert hat, bis man das wahrnahm. Denn als das Buch zuerst 1940 erschien, hatte die Welt andere Sorgen, als sich mit dem Familienzwist im heruntergekommenen Hause des Sam Pollit an der Chesapeake Bay zu beschäftigen. Aber Familienstreit kann am Ende von dauerhafterem Interesse sein als großes Weltgeschehen. Man kennt das von der Anteilnahme am Hader zwischen ein paar griechischen Königskindern und ihren Eltern, von dem nun schon seit zweieinhalb Jahrtausenden die Theater zehren.
Wenn Steads Buch beginnt, befindet sich die Ehe zwischen Sam Pollit und Henriette geborene Collyer bereits im fortgeschrittenen Zustand des Verfalls. Was immer auf den nahezu sechshundert Seiten weiterhin geschehen wird - auf Läuterung, Versöhnung und glückliches Ende ist das nicht angelegt: "Der ganze zehnjährige Bürgerkrieg toste in ihren hitzigen Worten, wenn sie einander voller Zorn anschrien; alle Schlangen des Hasses züngelten und zischten." Denn das "Fleisch dieser Ehe" ist "voll von Krebsgeschwüren der Beleidigung, Lepraknoten der Desillusionierung, Abszessen des Grolls, Gangränen des Nimmermehr, Fieberschüben der Scheidung und all den wuchernden Leiden, schwärenden Wunden und eitrigen Schrunden." Eine kleinbürgerliche Hölle wird in diesem Romananfang ausgemessen, in der sich dann alles Weitere bis zum tödlichen Ende abspielt.
Bei solch fortgeschrittenem Zustand interessiert nicht mehr, aus welcher gegenseitigen Verkennung, aus welchen gesellschaftlichen Nötigungen oder Mißverständnissen diese Hölle entstanden ist. Kein analytisches Drama entfaltet sich, das verstehen will, sondern sprachmächtig wird die Geschichte eines Zerfalls beschrieben, der über alles Begreifen geht. In den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts spielt sich zwischen Washington und Baltimore eine antike Tragödie ab, und ein Chor von sechs Kindern umsteht die erwachsenen Protagonisten, die es fertigbringen, innerhalb dieses Krieges noch ein weiteres in die Welt zu setzen.
Es liegt auf der Hand, daß dieser Roman keine gefällige Lektüre ist; das ließe sich auch von Dostojewskis Romanen nicht sagen. Dort wie hier jedoch vollzieht sich Ungeheures unter ganz gewöhnlichen Menschen. Man weiß, daß das Böse banal sein kann, aber das Banale trägt in sich auch den Keim zum Bösen. Das erweist sich vor allem an jener einen Gestalt, die das ganze Buch beherrscht und mit der Christina Stead die Weltliteratur um einen Archetyp bereichert hat: Sam Pollit, der Weltverbesserer und "ein ganz alltäglicher, subalterner Bürokrat" bei einer Behörde in Washington. Er ist der Mann, der Kinder liebt, weil er bei ihnen am ehesten auf widerspruchslose Zustimmung rechnen und am leichtesten über sie Macht ausüben kann.
Dieser Inspektor im Amt für Fischereiwesen nennt sich einen "realistischen Träumer". Ihm schweben die "Vereinigten Staaten der Menschheit" als "ein neues Goldenes Zeitalter" vor, für das freilich zunächst "alle degenerierten Sonderlinge" ausgemerzt werden müssen, sei es durch freiwillige "Euthanasie", sei es "mit Hilfe der Todeskammer" für einzelne oder durch "Gasangriffe" auf ganze Gebiete, "sozusagen eugenische Konzentrationslager". Daß Utopie und der Wunsch zu totalitärer Machtausübung in engem Zusammenhang stehen, weiß man aus der Geschichte dieses Jahrhunderts zur Genüge. Es gehört zu den Überraschungen des Buches, daß diese finsteren Visionen zu einem Zeitpunkt niedergeschrieben wurden, als deren Umsetzung in blutige Wirklichkeit noch ins fast Undenkbare gehörte.
Dabei ist dieser Sam, dieser "Pappmessias", kein rüder Finsterling, sondern einer von denen, die sich viel auf ihren Humor zugute halten. Gern zeigt er sich als lustiger Plauderer, voller Erfindungsgabe, was das Spielen mit Namen und Worten angeht. Immer ist er geneigt, in eine selbstverkleinernde, kindertümelnde, reduktive Sprache zu verfallen und jedermann seine Spinnereien in schier unendlichen Variationen vorzutragen. Nur hat er in Wahrheit keine Ahnung, wovon er redet, wenn er Projekte entwirft, und er hat auch keine Ahnung von Kindern, Frauen oder von der Liebe. Denn bei aller scheinbaren Leichtigkeit seines Wesens besitzt dieser bekenntnissüchtige Kinderfreund und Moralist ein "schwarzes, grausames Herz", wie seine Frau ihm einmal vorwirft. Selbstverkleinerung wie Selbstmitleid sind nichts als die Medien einer sanften Grausamkeit. Kurzum: Man kennt diesen Sam Pollit und fragt sich nur immer wieder, wo man sein Ebenbild getroffen hat, in Amerika, Australien, unter den Deutschen oder ganz einfach überall.
Zwei weibliche Gestalten läßt Christina Stead ihrem Helden gegenübertreten: Henriette, seine Frau, und Louisa, die Tochter aus erster Ehe. Die eine - aus der "alten Welt" einer reichen, behüteten Kindheit stammend, "ein sanftmütiges, neurotisches Wesen", das in die Welt tritt wie ein Kind, das "in einem Harem aufgewachsen ist" - wird jung noch zur alten Frau, vom Machtrausch des Mannes, seiner Dummheit, seiner Gier entstellt und zerbrochen: "Ein schmutziger, gesprungener Teller, das bin ich." Die andere, junge entflieht und bricht "zu einem Spaziergang um die ganze Welt" auf.
Christina Stead ist Australierin, und aus dem, was sie in diesem Roman erzählt, ließe sich ein beträchtliches Stück ihrer Jugend in Sydney rekonstruieren: Personen aus ihrer Familie haben ihr Modell gestanden. Wem also Literatur am ehesten über die Biographien der Dichter zugänglich ist, mag in dieser Louisa, "schuldig und rebellisch", wie sie sich fühlt, ein Porträt der Autorin als junger Frau sehen wollen und in Sam Pollit ihren eigenen Vater. Aus Briefen David Steads, der im Fischerei-Department des Staates Neusüdwales tätig war, hat sie zum Teil wörtlich zitiert. Aber sie hat diese Spuren zu verwischen gesucht, indem sie die Handlung in die Vereinigten Staaten transportierte, dorthin also, wo sie lebte, als sie das Buch schrieb. Sie hat das mit ebenso großer Sorgfalt wie starker Gestaltungskraft getan, so daß geradezu der Eindruck entsteht, dort und nur dort, in diesem Amerika, hat sich abspielen können, was sie erzählt. Ebendiese Intensität der Darstellung aber läßt die Frage nach der biographischen Realität hinter dem Geschehen irrelevant werden. Hier wird nicht Wirklichkeit abgeschrieben, sondern im Akt des Schreibens neu geschaffen, hier wird das Häßliche im Kunstwerk auf seine Art schön.
So ist auch die Louisa des Buches nicht Porträt. Durch sie, durch ihre Lust an Poesie, an fremder und der eigenen, tritt der Roman zugleich aus der Sphäre seiner kleinbürgerlichen amerikanisch-australischen Realität hinaus und öffnet sich ins Weltliterarische. Die Lektüre von Shelleys Beatrice Cenci wird zum Protest gegen die Macht des Vaters, und mit Worten Nietzsches über die Geburt eines tanzenden Sterns aus dem Chaos oder mit einer eigenen kleinen antiken Tragödie sucht sie die flachen Visionen des Vaters zu hinterfragen.
Kaum daß die Autorin je selbst das Wort ergreift, sich in das Geschehen mit einem Kommentar mischt. Ihr Kommentar ist in den Dingen und Ereignissen selbst enthalten. "Die Art und Weise, wie ein Handtuch über der Stange hängt, sagt etwas von dem Menschen aus, der es dorthin gehängt hat", hat Stead einmal von ihrer Verfahrensweise gesagt. Solche Präzision der Beschreibungskunst tritt einem überall entgegen, und sie ist funktionell: im Kleinen spiegelt sich immer das Ganze. Vom Gesang der Vögel an einem Morgen dieses Ehekrieges heißt es: "Einige klangen wie rostige Winden, andere wie quietschende Türangeln, wieder andere wie zu schnell abgespulte Angelruten, und einer hörte sich an wie Wasser, das einen verstopften Abfluß hinuntergluckst."
Mit Präzision hat auch die erstaunliche Ökonomie des Romans bei all seiner Länge zu tun, denn der besteht über weite Strecken aus Geschwätz, von dem dennoch nichts wirklich überflüssig ist. Noch die Erwähnung von Grimms Märchen, diesen "schauerlichen Geschichten über Menschenfresserei und Morden in dunklen Wäldern", liefert einen Kommentar zur Atmosphäre im Haushalt der Pollits. Offenes bleibt. Nur Henriette wird tatsächlich Opfer werden. Die Sam Pollits dieser Welt aber gehen durch alle Krisen und allen Untergang unbetroffen in ihrer Selbstherrlichkeit hindurch.
Man hat Christina Stead eine Feministin genannt, aber sie hat dergleichen Etikettierungen stets abgelehnt, und wenn sie sich privat als Sozialistin verstand, so stand sie als Erzählerin über den Ideologien und Utopien - durch den Hintergrund des Buches geistern in scheinbarer Beiläufigkeit die Namen Lenin, Stalin und Hitler. Stead hat sich später, nach ihrer Rückkehr ins heimatliche Australien, wo sie 1983 gestorben ist, manchmal beklagt, daß man diesem einen von ihren insgesamt elf Romanen mehr Aufmerksamkeit zugewandt hat als den anderen. Eltern finden ganz sicher jedes ihrer Kinder auf seine Weise anziehend, und in der Tat hat auch die so unfeministisch-feministische Lebensgeschichte der nach eigener Lust lebenden Letty Fox, haben die "Salzburg Tales" oder die "Seven Poor Men of Sydney" Aufmerksamkeit verdient; der Roman aber über den "Mann, der seine Kinder liebte" gehört zu den Meisterwerken moderner Romankunst überhaupt.
Christina Steads Buch wird in diesen Monaten zum ersten Mal einem deutschen Lesepublikum zugänglich gemacht, und keine Anzeige des Buches sollte ohne ein ausdrückliches Lob der Übersetzerin Irmela Erckenbrecht erscheinen. Was hier an Einfühlung in fremde Diktion, an Sprach- und Sachkenntnis geleistet worden ist, geht weit über das hinaus, was wir vom Durchschnitt der Übersetzungen gewohnt sind. Keine Anglizismen scheinen durch, Sams Slang und insbesondere seine alberne Kleinkindersprache funktionieren erstaunlich gut im Deutschen, Gefühlsnuancen sind vorsichtig bewahrt worden, und regelrechte Kunststücke der Übersetzungskunst ereignen sich beim Übertragen der vielen Idiome und Redensarten. Aus "Giddy-ap, Napolyun, it looks like rain" wird "Schwing dir uffs Pferd, Napoleon, es riecht nach Rejen." Und wenn im Gespräch über die Nase von Tante Jo Sam spöttisch singt: "Nobody knows the sniffles she got", dann wird das der deutschen Bildungsnation eingängiger, wenn sie lesen kann: "Nur wer meine Nase kennt, weiß, wie ich niese." Immerhin haben wir zur Zeit Goethe-Jahr. GERHARD SCHULZ
Christina Stead: "Der Mann, der seine Kinder liebte." Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Irmela Erckenbrecht. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1998. 574 S., geb., 49,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main