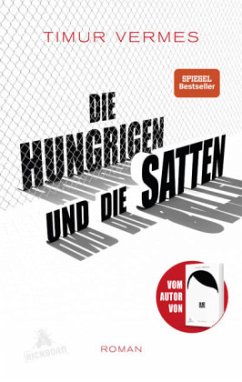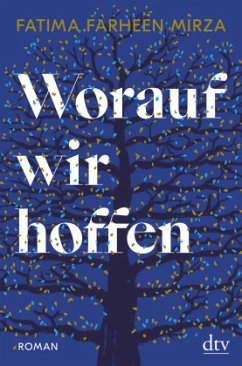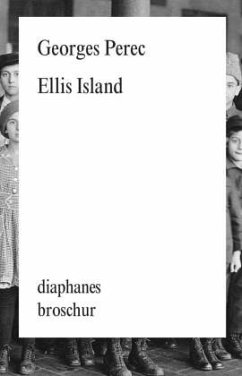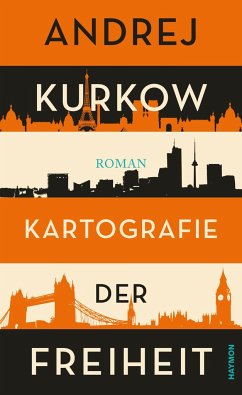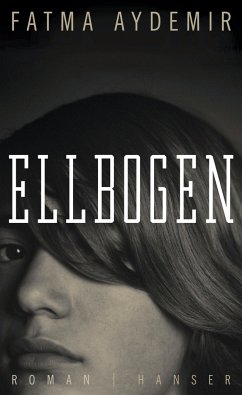der Welt entfernt, von den Wünschen und Ängsten, die sich an Politik, Kampf, Leid und Freud, vor allem aber an die Schicksale anderer Menschen knüpfen. Warum nur, fragt Jakobi, hat Muzafari das Schloss verlassen, warum ist er in die Wirklichkeit des von Revolution und Bürgerkrieg gezeichneten Landes hinabgestiegen? Mit der Antwort des Freundes kann er nichts anfangen: Eben weil es die Wirklichkeit ist, sagt Muzafari.
"Der letzte Granatapfel" erschien im kurdischen Original bereits im Jahr 2002. Es ist der erste Roman des Schriftstellers Bachtyar Ali, der ins Deutsche übersetzt worden ist, und wenn man ihn liest - befremdet, erstaunt, am Ende hingerissen - dann fragt man sich, wie es sein kann, dass der 1960 geborene Autor, der seit immerhin gut zwanzig Jahren in Deutschland lebt, erst jetzt mit einem Werk bei uns präsent ist. Ali jedenfalls erweist sich als mit allen literarischen Wassern gewaschener Schriftsteller, der uns mit jenem Muzafari Subdham zwar einen ausgesprochen lebhaften Erzähler präsentiert, anfangs aber völlig offenlässt, wo dieser Exgefangene spricht und zu wem.
Dass es sich um keinen der üblichen schriftlichen Berichte handelt, wird immerhin rasch klar, wenn Muzafari seine Zuhörer direkt anredet, wenn er auf die Wahrheit seines Berichts schwört oder sein Publikum auf den nächsten Tag vertröstet. Allmählich kommt dann heraus, dass er sich mit seinen Zuhörern auf einem Schiff befindet, das, gestartet in der griechischen Hafenstadt Patras, auf den Weg in den Westen ist, nun aber seine Richtung verloren hat und im Mittelmeer treibt. Darüber hinaus äußert sich Muzafaris mündliches Erzählen auch unmittelbar in der Stillage: Er flicht Märchenelemente ein und benutzt Symbole, schlägt manchmal einen Predigerton an oder wiederholt zentrale Wendungen, wie um sein Publikum zu fassen und nicht mehr loszulassen. Und gerade weil die mündliche Erzählerrolle dadurch so ausgestellt wird, ermöglicht es uns wiederum der Autor, jene Distanz zu Muzafari aufzubauen, die nötig ist, um seine Position als eine unter mehreren aufzufassen und auch getrost zu hinterfragen.
Denn die Geschichte ist rätselhaft genug, und dass ihr nur mäßig realistischer Anspruch eine Verbindung mit Muzafaris bilderreicher Sprache eingeht, ist unübersehbar. Er berichtet davon, wie ihn die Suche nach seinem Sohn Saryari, der bei seiner Verhaftung ein Säugling war, aus dem Schloss im Wald treibt. Sein Kopfhaar reicht ihm inzwischen bis zu den Hüften, sein Bart bis zu den Füßen, in der Gesellschaft derer aber, die mehr oder weniger versehrt die letzten Kriege überlebt haben, ist er nur ein weiterer Sonderling. Er hört die Geschichte des zartbesaiteten Mohamadi, der so sehr liebt, dass sein gläsernes Herz zersplittert und ihn verbluten lässt. Von den beiden Schwestern Spi, die einander so zugetan sind, dass sie niemals heiraten, ständig gemeinsam singen und die langen Haare ineinander wehen lassen. Und von seinem Sohn, der während Muzafaris Haft heranwuchs, die Interessen der Marktverkäufer gegen die Polizei vertrat und ermordet wurde.
Doch die Sache ist komplizierter: Es gibt noch einen zweiten Saryari Subdham, stellt sich heraus, der von klein auf kämpfte und mordete und nun in einem Gefängnis verrottet, wo ihn sein Vater nicht besuchen kann. Schließlich taucht gar ein dritter Saryari auf, der schon als ein Kind durch einen Brandanschlag auf sein Dorf fürchterlich entstellt wurde. Ihn allein kann Muzafari in die Arme schließen, ihm wird er nach England folgen, in jene Spezialklinik, in der Saryari behandelt werden soll, das, so stellt sich heraus, ist der Grund für seine Reise auf dem Boot. Ob er ankommen wird, steht in den Sternen.
Natürlich ist Bachtyar Alis Geschichte ihrem Handlungsort verhaftet, dem Kurdengebiet auf beiden Seiten der iranisch-irakischen Grenze, und ebenso einer bestimmten Zeit: den achtziger und neunziger Jahren, als sich kurdische Kämpfer gegen das Regime von Saddam Hussein erhoben, bevor - auch davon erzählt der Roman - es zu einem mörderischen innerkurdischen Krieg kam, geprägt von einer umfassenden Unübersichtlichkeit. Die zentrale Metapher dafür ist das Schachspiel, aber eines, "bei dem du nicht wirklich weißt, welche Figuren dir gehören", weil sie "vor deinen Augen die Farbe wechseln". Oder gleich alle dieselbe Farbe annehmen.
Aber Ali belässt es nicht bei einer Schilderung der Tragödie Kurdistans. So wie die Suche nach dem einen Sohn gleich drei junge Männer zutage fördert, deren Schicksale einen Teil dessen repräsentieren, wie man jene Zeit erleben konnte, als Opfer, Täter, als beides nacheinander oder beides zugleich, so verweist auch Muzafaris Bericht auf jeden Krieg überhaupt und jede Zivilbevölkerung, die darunter leidet. Genau diese Ausweitung des Fokus vom einzelnen, gesuchten Sohn zur Katastrophe eines ganzen Volkes spiegelt sich in der Entwicklung des Erzählers wider, die er auf seiner Reise durch das verwüstete Land und im Berichten davon durchläuft. Das beginnt mit der größtmöglichen Unbeteiligtheit nach den 21 Jahren in der Wüste - als er aus der Isolation freikam, konnte er buchstäblich den Sand schreien hören, er hatte für alles, was er sagen wollte, eine adäquate Sprache gefunden, nur dass die kein Mensch verstehen konnte. Am Ende des Romans aber, in der Begegnung mit all den Augenzeugen des Krieges, ist er immun für die Verlockungen der Weltabkehr, die etwa jener andere Warlord pflegt, der in idyllischer Landschaft, die Hand fest um den Weinkrug geschlossen, einen Schleier zwischen sich und die anderen legt.
Der Erzähler weist den Wein zurück und preist das "bittere Wasser der Wirklichkeit" - nur eine von sehr vielen Metaphern, die auf Bäche, Flüsse, Wellen oder sickernde Flüssigkeiten wie Blut Bezug nehmen. Immer wieder aber geht es ums Meer, in dem alles zuvor Vereinzelte zusammenkommt, und es ist kein Zufall, dass ausgerechnet der Ozean der Ort ist für Muzafaris letzte Erzählung, deren Handlung sichtlich den Bogen spannt vom isolierten Sandkorn der Wüste zum globalen Ozean. Denn alles hängt mit allem zusammen, nicht zuletzt das fortdauernde Leid derer, die den Krieg überlebt haben. Im Spital sieht Muzafari "jene Jungen, die zerfetzt und wieder zusammengeflickt worden waren. Entstellte Lebewesen, deren Teile offensichtlich falsch zusammengenäht worden waren oder gar nicht zusammengehörten. Ich hatte das Gefühl, dass der Kopf des einen auf dem Körper eines anderen steckte, das Auge des einen im Kopf des nächsten lag und die Nase von einem im Gesicht des anderen." In einer Gesellschaft, die ihren Jüngsten und Hilflosesten ein solches Schicksal bereitet, ist es auch mit der Verbindung von Vater und Sohn nicht weit her, zeigt der Roman, und es ist kein Wunder, dass die genealogische Kette unterbrochen wird: keiner der drei mutmaßlichen Söhne des Erzählers hat ein Kind gezeugt.
"Wer brachte so viel Elend über meine Söhne?", fragt Muzafari einmal. Falls es darauf überhaupt eine Antwort gibt, dann kennt sie dieser fabelhafte kurdische Roman.
TILMAN SPRECKELSEN.
Bachtyar Ali: "Der letzte Granatapfel". Roman.
Aus dem Kurdischen von Ute Cantera-Lang und Rawezh Salim. Unionsverlag, Zürich 2016, 352 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
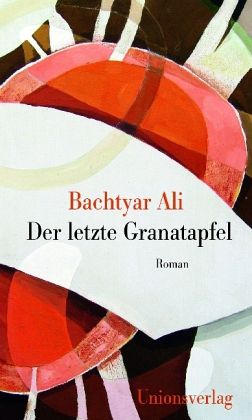





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.07.2016
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.07.2016