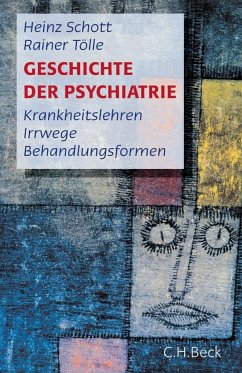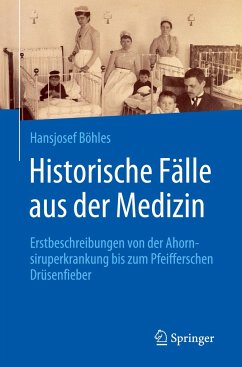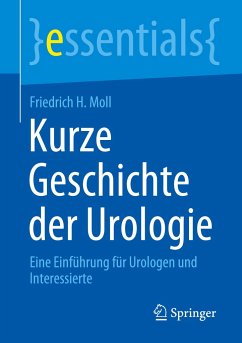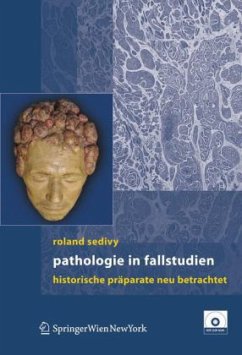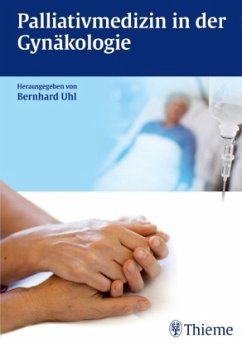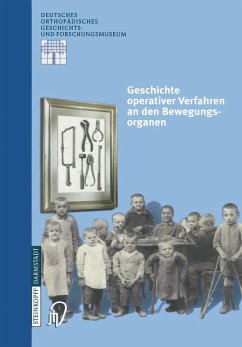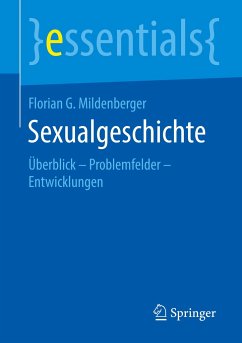Nicht lieferbar

Siddhartha Mukherjee
Gebundenes Buch
Der König aller Krankheiten
Krebs - eine Biografie
Übersetzung: Schaden, Barbara
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:





Seit über fünftausend Jahren lebt die Menschheit mit Krebs. Ebenso lange stirbt sie daran. Und doch gilt Krebs als eine »moderne« Erkrankung, weil keine andere Krankheit unsere Zeit dermaßen prägt. Bezeichnend sind die Namen, die man dem Krebs gegeben hat: »König aller Krankheiten« oder »ein Monster, unersättlicher als die Guillotine«.In seiner perfiden Perfektion, in seiner Anpassungsfähigkeit und seiner Widerstandskraft nimmt der Krebs beinahe menschliche Züge an. Seine Geschichte gleicht einer Biografie: Es ist die Geschichte von Leid, von Forscherdrang, Ideenreichtum und Beha...
Seit über fünftausend Jahren lebt die Menschheit mit Krebs. Ebenso lange stirbt sie daran. Und doch gilt Krebs als eine »moderne« Erkrankung, weil keine andere Krankheit unsere Zeit dermaßen prägt. Bezeichnend sind die Namen, die man dem Krebs gegeben hat: »König aller Krankheiten« oder »ein Monster, unersättlicher als die Guillotine«.In seiner perfiden Perfektion, in seiner Anpassungsfähigkeit und seiner Widerstandskraft nimmt der Krebs beinahe menschliche Züge an. Seine Geschichte gleicht einer Biografie: Es ist die Geschichte von Leid, von Forscherdrang, Ideenreichtum und Beharrlichkeit - aber auch von Hochmut, Arroganz und unzähligen Fehleinschätzungen.Siddhartha Mukherjee widmet sich seinem Thema mit der Präzision eines Zellbiologen, mit der Kenntnis eines Historikers und mit der Passion eines Biografen. Fesselnd erzählt er von der persischen Königin Atossa, deren griechischer Sklave sie möglicherweise von ihrem Brustkrebs geheilt hat, von Erkrankten im 19. Jahrhundert, die erste Bestrahlungen und Chemotherapien über sich ergehen lassen mussten - und immer wieder von seinen eigenen Patienten.'Der König aller Krankheiten' wirft einen faszinierenden Blick in die Zukunft der Krebsbehandlung und liefert eine brillante neue Perspektive auf die Art, wie Ärzte, Wissenschaftler, Philosophen und Laien den kranken - und den gesunden - Körper während Jahrtausenden begriffen haben.
Mukherjee, SiddharthaSiddhartha Mukherjee ist Krebsforscher und praktizierender Onkologe. Er ist Assistenzprofessor an der Columbia University und arbeitet am New York Presbyterian Hospital. Mukherjee studierte an der Stanford University, der University of Oxford, der Harvard Medical School und ist ein Rhodes Scholar. Regelmäßig veröffentlicht er Artikel in zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften. Für 'Der König aller Krankheiten' erhielt er 2011 den Pulitzer-Preis. Mit seiner Frau und den gemeinsamen Töchtern lebt
Schaden, BarbaraBARBARA SCHADEN übertrug u. a. Bücher von Margaret Atwood, Nadine Gordimer, Kazuo Ishiguro, Siddhartha Mukherjee, Dava Sobel und Jayne Anne Phillips ins Deutsche.
Schaden, BarbaraBARBARA SCHADEN übertrug u. a. Bücher von Margaret Atwood, Nadine Gordimer, Kazuo Ishiguro, Siddhartha Mukherjee, Dava Sobel und Jayne Anne Phillips ins Deutsche.
Produktdetails
- Verlag: DuMont Buchverlag
- Originaltitel: The Emperor of All Maladies. A Biography of Cancer
- 4. Aufl.
- Seitenzahl: 760
- Erscheinungstermin: 20. Februar 2012
- Deutsch
- Abmessung: 240mm x 165mm
- Gewicht: 1202g
- ISBN-13: 9783832196448
- ISBN-10: 3832196447
- Artikelnr.: 34530754
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.02.2012
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.02.2012Wie therapieren, wenn man die Ursache nicht kennt?
So muss Medizingeschichte geschrieben werden: Siddhartha Mukherjees Buch über die Geschichte des Kampfs gegen Krebs zeigt Sinn für Details und verliert doch nicht das große Ganze aus dem Blick.
Ärzte, denen es gelingt, die Geschichte ihrer Fachdisziplin mit großer Empathie für Patienten wie für Forscher aufzurollen, die mit Sinn für das Detail und das große Ganze schreiben und die dabei, was Theorie und Praxis angeht, aus dem Vollen schöpfen können, die gibt es nicht oft. Siddhartha Mukherjee ist solch ein Arzt. Dem Spezialisten für Krebserkrankungen ist es geglückt, nicht nur auf neue Art eine Geschichte der Krebsforschung zu schreiben, sondern vielmehr eine
So muss Medizingeschichte geschrieben werden: Siddhartha Mukherjees Buch über die Geschichte des Kampfs gegen Krebs zeigt Sinn für Details und verliert doch nicht das große Ganze aus dem Blick.
Ärzte, denen es gelingt, die Geschichte ihrer Fachdisziplin mit großer Empathie für Patienten wie für Forscher aufzurollen, die mit Sinn für das Detail und das große Ganze schreiben und die dabei, was Theorie und Praxis angeht, aus dem Vollen schöpfen können, die gibt es nicht oft. Siddhartha Mukherjee ist solch ein Arzt. Dem Spezialisten für Krebserkrankungen ist es geglückt, nicht nur auf neue Art eine Geschichte der Krebsforschung zu schreiben, sondern vielmehr eine
Mehr anzeigen
Geschichte der Beschäftigung mit dem Krebs. Weder Laien noch Fachleute werden dieses soeben auf Deutsch erschienene Buch ohne Gewinn aus der Hand legen, und nur der Ernst des Themas verbietet es, die Lektüre kurzweilig zu nennen.
Mukherjee beginnt wie fast jede Krebshistorie zunächst bei Atossa, der Frau des Perserkönigs Dareios, und dem ihr zugeschriebenen Brustkrebs. Aber schon dieser scheinbar so bekannte Adam-und-Eva-Start ist kalkuliert. Denn Brustkrebs und Blutkrebs - genauer: die kindliche Leukämie - sind die Protagonisten, die der Autor wie auf einem Glasträger unter dem Mikroskop hin und her schiebt. Dabei führt er vor, wie man immer wieder neue Aspekte der Krankheit Krebs in den Blick nahm, wie das Betrachten der Objektränder neue Sichtweisen auf das Zentrum ermöglichte, wie man innehielt und sich der Unschärfe des Abbildes bewusst wurde und wie man schließlich Okular und Blende neu justierte, um andere Ebenen zu fokussieren.
Scheinbar unverbunden werden zunächst unterschiedliche Therapien abgehandelt: die Ansätze zur Chemotherapie, die Chirurgie von Tumoren und schließlich die Bestrahlung. Aber immer wieder findet der Autor in Schleifen zu den eigentlich entscheidenden, medizintheoretischen Fragen zurück: Kann man zu wirksamen Therapien finden, auch wenn man die Ursache von Krebs nicht kennt? Ist Krebs eine lokal begrenzte Krankheit, die man mit Stumpf und Stiel ausrotten muss, oder eine systemische, die den ganzen Organismus betrifft? Wie radikal darf man behandeln, und rechtfertigt selbst eine geringe Aussicht auf Heilung entstellende und quälende Therapien?
Die kluge Beschränkung auf wenige Krebsleiden erlaubt es dem Autor daher, die Meilensteine der Forschung paradigmatisch abzuhandeln. So steht die Brustkrebschirurgie pars pro toto für andere Krebsoperationen, bei denen sich die Fachwelt zunächst kaum fragte, wie sehr sie die Lebensqualität dieser fast "leergeräumten" Patienten minderte. Anhand der Eingriffe an der Brust, die William Stewart Halsted am Ende des neunzehnten Jahrhunderts am Johns-Hopkins-Krankenhaus in grausiger Radikalität bis in die Tiefen des Brustraums vorantrieb, lässt sich das eindrucksvoll abhandeln. Gleichzeitig macht Mukherjee an diesem Beispiel selbst dem in wissenschaftlichen Methodenfragen ungeschulten Leser hervorragend klar, wie ein Denkstil jahrzehntelang die Chirurgie beherrschen konnte, obwohl die Zeitgenossen zweifelten und empirische Belege fehlten.
Auch erspart er seinen Kollegen nicht die Konfrontation mit ihren dunklen Stunden, als sie "wahllos ein Giftfass nach dem anderen über den Patienten" auskippten. Eindeutig macht er klar, dass manche Therapiefragwürdigkeit erst aufgrund aufgeklärter und selbstbewusster Patientenkoalitionen ihr Ende fand.
Biographische Anekdoten nutzt Mukherjee, wie man Viren für Medikamente nutzt: als Vehikel zur Einschleusung, in seinem Fall, um den Leser in schwierige wissenschaftliche Debatten einzuführen. Seine Erzählweise ist deshalb nur scheinbar auf Personen zentriert, sie werden in Dienst genommen. Um etwa zu zeigen, wie schwierig es war, Tabakrauch als Krebsauslöser zu identifizieren, scheut er sich zwar nicht, den Leser mit den Feinheiten der epidemiologischen Forschung zu behelligen. Aber er lässt hierfür auch die perfiden Vertuschungsversuche einzelner Verantwortlicher aus der Tabakindustrie nicht ungenutzt.
Mukherjee ist sich völlig darüber im Klaren, dass die Krebsforschung nicht nur das Werk einzelner Persönlichkeiten war. Dazu bedurfte es großer Strukturen, was er am Beispiel des Nationalen Krebsinstitut NCI in Bethesda darlegt. Dazu bedurfte es auch großer Summen wie der 1,5 Milliarden Dollar, die der National Cancer Act von 1971 den amerikanischen Krebsforschern für die folgenden drei Jahre zusicherte. Aber Mary Lasker, eine reiche und einflussreiche Lobbyistin, eignet sich dennoch bestens dazu, den Kampf ums Geld für den Kampf gegen Krebs zu personifizieren.
Oder jener legendäre Patient "Jimmy", eines der ersten Kinder, die mittels Chemotherapie geheilt wurden. Die Schilderung, wie es zur Gründung der Jimmy-Foundation für krebskranke Kinder kam, ist fast ein Pageturner und ebenso gut in Szene gesetzt wie seinerzeit die Live-Übertragung jenes Momentes im Radio, als das Lieblingsbaseballteam des Jungen ins Krankenzimmer kam. Obwohl Jimmy - ein Pseudonym - fünfzig Jahre anonym blieb, war dies die Geburtsstunde einer Spendenaktion, die das erste erfolgreiche Fundraising für die Leukämieforschung markiert.
Eine andere, gut begründete thematische Engführung ist die Fokussierung auf amerikanische Verhältnisse, ja mitunter auf wenige Zentren. Dreh- und Angelpunkt des Buches ist das Dana-Farber-Krebsinstitut in Boston, an dem Mukherjee seine Lehrjahre absolvierte. Dort spielen sich einige der im Buch eingestreuten Patientenschicksale ab. Dort wirkte vor allem Sydney Farber, den der Autor zum Vater der modernen Chemotherapie macht; er hätte keinen geeigneteren Forscher und Kämpfer die für Kinderleben erfinden können. Da sollte es der deutsche Leser verschmerzen, dass der Autor nur über den Ozean blickt und sich dort bedient, wenn es passt. So kommt immerhin Paul Ehrlich zu Ehren, weil dessen Überlegungen - während einer nächtlichen Zugfahrt - so treffend die Suche nach einem spezifischen Mittel illustrieren, das nur die Krebszelle schädigt, gesunde Zellen aber verschont.
Einzig die Tatsache, dass der Beitrag der Atombombenfolgen zur Krebsforschung nicht gewürdigt wird, ist eine bedauerliche Auslassung. Das wird nichts daran ändern, dass zukünftige Versuche, Medizingeschichte packend begreiflich zu machen, an diesem Werk gemessen werden müssen. Zu guter Letzt sei auf die glückliche Entscheidung des Lektorats hingewiesen, im Text auf jede störende Anmerkung zu verzichten und die Nachweise am Ende des Buches aufzulisten. Dort macht es eine innovative Zitierstrategie dem Leser leicht, sie anhand der Seitenzahlen aufzusuchen.
MARTINA LENZEN-SCHULTE
Siddhartha Mukherjee: "Der König aller Krankheiten". Krebs - eine Biografie.
Aus dem Englischen von Barbara Schaden. Dumont Verlag, Köln 2012. 670 S., geb., 26,-[Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Mukherjee beginnt wie fast jede Krebshistorie zunächst bei Atossa, der Frau des Perserkönigs Dareios, und dem ihr zugeschriebenen Brustkrebs. Aber schon dieser scheinbar so bekannte Adam-und-Eva-Start ist kalkuliert. Denn Brustkrebs und Blutkrebs - genauer: die kindliche Leukämie - sind die Protagonisten, die der Autor wie auf einem Glasträger unter dem Mikroskop hin und her schiebt. Dabei führt er vor, wie man immer wieder neue Aspekte der Krankheit Krebs in den Blick nahm, wie das Betrachten der Objektränder neue Sichtweisen auf das Zentrum ermöglichte, wie man innehielt und sich der Unschärfe des Abbildes bewusst wurde und wie man schließlich Okular und Blende neu justierte, um andere Ebenen zu fokussieren.
Scheinbar unverbunden werden zunächst unterschiedliche Therapien abgehandelt: die Ansätze zur Chemotherapie, die Chirurgie von Tumoren und schließlich die Bestrahlung. Aber immer wieder findet der Autor in Schleifen zu den eigentlich entscheidenden, medizintheoretischen Fragen zurück: Kann man zu wirksamen Therapien finden, auch wenn man die Ursache von Krebs nicht kennt? Ist Krebs eine lokal begrenzte Krankheit, die man mit Stumpf und Stiel ausrotten muss, oder eine systemische, die den ganzen Organismus betrifft? Wie radikal darf man behandeln, und rechtfertigt selbst eine geringe Aussicht auf Heilung entstellende und quälende Therapien?
Die kluge Beschränkung auf wenige Krebsleiden erlaubt es dem Autor daher, die Meilensteine der Forschung paradigmatisch abzuhandeln. So steht die Brustkrebschirurgie pars pro toto für andere Krebsoperationen, bei denen sich die Fachwelt zunächst kaum fragte, wie sehr sie die Lebensqualität dieser fast "leergeräumten" Patienten minderte. Anhand der Eingriffe an der Brust, die William Stewart Halsted am Ende des neunzehnten Jahrhunderts am Johns-Hopkins-Krankenhaus in grausiger Radikalität bis in die Tiefen des Brustraums vorantrieb, lässt sich das eindrucksvoll abhandeln. Gleichzeitig macht Mukherjee an diesem Beispiel selbst dem in wissenschaftlichen Methodenfragen ungeschulten Leser hervorragend klar, wie ein Denkstil jahrzehntelang die Chirurgie beherrschen konnte, obwohl die Zeitgenossen zweifelten und empirische Belege fehlten.
Auch erspart er seinen Kollegen nicht die Konfrontation mit ihren dunklen Stunden, als sie "wahllos ein Giftfass nach dem anderen über den Patienten" auskippten. Eindeutig macht er klar, dass manche Therapiefragwürdigkeit erst aufgrund aufgeklärter und selbstbewusster Patientenkoalitionen ihr Ende fand.
Biographische Anekdoten nutzt Mukherjee, wie man Viren für Medikamente nutzt: als Vehikel zur Einschleusung, in seinem Fall, um den Leser in schwierige wissenschaftliche Debatten einzuführen. Seine Erzählweise ist deshalb nur scheinbar auf Personen zentriert, sie werden in Dienst genommen. Um etwa zu zeigen, wie schwierig es war, Tabakrauch als Krebsauslöser zu identifizieren, scheut er sich zwar nicht, den Leser mit den Feinheiten der epidemiologischen Forschung zu behelligen. Aber er lässt hierfür auch die perfiden Vertuschungsversuche einzelner Verantwortlicher aus der Tabakindustrie nicht ungenutzt.
Mukherjee ist sich völlig darüber im Klaren, dass die Krebsforschung nicht nur das Werk einzelner Persönlichkeiten war. Dazu bedurfte es großer Strukturen, was er am Beispiel des Nationalen Krebsinstitut NCI in Bethesda darlegt. Dazu bedurfte es auch großer Summen wie der 1,5 Milliarden Dollar, die der National Cancer Act von 1971 den amerikanischen Krebsforschern für die folgenden drei Jahre zusicherte. Aber Mary Lasker, eine reiche und einflussreiche Lobbyistin, eignet sich dennoch bestens dazu, den Kampf ums Geld für den Kampf gegen Krebs zu personifizieren.
Oder jener legendäre Patient "Jimmy", eines der ersten Kinder, die mittels Chemotherapie geheilt wurden. Die Schilderung, wie es zur Gründung der Jimmy-Foundation für krebskranke Kinder kam, ist fast ein Pageturner und ebenso gut in Szene gesetzt wie seinerzeit die Live-Übertragung jenes Momentes im Radio, als das Lieblingsbaseballteam des Jungen ins Krankenzimmer kam. Obwohl Jimmy - ein Pseudonym - fünfzig Jahre anonym blieb, war dies die Geburtsstunde einer Spendenaktion, die das erste erfolgreiche Fundraising für die Leukämieforschung markiert.
Eine andere, gut begründete thematische Engführung ist die Fokussierung auf amerikanische Verhältnisse, ja mitunter auf wenige Zentren. Dreh- und Angelpunkt des Buches ist das Dana-Farber-Krebsinstitut in Boston, an dem Mukherjee seine Lehrjahre absolvierte. Dort spielen sich einige der im Buch eingestreuten Patientenschicksale ab. Dort wirkte vor allem Sydney Farber, den der Autor zum Vater der modernen Chemotherapie macht; er hätte keinen geeigneteren Forscher und Kämpfer die für Kinderleben erfinden können. Da sollte es der deutsche Leser verschmerzen, dass der Autor nur über den Ozean blickt und sich dort bedient, wenn es passt. So kommt immerhin Paul Ehrlich zu Ehren, weil dessen Überlegungen - während einer nächtlichen Zugfahrt - so treffend die Suche nach einem spezifischen Mittel illustrieren, das nur die Krebszelle schädigt, gesunde Zellen aber verschont.
Einzig die Tatsache, dass der Beitrag der Atombombenfolgen zur Krebsforschung nicht gewürdigt wird, ist eine bedauerliche Auslassung. Das wird nichts daran ändern, dass zukünftige Versuche, Medizingeschichte packend begreiflich zu machen, an diesem Werk gemessen werden müssen. Zu guter Letzt sei auf die glückliche Entscheidung des Lektorats hingewiesen, im Text auf jede störende Anmerkung zu verzichten und die Nachweise am Ende des Buches aufzulisten. Dort macht es eine innovative Zitierstrategie dem Leser leicht, sie anhand der Seitenzahlen aufzusuchen.
MARTINA LENZEN-SCHULTE
Siddhartha Mukherjee: "Der König aller Krankheiten". Krebs - eine Biografie.
Aus dem Englischen von Barbara Schaden. Dumont Verlag, Köln 2012. 670 S., geb., 26,-[Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Der New Yorker Onkologe Siddharta Mukherjee schreibt in seinem vielgelobten Buch die Geschichte des Krebs und seiner Behandlung. "Meisterlich" findet es auch Rezensentin Claudia Bartholemy-Teusch, die von Titel (König!) und Untertitel (Biografie!) zu einem wahren Metaphernrausch insipiriert wurde. An einer Stelle beschwört sie die Physiognomie des Krebs, "unsere Fratze", an anderer Stelle herrscht König Krebs, "sein Wille geschehe". Was die Substanz des Buches betrifft erfahren wir von Bartholemy-Teusch, dass dem Autor zufolge die Geschichte der Krebsbehandlung alles andere als linear verlaufen ist und wohl auch in Zukunft nicht gerader verlaufen wird. Denn wenn auch die Heilmethoden deutlich humaner geworden sind als noch zu Königin Atossas Zeiten, so sind sie immer noch nur partiell wirkungsvoll, mitunter jedoch kontraproduktiv.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Eine grandiose Kulturgeschichte des Krebses." SPIEGEL "Ein faszinierendes Buch und ein gewichtiges [...] Es ist meisterlich zu nennen, wie Siddhartha Mukherjee nach und nach das Phantombild des Krebses zeichnet, indem er die einzelnen Puzzleteile der Forschung [...] in ihrer jeweiligen Komplexität aufzeigt und sie dann stringent zu einem Noch-nicht-Ganzen zusammenfügt. [...] Das Buch [ist ...] eindrücklich und für ein Laienpublikum sehr gut verständlich [...]." NZZ "So muss Medizingeschichte geschrieben werden: Siddhartha Mukherjees Buch über die Geschichte des Kampfes gegen Krebs zeigt Sinn für Details und verliert doch nicht das große Ganze aus dem Blick. [...] Weder Laien noch Fachleute werden dieses Buch ohne Gewinn aus der Hand
Mehr anzeigen
legen." FAZ "Ein ganz wunderbares Buch. Nicht nur, weil es so spannend, so elegant, so ungeheuer reich an Wissen ist. Sondern vor allem, weil es auch von der Hoffnung erzählt." WAMS "Siddharta Mukherjee ist ein Wunder gelungen. Kein medizinisches, aber ein literarisches." Dieter Moor in ARD ttt "Seine Berichte sind lebendige Reportagen, die man nicht aus der Hand legen mag. (...) So umfassend, so facettenreich hat man den grausamen König aller Krankheiten, den Krebs, noch nie wahrgenommen." NDR 1 »Das Buch ist eine faszinierende Geschichte des Jahrhundertelangen Kampfes der Medizin gegen den Krebs.« Jules Hoffmann (Medizinnobelpreis 2011) in der ZEIT WISSEN "Siddhartha Mukherjee versteht es, aus einem Wust an Material die wichtigsten Fakten herauszufischen und spannend aufzuschreiben. Der Forscher hat dem Krebs Leben eingehaucht und eine Biografie über über die Krankheit geschrieben." FRANKFURTER RUNDSCHAU "Mukherjee ist kein Journalist, er kommt vom Fach. Doch für sein Buch wendet er Tugenden des Journalismus an: ausführliche, vorurteilsfreie Recherche, Beobachtung und eine Sprache, die dem Gegenstand gerecht wird und zugleich dem Uninformierten verständlich ist." BERLINER ZEITUNG "Dieses Buch ist vollkommen neu und ungewöhnlich." Deutschlandradio Kultur "Eine brillante Kombination aus Medizin-Krimi und Kriegsgeschichte. Ein Jahrhundertbuch." STERN "So empathisch, so gelehrt, so instruktiv, mit so viel Beherrschung des Gegenstandes und so viel Menschenliebe wird über Krankheit kaum je geschrieben." WELT AM SONNTAG/ BERLINER MORGENPOST ""Der König aller Krankheiten" ist ein Jahrhundertwerk, es richtet sich an Laien ebenso wie an Fachleute. Beeindruckend ist die Fähigkeit Siddharta Mukherjees, noch die verborgensten historischen Parallelen und Analogien herauszuarbeiten und zugleich ein großes Stück Literatur vorzulegen." FREITAG "Verstehen, womit wir es zu tun haben, ist das Anliegen des Autors, der auch die kulturellen Dimensionen zeichnet. [...] Ein Appell an uns alle, sich der Krankheit zu stellen und zu fordern, was uns zusteht: Geld für die Forschung, aber auch Anerkennung im Leiden und Respekt gegenüber den Leidenden." Literaturbeilage zur Leipziger Buchmesse von NEUES DEUTSCHLAND "Siddharta Mukherjee ist ein besessener Autor: über 670 Seiten lang kreist er um Metastasen, Myome und Mutationen. Über fast fünf Jahrtausende folgt er der Spur des Krebses. [...] Er beschreibt Fortschritte und Fehlschläge auf diesem langen Weg, er reiht Fakten aneinander, erweckt die die Forscherfiguren zum Leben, sie treiben die Handlung voran. Gelegentlich legt man das Buch weg - um es doch wieder zur Hand zu nehmen. Man will wissen, wie es den Betroffenen ergeht." Literaturbeilage der ZEIT "Mukherjee schreibt lebendig, er schreibt spannend und ungeheuer informativ." BADISCHE ZEITUNG "Unter den Tausenden von Büchern, die über Krebs geschrieben worden sind, ist Mukherjees umfangreiches Werk die erste Biografie der Krankheit selber. Es ist die Lebensgeschichte eines Bösewichts, dessen perfide Perfektion, verblüffende Anpassungsfähigkeit und enorme Widerstandskraft abstossen und faszinieren zugleich." DAS MAGAZIN "Siddharta Mukherjee ist mit seinem Erstlingswerk ein Kunststück gelungen: ein spannendes, elegant geschriebenes und kenntnisreiches Buch, das in der Tradition des erzählenden Journalismus steht." DER TAGESSPIEGEL "Spannend bis zur letzten Seite." BÜCHER "Ein großartiges Buch!" ÖKOTEST "Herrlich anschaulich: Siddhartha Mukherjee zeigt, dass es trotz aller Fortschrittsrhetorik noch ein weiter, womöglich nie abgeschlossener Weg bis zur Heilung von Tumorerkrankungen sein wird." SÜDDEUTSCHE ZEITUNG "Mukherjee erzählt die ebenso unheimliche wie faszinierende Geschichte der Krankheit vom Altertum bis zur heutigen Medizin (...)" P.M. "Das Buch vermittelt ein neues Bild vom Krebs." BILD DER WISSENSCHAFT "In der Kombination vieler Maßnahmen aber liegt die Chance, den Feind in die Knie zu zwingen. Das Buch beschreibt diesen lohnenden Kampf in bemerkenswert spannender und optimistischer Weise." PATHO BERUFSVERBAND "Das Epos über die 'Krankheit, vor der wir uns fürchten' ist gleichzeitig Weltgeschichte und Krankenhausdrama, Forschungskrimi und persönliche Reflexion. [...] Es ist weniger eine Beschreibung der Vorgänge im Körper als eine Geschichte der Menschen, die mit Krebs konfrontiert sind: Patienten, Angehörige, Forscher, Geldgeber, Politiker." BILD DER WISSENSCHAFT "Das Buch lässt uns nicht ängstlich, sondern kämpferisch zurück." HESSISCHE ALLGEMEINE
Schließen
Normalerweise lese ich eigentlich nicht so gerne Fachliteratur in meiner Freizeit.
Mich zieht es da schon eher in den Bereich Thriller etc.. Aber dieses Buch hat mich neugierig gemacht, da sehr viele Freunde und Bekannt an dieser Krankheit starben oder erkrankt sind.
Es ist, meiner Meinung …
Mehr
Normalerweise lese ich eigentlich nicht so gerne Fachliteratur in meiner Freizeit.
Mich zieht es da schon eher in den Bereich Thriller etc.. Aber dieses Buch hat mich neugierig gemacht, da sehr viele Freunde und Bekannt an dieser Krankheit starben oder erkrankt sind.
Es ist, meiner Meinung nach, keine Biografie über den Krebs wie es so schön heißt, "Der König aller Krankheiten Krebs - eine Biografie" sondern eher eine Geschichte über den Krebs und den Kampf gegen Krebs .
In diesem Buch bekommt man auch keinerlei Versprechen auf Heilung sondern zeigt den Betroffenen eher den Umgang mit dieser doch bedrohlichen Krankheit.
Mukjherjee beschreibt ,durch Fällen ,die gesamte Entwicklung dieser Krankheit über Jahrhunderte hinweg.
Wussten sie das Hippokrates es war, welcher dieser Krankheit den Namen Krebs gab?! Da die Geschwüre immer die Form dieses Tieres haben.
Was mir persönlich gefällt ist, das er ein besonderes Augenmerk auf das 20 Jahrhundert geworfen hat. Alle glauben durch Strahlentherapie, Radikaltherapie oder Chemotherapie den Krebs in seine Schranken weißen zu können, dies ist aber nicht der Fall. Sie schaden den meisten Patienten nur, nein sie besiegeln damit manchmal sogar den Tod des Erkrankten.
Mein Fazit ist, das diese Krankheit ein Teil unserer Zivilisation ist. Man sollte lernen damit zu leben und umzugehen.
5 Sterne von mir
Weniger
Antworten 214 von 388 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 214 von 388 finden diese Rezension hilfreich
"Fachbücher" mag ich eigentlich nicht..... mich haben die Bewertungen neugierig gemacht und das Thema Krebs an sich finde ich sehr interessant...
Das Buch ist verständlich geschrieben und erzählt den langen Weg der Medizin in der Krebsbekämpfung, der noch lange …
Mehr
"Fachbücher" mag ich eigentlich nicht..... mich haben die Bewertungen neugierig gemacht und das Thema Krebs an sich finde ich sehr interessant...
Das Buch ist verständlich geschrieben und erzählt den langen Weg der Medizin in der Krebsbekämpfung, der noch lange nicht beendet ist...
Fazit: SUPERtolles Buch!!! Sehr empfehlenswert
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
eBook, ePUB
Vor kurzem habe ich die Bücher "Das Lied der Zelle" und "Das Gen" von Siddharta Mukherjee entdeckt und regelrecht verschlungen, so dass ich nun auch noch sein bekanntestes Werk, "Den König aller Krankheiten", lesen wollte, für das der Onkologe u.a. mit …
Mehr
Vor kurzem habe ich die Bücher "Das Lied der Zelle" und "Das Gen" von Siddharta Mukherjee entdeckt und regelrecht verschlungen, so dass ich nun auch noch sein bekanntestes Werk, "Den König aller Krankheiten", lesen wollte, für das der Onkologe u.a. mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet wurde. Und genau wie die beiden anderen Bücher auch hat es mich in seinen Bann gezogen.
Mukherjee erzählt darin in Form einer Biographie die umfassende Geschichte der Krankheit Krebs, beginnend in der Antike, über die Irrungen und Wirrungen in der Krebsforschung
und die teils erschreckenden historischen "Therapien" bis hin zu modernsten Behandlungsmethoden und aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Hochinteressant erläutert er auch der Einfluss der Lobbyisten auf die Krebsforschung und ihre Finanzierung sowie die unrühmliche Rolle der Tabakindustrie. Mukherjee beschreibt den unermüdlichen Einsatz von Ärzt*innen in der Krebsforschung, ihre einfallsreiche Suche nach neuen Diagnose- und Therapieformen und auch den Einfluss von Entdeckungen in der Physik, Chemie und Biologie auf die Medizin.
Mukherjees Schreibstil fasziniert mich jedes Mal wieder. Seine sehr umfangreichen Sachbücher sind so spannend und mitreißend geschrieben wie ein Roman. Ich habe mit den Patienten und Patientinnen aus den Fallbeispielen seiner medizinischen Laufbahn mitgefühlt und gebangt. Die Schicksale gehen einem als Leser sehr nahe, insbesondere bei den Kindern.
Wie in seinen anderen Büchern auch gelingt es Mukherjee auf hervorragende Weise, komplexe medizinische Sachverhalte anschaulich und verständlich zu erklären, ohne dabei oberflächlich zu werden oder stärker zu vereinfachen als nötig. Man spürt auf jeder Seite, dass Mukherjee nicht nur ein leidenschaftlicher Arzt und Forscher, sondern auch ein begnadeter Lehrer und Autor ist.
Ich kann das Buch jedem medizinisch interessierten Leser weiterempfehlen und hoffe bereits jetzt auf ein weiteres Buch von Mukherjee.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für