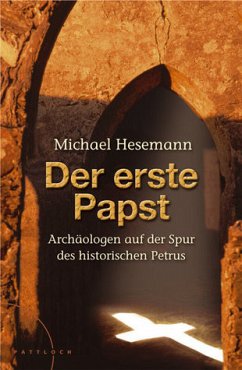Kritiker behaupten, der erste Papst sei niemals in Rom gewesen. Michael Hesemann beweist das Gegenteil. Bei Ausgrabungen unter der Krypta des Petersdoms hat man einen Hohlraum gefunden mit der Inschrift: "Petros Eni - Petrus ist hier drin." Darin befindet sich eine Marmorkassette mit menschlichen Knochen aus dem 1. Jahrhundert. Wurde hier Petrus begraben? Mit kriminalistischer Sorgfalt spürt der Autor der Legende um das Grab Petri nach und geht dabei den römischen Traditionen auf den Grund.
Auf seinem Weg, die Überlieferungen der katholischen Tradition vom Stigma des Sagenhaften zu befreien, ist Hesemann nach seinen hervorragend lesbaren Darstellungen von der Fatima-Prophezeiung (2002) und Die Entdeckung des heiligen Gral (2003) nun beim ersten Papst und der Bestimmung seiner Bestattungsstätte angekommen. Wiederum ist ihm ein Buch gelungen, welches seine Zielgruppe kennt und das aufstrebende Interesse an Archäologie durchaus zu befriedigen vermag.
Und tatsächlich birgt das Thema Stoff für einen Thriller. In den sechziger Jahren versäumte der Vatikan die Bekanntmachung, Begräbnisstätte und Gebeine von Petrus exakt unterhalb des Bernini-Baldachins im Petersdom gefunden zu haben. Geheimnistuerei und Eitelkeiten zwischen Geistlichen und Laien im Archäologenteam verhinderten eine wissenschaftliche und öffentliche Dokumentation der Grabungen, was den Wert der an sich unzweifelhaften Funde noch heute mindert. Eben auch darum verdient Hesemanns Darstellung dieser Auffindung der Begräbnisstraße Respekt, da dies wahrscheinlich noch nicht in dieser zusammenhängenden Form recherchiert und geschildert wurde.
Davon ausgehend nutzt Hesemann das aufkommende Interesse an der Person Petri und begibt sich auf dessen erste Spuren am See Genezareth. Er beschreibt das Dasein von Petrus, als er noch den Namen Simon trug und das Leben eines mittelständischen Fischers führte, ehe er von Jesus entdeckt und für eine andere Karriere auserkoren wurde. Hierüber gibt es durchaus Erfolge der Archäologie zu nennen: Das Auffinden des Wohnhauses Petri in Kafarnaum (Spekulation hier: Hauste demzufolge in diesen Mauern dann nicht auch zeitweilig Jesus?); ein Fischerboot aus der Zeit Jesu Christi (Spekulation hier: Könnte das nicht das Boot sein, von wo aus über das Wasser gewandelt wurde?) und weiteres Interessantes wie eine Tonscherbe mit eingeritztem Kreuz (erster Beweis für die Nutzung des Kreuzsymbols bei den Urchristen). Weiter dann geht es in wohldosiertem Tempo zum Abendmahlsaal, für dessen Lokalisierung eine Theorie über die Nähe der Apostel zu den Essenern dargebracht wird. Kurzum: Man möchte Hesemann in seiner Begeisterung folgen und wahrscheinlich werden auch Wissenschaftler mit berufsbedingt weniger gutem Willen die meisten dieser vorgebrachten Argumente mit Interesse folgen, sofern sie sich selbst die Lust auf Spekulation noch nicht gänzlich verboten haben.
Dennoch sollte man Hesemanns Argumenten nicht ohne Skepsis begegnen. Hierfür sei ein Beispiel genannt: Kritiklos und mit dem Anspruch gesicherter Wahrheit verwendet Hesemann die These, dass eines der in Höhle 7 von Qumran gefundenen Fragmente (das 7q5 Fragment) eine Abschrift des Markus-Evangeliums sei. Diese in der Fachwelt von Carsten Peter Thiede vertretene These ist wegen seiner vermeintlich starken Implikation hinsichtlich der Datierung des Evangeliums ausgesprochen bekannt, aber bestenfalls umstritten und ohne größeren Anhängerkreis. Hesemann jedoch vermittelt dem Leser diese These als unwidersprochene wissenschaftliche Wahrheit, was durchaus Zweifel an der übrigen, immer selbstsicher vorgetragenen Darstellung hinterlässt. Ohnehin ist Thiedes Buch Ein Fisch für den römischen Kaiser für Hesemann offensichtlich eine Primärquelle, was daran erkennbar ist, dass er von dort so manches Bonmont übernimmt wie "Beitseda kann man auf gut deutsch mit "Fischhausen" übersetzen!" Wer sich nur für den Lebensraum der Apostel und Jesu interessiert, könnte wahrscheinlich ohnehin mit dem sehr empfehlenswerten Buch von Thiede besser bedient sein.
Trotz dieser Einschränkungen hat Hesemanns Buch seine Berechtigung. Wenn auch ein archäologisch gut gestütztes Argument keine "Verifizierung" katholischer Tradition bedeutet, so musste einmal ein Buch geschrieben werden, welches die Erkenntnisse der Archäologie verwendet, um die Überlieferung der Evangelien und der Apostelgeschichte zu stützen. Diese Forderung hat Hesemann hiermit erfüllt und damit seine Papstaudienz redlich verdient. Die flotte und ansprechende Darstellung bedient auch eine Zielgruppe die lediglich Kenntnis darüber hat, wer "Indiana Jones" ist.
(Clemens Todd)
Und tatsächlich birgt das Thema Stoff für einen Thriller. In den sechziger Jahren versäumte der Vatikan die Bekanntmachung, Begräbnisstätte und Gebeine von Petrus exakt unterhalb des Bernini-Baldachins im Petersdom gefunden zu haben. Geheimnistuerei und Eitelkeiten zwischen Geistlichen und Laien im Archäologenteam verhinderten eine wissenschaftliche und öffentliche Dokumentation der Grabungen, was den Wert der an sich unzweifelhaften Funde noch heute mindert. Eben auch darum verdient Hesemanns Darstellung dieser Auffindung der Begräbnisstraße Respekt, da dies wahrscheinlich noch nicht in dieser zusammenhängenden Form recherchiert und geschildert wurde.
Davon ausgehend nutzt Hesemann das aufkommende Interesse an der Person Petri und begibt sich auf dessen erste Spuren am See Genezareth. Er beschreibt das Dasein von Petrus, als er noch den Namen Simon trug und das Leben eines mittelständischen Fischers führte, ehe er von Jesus entdeckt und für eine andere Karriere auserkoren wurde. Hierüber gibt es durchaus Erfolge der Archäologie zu nennen: Das Auffinden des Wohnhauses Petri in Kafarnaum (Spekulation hier: Hauste demzufolge in diesen Mauern dann nicht auch zeitweilig Jesus?); ein Fischerboot aus der Zeit Jesu Christi (Spekulation hier: Könnte das nicht das Boot sein, von wo aus über das Wasser gewandelt wurde?) und weiteres Interessantes wie eine Tonscherbe mit eingeritztem Kreuz (erster Beweis für die Nutzung des Kreuzsymbols bei den Urchristen). Weiter dann geht es in wohldosiertem Tempo zum Abendmahlsaal, für dessen Lokalisierung eine Theorie über die Nähe der Apostel zu den Essenern dargebracht wird. Kurzum: Man möchte Hesemann in seiner Begeisterung folgen und wahrscheinlich werden auch Wissenschaftler mit berufsbedingt weniger gutem Willen die meisten dieser vorgebrachten Argumente mit Interesse folgen, sofern sie sich selbst die Lust auf Spekulation noch nicht gänzlich verboten haben.
Dennoch sollte man Hesemanns Argumenten nicht ohne Skepsis begegnen. Hierfür sei ein Beispiel genannt: Kritiklos und mit dem Anspruch gesicherter Wahrheit verwendet Hesemann die These, dass eines der in Höhle 7 von Qumran gefundenen Fragmente (das 7q5 Fragment) eine Abschrift des Markus-Evangeliums sei. Diese in der Fachwelt von Carsten Peter Thiede vertretene These ist wegen seiner vermeintlich starken Implikation hinsichtlich der Datierung des Evangeliums ausgesprochen bekannt, aber bestenfalls umstritten und ohne größeren Anhängerkreis. Hesemann jedoch vermittelt dem Leser diese These als unwidersprochene wissenschaftliche Wahrheit, was durchaus Zweifel an der übrigen, immer selbstsicher vorgetragenen Darstellung hinterlässt. Ohnehin ist Thiedes Buch Ein Fisch für den römischen Kaiser für Hesemann offensichtlich eine Primärquelle, was daran erkennbar ist, dass er von dort so manches Bonmont übernimmt wie "Beitseda kann man auf gut deutsch mit "Fischhausen" übersetzen!" Wer sich nur für den Lebensraum der Apostel und Jesu interessiert, könnte wahrscheinlich ohnehin mit dem sehr empfehlenswerten Buch von Thiede besser bedient sein.
Trotz dieser Einschränkungen hat Hesemanns Buch seine Berechtigung. Wenn auch ein archäologisch gut gestütztes Argument keine "Verifizierung" katholischer Tradition bedeutet, so musste einmal ein Buch geschrieben werden, welches die Erkenntnisse der Archäologie verwendet, um die Überlieferung der Evangelien und der Apostelgeschichte zu stützen. Diese Forderung hat Hesemann hiermit erfüllt und damit seine Papstaudienz redlich verdient. Die flotte und ansprechende Darstellung bedient auch eine Zielgruppe die lediglich Kenntnis darüber hat, wer "Indiana Jones" ist.
(Clemens Todd)