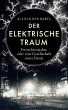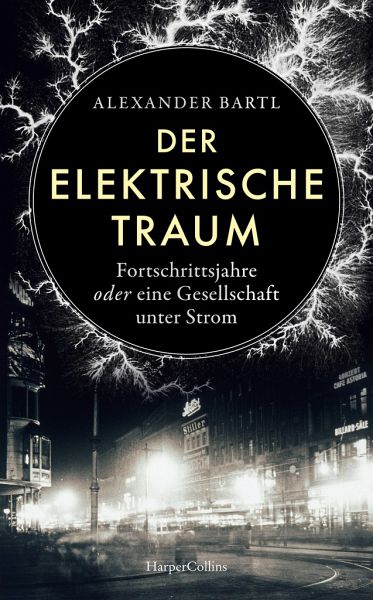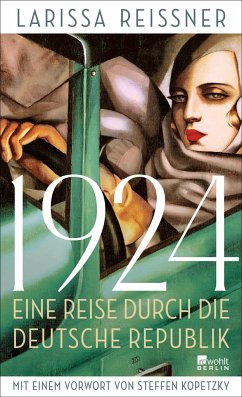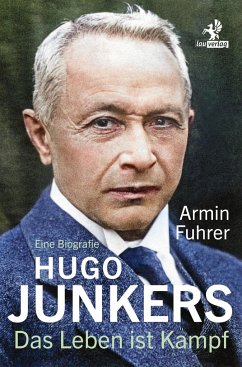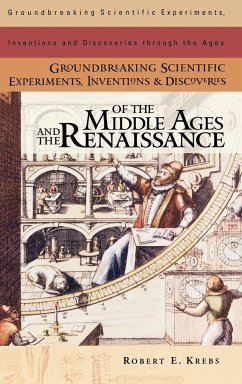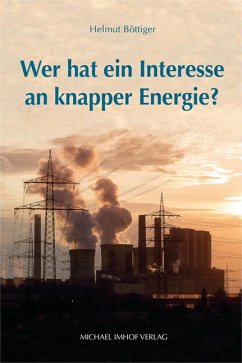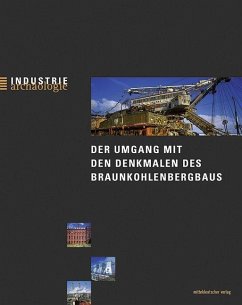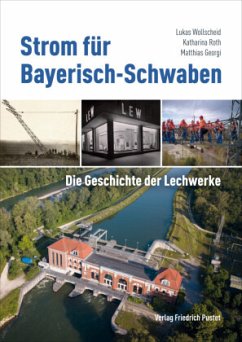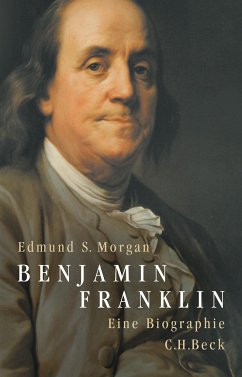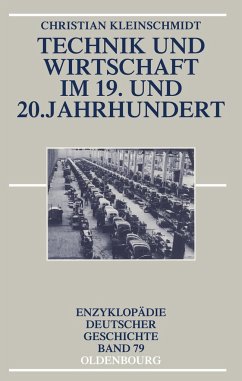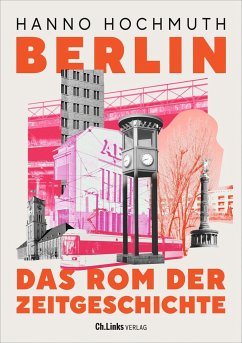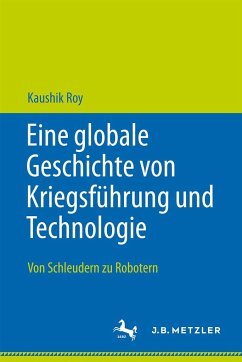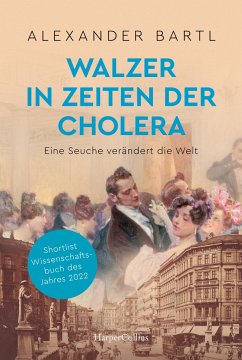Alexander Bartl
Gebundenes Buch
Der elektrische Traum. Fortschrittsjahre oder eine Gesellschaft unter Strom
Stromausfall Stromversorgung Elektrizität Wilhelm I. Deutsche Kaiserzeit Industrialisierung Thomas Alva Edison

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Das magische Leuchten - über die Elektrifizierung der Welt und die erste EnergiewendeIm Jahr 1878 sind sich die führenden Ingenieure der Kaiserzeit einig: Niemals wird Elektrizität das Gaslicht verdrängen. Strombetriebene Lampen seien unpraktisch und schadeten der Gesundheit. Leuchtgas werde unentbehrlich bleiben, meint etwa der Ingenieur Werner Siemens.Dieses Licht hat der Menschheit aber auch eine Bedrohung beschert: Immer mehr Gasbrände verzeichnet die Statistik, immer mehr Explosionen. Und nirgendwo ist die Gefahr größer als in den Theatern, den Zentren des Zeitgeists im 19. Jahrhun...
Das magische Leuchten - über die Elektrifizierung der Welt und die erste Energiewende
Im Jahr 1878 sind sich die führenden Ingenieure der Kaiserzeit einig: Niemals wird Elektrizität das Gaslicht verdrängen. Strombetriebene Lampen seien unpraktisch und schadeten der Gesundheit. Leuchtgas werde unentbehrlich bleiben, meint etwa der Ingenieur Werner Siemens.
Dieses Licht hat der Menschheit aber auch eine Bedrohung beschert: Immer mehr Gasbrände verzeichnet die Statistik, immer mehr Explosionen. Und nirgendwo ist die Gefahr größer als in den Theatern, den Zentren des Zeitgeists im 19. Jahrhundert. Doch das Risiko ist zur Routine geworden - bis es 1881 im Wiener Ringtheater zur Katastrophe kommt und fast 400 Menschen sterben. Ein Wendepunkt mit weitreichenden Folgen.
Mit Verve und erhellender Sachkenntnis erzählt Alexander Bartl von einer Energierevolution, die ganz Europa und Amerika in Aufregung versetzte. Letztlich triumphiert Thomas Alva Edisonmit der Erfindung seiner Glühbirne und bringt unsere Welt zum Leuchten.
Im Jahr 1878 sind sich die führenden Ingenieure der Kaiserzeit einig: Niemals wird Elektrizität das Gaslicht verdrängen. Strombetriebene Lampen seien unpraktisch und schadeten der Gesundheit. Leuchtgas werde unentbehrlich bleiben, meint etwa der Ingenieur Werner Siemens.
Dieses Licht hat der Menschheit aber auch eine Bedrohung beschert: Immer mehr Gasbrände verzeichnet die Statistik, immer mehr Explosionen. Und nirgendwo ist die Gefahr größer als in den Theatern, den Zentren des Zeitgeists im 19. Jahrhundert. Doch das Risiko ist zur Routine geworden - bis es 1881 im Wiener Ringtheater zur Katastrophe kommt und fast 400 Menschen sterben. Ein Wendepunkt mit weitreichenden Folgen.
Mit Verve und erhellender Sachkenntnis erzählt Alexander Bartl von einer Energierevolution, die ganz Europa und Amerika in Aufregung versetzte. Letztlich triumphiert Thomas Alva Edisonmit der Erfindung seiner Glühbirne und bringt unsere Welt zum Leuchten.
ALEXANDER BARTL wurde 1976 in Wien geboren. Er studierte Film- und Theaterwissenschaft sowie Publizistik in Mainz und Edinburgh. Als Journalist schrieb er auch für dieFrankfurter Allgemeine Zeitung und für das österreichische Nachrichtenmagazin Profil. Heute arbeitet Alexander Bartl für Focus in Berlin. Sein erstes Sachbuch »Walzer in Zeiten der Cholera« schaffte es auf die Shortlist für das »Wissenschaftsbuch des Jahres 2022«.
Produktdetails
- Verlag: HarperCollins Hamburg / HarperCollins Hardcover
- 1. Auflage
- Seitenzahl: 320
- Erscheinungstermin: 26. September 2023
- Deutsch
- Abmessung: 205mm x 133mm x 33mm
- Gewicht: 444g
- ISBN-13: 9783365004586
- ISBN-10: 3365004580
- Artikelnr.: 67660384
Herstellerkennzeichnung
HarperCollins Hardcover
Valentinskamp 24
20354 Hamburg
vertrieb@harpercollins.de
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Urs Hafner hält Alexander Bartls Technikgeschichte nur gelegentlich für überdramatisiert. Eine Geschichte der Elektrizität sollte ohne Altherrenwitze auskommen, findet er. Davon abgesehen aber bietet ihm Bartl spannende Einblicke in die Entwicklungen um Thomas Edison und die Glühbirne in Wien, Nizza, Berlin und Menlo Park, New Jersey, gespickt immer wieder mit individuellen Schicksalen und Miniaturen zu Theaterbränden (Gaslampen!) und den Umtrieben der Gaslobby.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Man stößt ständig auf verblüffende Zusammenhänge, die szenische Darstellung ist auch sehr einprägsam, man bekommt einen starken Einblick der damaligen Fortschrittsjahre um 1880. Wolfgang Schneider Deutschlandfunk Kultur Lesart 20231005
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 29.12.2023
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 29.12.2023Nachdem der richtige Faden gefunden war
Alexander Bartl erzählt mit dramaturgischem Eifer vom Triumph der Glühbirne über die Gasflamme
"Wien stand unter Schock." Alexander Bartl hat den Satz in sein Buch zur Geschichte der Elektrizität gestanzt. Was also war passiert? 1875 hätte in einer Wiener Theateraufführung ein Elefant auftreten sollen, doch die Behörden untersagten das Spektakel kurz vor der Premiere mit der Begründung, es sei nicht erwiesen, dass das Tier gezähmt und also für das Publikum ungefährlich sei. Ein paar Tage später durfte der von der Presse "Mister Kennedy" genannte Elefant die Bühne dann doch noch betreten, nämlich in einer Bearbeitung von Jules Vernes' Roman "Die Reise um die Welt in achtzig
Alexander Bartl erzählt mit dramaturgischem Eifer vom Triumph der Glühbirne über die Gasflamme
"Wien stand unter Schock." Alexander Bartl hat den Satz in sein Buch zur Geschichte der Elektrizität gestanzt. Was also war passiert? 1875 hätte in einer Wiener Theateraufführung ein Elefant auftreten sollen, doch die Behörden untersagten das Spektakel kurz vor der Premiere mit der Begründung, es sei nicht erwiesen, dass das Tier gezähmt und also für das Publikum ungefährlich sei. Ein paar Tage später durfte der von der Presse "Mister Kennedy" genannte Elefant die Bühne dann doch noch betreten, nämlich in einer Bearbeitung von Jules Vernes' Roman "Die Reise um die Welt in achtzig
Mehr anzeigen
Tagen".
Natürlich stand Wien wegen des zunächst untersagten Elefantenauftritts nicht unter Schock. Allenfalls dürften ein paar Theaterfreundinnen und Elefantenfans enttäuscht gewesen sein. Das weiß auch Alexander Bartl. Aber er setzt in seinem Buch über ein Kapitel der Technikgeschichte beherzt auf Dramatisierung. Es liest sich trotz gelegentlichen narrativen Übereifers und einiger Altherrenwitze recht vergnüglich.
Der Autor konzentriert seine Elektrizitätsgeschichte auf die Zeit um 1880 und auf die Orte Wien, Nizza, Berlin, München, Manhattan, Brünn und Menlo Park in New Jersey, USA (nicht zu verwechseln mit Menlo Park im Silicon Valley, Kalifornien). In Letzterem tüfteln Thomas Alva Edison und seine Schüler, die ihn bedingungslos verehren, in ihrer Werkstätte nächtelang an der Erfindung der Glühbirne herum. Der Weg dahin ist steinig, ein im Glasvakuum gespannter Papier- und dann Bambusfaden bringt schließlich den Durchbruch. Der Faden wird vom durchfließenden Strom nicht mehr in Sekundenschnelle verglüht wie die Platin- und anderen Metallstäbchen, die Edison ausprobiert hatte, sondern hält Hunderte von Stunden durch. Erst jetzt ist die Glühbirne außerhalb des Labors für praktische Zwecke benutzbar.
Zum Beispiel - hier kommt der Elefant ins Spiel - in den europäischen Theaterhäusern, in Nizza, Wien, München. Diese nämlich sind auf Beleuchtung angewiesen, die noch immer vom gefährlichen Gas kommt. In den Garderoben und Gängen, vor allem aber über und neben der Bühne züngeln Tausende von Flämmchen. Die Brand- und Explosionsgefahr ist immens, auch wegen der oft undichten Gasleitungen. Mehrere Theater brennen denn auch während Vorführungen nieder, so 1881 das Wiener Ringtheater. Da steht die Stadt tatsächlich unter Schock. Bartl malt die Katastrophe in einer schmucken Miniatur aus, unter Einbezug individueller Schicksale.
Unversehrt bleibt die Schauspielerin Sarah Bernhardt, die in jenen Tagen in Wien gastiert. Der Star hätte die Vorzüge elektrischen Lichts gekannt. In einer Winternacht, die von den allerersten Glühbirnen überhaupt illuminiert wurde, hatte "die Bernhardt" Edison in Menlo Park besucht. Nicht nur der Auftritt von Mister Kennedy, dem Elefanten, auch der Auftritt Bernhardts ist für Bartl ein weiterer dramaturgischer Kniff. Inhaltlich tun beide eigentlich nichts zur Sache.
Bartl bringt die Umschlagmomente auf die Bühne: Edison, den "Geburtshelfer der Moderne", in Menlo Park, die Theater in Europa. Es sind die Theaterbrände, die dem elektrischen Licht in Europa um 1880 dem Weg ebneten, so Bartls These. Die Theaterhäuser mussten umdenken. Die Gaslobby, die sich weigerte, ihre maroden Leitungen zu sanieren, und gegen die neue Technik intrigierte, wo sie nur konnte, zog schließlich den Kürzeren. Am schnellsten reagierte nicht Wien, sondern Brünn. Schon 1882 eröffnete dort das erste vollelektrische Theater. Nach den Theatern wurden weitere öffentliche Gebäude mit dem sauberen Licht ausgestattet, später dann wohlhabende Stadtquartiere. In München fand die erste Elektrizitätsausstellung im deutschen Sprachraum statt, Werner Siemens sprang doch noch auf den Zug auf. Diesen Strang der Elektrizitätsgeschichte deutet Bartl nur noch an.
Das ist hier also der "Fortschritt in die Moderne", der Triumph der sicheren Glühbirne über die rußende Gasflamme. Aber woher kommt der Strom? Am Ende des Buchs scheint den Autor ein leises Unbehagen beschlichen zu haben. Am Rand merkt er an, dass Gas weiterhin fürs Heizen benutzt und der saubere Strom mit der schmutzigen Kohle produziert wurde. Der Bruch scheint also doch nicht so einschneidend gewesen zu sein. Der Fortschritt war nur einer für die Theaterbesucher. URS HAFNER
Alexander Bartl: "Der elektrische Traum". Fortschrittsjahre oder eine Gesellschaft unter Strom.
HarperCollins Verlag, Hamburg 2023. 320 S., geb., 24,- Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Natürlich stand Wien wegen des zunächst untersagten Elefantenauftritts nicht unter Schock. Allenfalls dürften ein paar Theaterfreundinnen und Elefantenfans enttäuscht gewesen sein. Das weiß auch Alexander Bartl. Aber er setzt in seinem Buch über ein Kapitel der Technikgeschichte beherzt auf Dramatisierung. Es liest sich trotz gelegentlichen narrativen Übereifers und einiger Altherrenwitze recht vergnüglich.
Der Autor konzentriert seine Elektrizitätsgeschichte auf die Zeit um 1880 und auf die Orte Wien, Nizza, Berlin, München, Manhattan, Brünn und Menlo Park in New Jersey, USA (nicht zu verwechseln mit Menlo Park im Silicon Valley, Kalifornien). In Letzterem tüfteln Thomas Alva Edison und seine Schüler, die ihn bedingungslos verehren, in ihrer Werkstätte nächtelang an der Erfindung der Glühbirne herum. Der Weg dahin ist steinig, ein im Glasvakuum gespannter Papier- und dann Bambusfaden bringt schließlich den Durchbruch. Der Faden wird vom durchfließenden Strom nicht mehr in Sekundenschnelle verglüht wie die Platin- und anderen Metallstäbchen, die Edison ausprobiert hatte, sondern hält Hunderte von Stunden durch. Erst jetzt ist die Glühbirne außerhalb des Labors für praktische Zwecke benutzbar.
Zum Beispiel - hier kommt der Elefant ins Spiel - in den europäischen Theaterhäusern, in Nizza, Wien, München. Diese nämlich sind auf Beleuchtung angewiesen, die noch immer vom gefährlichen Gas kommt. In den Garderoben und Gängen, vor allem aber über und neben der Bühne züngeln Tausende von Flämmchen. Die Brand- und Explosionsgefahr ist immens, auch wegen der oft undichten Gasleitungen. Mehrere Theater brennen denn auch während Vorführungen nieder, so 1881 das Wiener Ringtheater. Da steht die Stadt tatsächlich unter Schock. Bartl malt die Katastrophe in einer schmucken Miniatur aus, unter Einbezug individueller Schicksale.
Unversehrt bleibt die Schauspielerin Sarah Bernhardt, die in jenen Tagen in Wien gastiert. Der Star hätte die Vorzüge elektrischen Lichts gekannt. In einer Winternacht, die von den allerersten Glühbirnen überhaupt illuminiert wurde, hatte "die Bernhardt" Edison in Menlo Park besucht. Nicht nur der Auftritt von Mister Kennedy, dem Elefanten, auch der Auftritt Bernhardts ist für Bartl ein weiterer dramaturgischer Kniff. Inhaltlich tun beide eigentlich nichts zur Sache.
Bartl bringt die Umschlagmomente auf die Bühne: Edison, den "Geburtshelfer der Moderne", in Menlo Park, die Theater in Europa. Es sind die Theaterbrände, die dem elektrischen Licht in Europa um 1880 dem Weg ebneten, so Bartls These. Die Theaterhäuser mussten umdenken. Die Gaslobby, die sich weigerte, ihre maroden Leitungen zu sanieren, und gegen die neue Technik intrigierte, wo sie nur konnte, zog schließlich den Kürzeren. Am schnellsten reagierte nicht Wien, sondern Brünn. Schon 1882 eröffnete dort das erste vollelektrische Theater. Nach den Theatern wurden weitere öffentliche Gebäude mit dem sauberen Licht ausgestattet, später dann wohlhabende Stadtquartiere. In München fand die erste Elektrizitätsausstellung im deutschen Sprachraum statt, Werner Siemens sprang doch noch auf den Zug auf. Diesen Strang der Elektrizitätsgeschichte deutet Bartl nur noch an.
Das ist hier also der "Fortschritt in die Moderne", der Triumph der sicheren Glühbirne über die rußende Gasflamme. Aber woher kommt der Strom? Am Ende des Buchs scheint den Autor ein leises Unbehagen beschlichen zu haben. Am Rand merkt er an, dass Gas weiterhin fürs Heizen benutzt und der saubere Strom mit der schmutzigen Kohle produziert wurde. Der Bruch scheint also doch nicht so einschneidend gewesen zu sein. Der Fortschritt war nur einer für die Theaterbesucher. URS HAFNER
Alexander Bartl: "Der elektrische Traum". Fortschrittsjahre oder eine Gesellschaft unter Strom.
HarperCollins Verlag, Hamburg 2023. 320 S., geb., 24,- Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Rezensent Urs Hafner hält Alexander Bartls Technikgeschichte nur gelegentlich für überdramatisiert. Eine Geschichte der Elektrizität sollte ohne Altherrenwitze auskommen, findet er. Davon abgesehen aber bietet ihm Bartl spannende Einblicke in die Entwicklungen um Thomas Edison und die Glühbirne in Wien, Nizza, Berlin und Menlo Park, New Jersey, gespickt immer wieder mit individuellen Schicksalen und Miniaturen zu Theaterbränden (Gaslampen!) und den Umtrieben der Gaslobby.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Dieses Buch hat mich richtig begeistert! Alexander Bartl schreibt so frisch, unterhaltsam und wortgewandt, dass ich stellenweise ganz vergaß, dass es sich hier um ein Sachbuch handelt und ich in die spannende Geschichte der Elektrifizierung eintauchen konnte wie in einen Roman. In mehreren …
Mehr
Dieses Buch hat mich richtig begeistert! Alexander Bartl schreibt so frisch, unterhaltsam und wortgewandt, dass ich stellenweise ganz vergaß, dass es sich hier um ein Sachbuch handelt und ich in die spannende Geschichte der Elektrifizierung eintauchen konnte wie in einen Roman. In mehreren parallelen Erzählsträngen schildert Bartl die gefährliche Situation in den gasbeleuchteten Theatern des späten 19. Jahrhunderts und die verheerenden Brände in Nizza und Wien, den Pioniergeist in Menlo Park um Thomas Alva Edison und seine "Edisonians" und den steinigen Weg zur Vermarktung der Glühlampe, zu deren Wegbereitern auch Emil Rathenau gehörte. Sehr lebendig und auch immer wieder mit leisem Humor beschreibt der Autor die Atmosphäre um Edison und die gesellschaftliche Situation der damaligen Zeit. Ich habe durch dieses Buch sehr viel Neues erfahren - so war mir nicht bewusst, wie hoch das Feuerrisiko in den Theatern damals war, welche Bedeutung dieses für den Durchbruch der Glühlampe hatte und gegen wie viele Widerstände sich die neue Technik durchsetzen musste. Auch von dem genialen, aber menschlich schwierigen Edison und seinen Wedegang konnte ich mir ein eindrückliches Bild machen. Ein wirklich hochinteressantes, hervorragend geschriebenes Buch über die Anfänge der Elektrizität und den Beginn ihres Siegeszuges in den gesellschaftlichen Alltag, aus dem sie heute nicht mehr wegzudenken ist. Unbedingt lesenswert!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Historiker und Autor Alexander Bartl entführt seine Leser wieder in das 19. Jahrhundert, das eine spannende Zeit des Umbruchs ist. Zahlreiche Erfindungen verbessern den Alltag, machen allerdings auch vielen Menschen Angst. In diesem Sachbuch bringt er uns den Aufstieg der Elektrizität …
Mehr
Historiker und Autor Alexander Bartl entführt seine Leser wieder in das 19. Jahrhundert, das eine spannende Zeit des Umbruchs ist. Zahlreiche Erfindungen verbessern den Alltag, machen allerdings auch vielen Menschen Angst. In diesem Sachbuch bringt er uns den Aufstieg der Elektrizität näher.
Ein zentraler Punkt des Siegeszuges der Elektrifizierung von Gebäuden sind Brände in Theatern. Neben dem Brand des Theaters in Nizza im März 1881 ist es der Brand des Wiener Ringstraßentheaters im November desselben Jahres, der mehreren Hundert Menschen das Leben gekostet hat, die den Siegeszug der elektrischen Beleuchtung antreibt. Der Brand in Wien ist neben organisatorischen und baulichen Mängeln (fehlende Trennung von Bühne und Zuschauerraum, enge, mit brennbaren Materialien ausgestattete Stiegenhäuser und nach innen aufgehende Ausgänge) ist vor allem auf die Beleuchtung mit Leuchtgas zurückzuführen, die zusätzlich noch schlecht gewartet worden ist. In den Jahren zuvor ist elektrisches Licht als Spielerei für Reiche abgetan worden - illuminiertes Vergnügen.
Dabei sind Explosionen aufgrund von undichten Gasleitungen unter der Erde und in den Häusern fast schon an der Tagesordnung.
Manch einer sieht in der Elektrizität mehr Vor- als Nachteile, dennoch will man sich - schon aus Prinzip - nicht vom gefüllten Futtertrog des Monopols nicht vertreiben lassen.
»Es ist inakzeptabel, dass irgendein zweifelhafter Wettbewerber das Recht der Gasgesellschaften verletzt, Straßen und Häuser zu beleuchten. Denn das ist allein ihr Vorrecht, aus Tradition und aus Prinzip.«
Meine Meinung:
Alexander Bartl versteht es sehr gut, die Forschungen von Thomas Alva Edison und seinen Mitarbeitern darzustellen. Er verschweigt auch nicht, dass Edison ein manchmal schwieriger Mensch war. Die technischen Details, die dem elektrischen Strom zum Sieg über das Leuchtgas verhelfen, sind gut beschrieben. Ebenso können sich die Leser ein Bild von den gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen der Umstellung auf elektrische Beleuchtung machen. Natürlich wird es noch Jahrzehnte dauern, bis die Elektrizität im kleinsten Winkel der Welt angekommen ist. Es ist faszinierend zu erfahren, welche Vorbehalte die Menschen damals der Elektrifizierung gegenüber hatten. Gleichzeitig war man aber von dieser neuen Erfindung so fasziniert, dass es zum guten Ton gehört hat, Strom-Partys zu veranstalten.
Wir erfahren, dass Thomas Alva Edison und George Westinghouse, ein weiterer Strompionier, erbittert um die Antwort auf die Frage, ob „Gleichstrom“ oder „Wechselstrom“ sicherer sei, kämpften. Edisons Mitarbeiter Harold Brown hat sogar einen elektrischen Stuhl konstruiert, der zunächst als „Party-Gag“ verwendet worden ist. Recht bald (1889) hat er als „humanes“ Vollzugsinstrument der Todesstrafe in Amerika seine Verwendung gefunden.
Wie schon zuvor das Buch „Walzer in Zeiten der Cholera“ ist auch dieses hier akribisch recherchiert. So erhalten wir Einblick in das künstlerische Schaffen des Franz Jauner, seines Zeichens Direktor des Carlstheater in der Leopoldstadt und späterer Direktor des Ringtheaters.
Die historischen Fakten sind geschickt mit den technischen Details verknüpft. Auszüge aus Zeitungsberichten und/oder Korrespondenz vervollständigen das lebendige Bild dieser Zeit wie dieses Zitat aus „Der Bautechniker“ vom 2. März 1883 zeigt.
»Die Gasgesellschaften bringen nämlich den Verlust, den ihnen das vordringende elektrische Licht verursacht, dadurch wieder herein, daß sie das Gas in erhöhtem Masse zu Heizzwecken verwenden. Durch diesen Anstoss ist übrigens eine solche Zahl nützlicher Heizapparate construirt worden, daß sich auch in dieser Richtung eine neue Aera eröffnet, indem nämlich in der Zukunft immer mehr die Heizung der Herde, ja sogar der Oefen mittelst Gases bewerkstelligt werden wird.«
Man sieht, die Inhaber der Gasgesellschaften sind keine Sozialfälle geworden.
Schmunzeln musste ich, als sich ausgerechnet Brünn, das damals als „Manchester von Mähren“ mit der Auszeichnung, das erste vollständig elektrische Theater zu haben, schmücken durfte. Paris, Wien, Berlin oder München - alle wurden sie vom Stadttheater Brünn, das sein ebenfalls im Jahr 1881 abgebranntes Theater durch einen Neubau ersetzen ließ, ausgestochen.
Ergänzt wird das Buch durch kurze Lebensläufe jener Personen, die bei der Verwirklichung des elektrischen Traums maßgeblich mitgewirkt haben bzw. davon betroffen waren.
Fazit:
Gerne gebe ich dieser fesselnd erzählten Geschichte rund um den „elektrischen Traum und der Gesellschaft unter Strom“ 5 Sterne und eine Leseempfehlung.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für