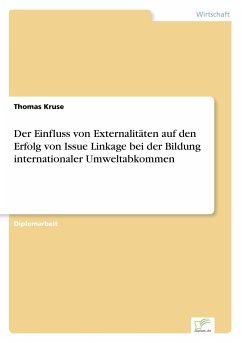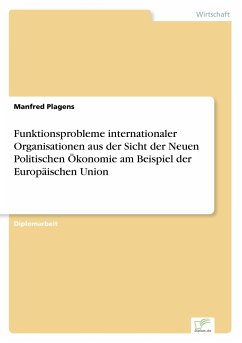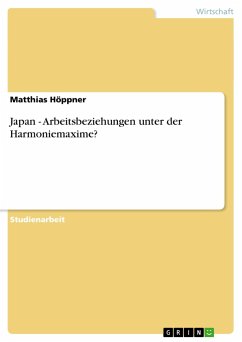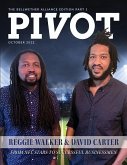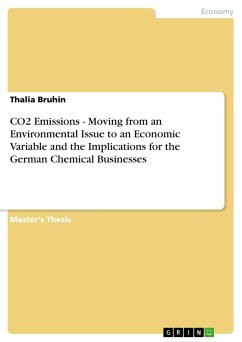Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Note: 1,0, FernUniversität Hagen (Wirtschaftswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:
Aufgrund der in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer offener zu Tage tretenden globalen Umweltschäden, verursacht durch die zunehmende Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden durch eine immer weiter wachsende Weltwirtschaft und zunehmende Industrialisierung auch in Entwicklungsländern, nimmt die Bedeutung erfolgreicher internationaler Umweltabkommen, die zu einer deutlichen Entlastung der Umwelt führen, immer weiter zu.
Der Verursacherstaat einer global umweltbelastenden Aktivität verursacht nicht nur in seinem Land Schäden, sondern auch in anderen Staaten, die er aber bei der Entscheidung über sein Emissionsniveau nicht berücksichtigt. Wegen dieser Externalitäten führen die Emissionsentscheidungen der einzelnen Staaten nicht zu einem globalen Optimum im Spannungsfeld zwischen den Kosten der Umweltschäden einerseits und den Vorteilen umweltbelastender Aktivitäten andererseits, sondern zu einer übermäßigen Belastung und Zerstörung der Ressource Umwelt.
Durch internationale Umweltkooperation kann eine Internalisierung der externen Effekte erreicht werden, die zu einer Emissionsreduktion und damit zu einer Erhöhung der globalen Wohlfahrt führt. Dabei bilden die kooperationsbereiten Staaten eine Koalition und verpflichten sich in einem internationalen Umweltabkommen (engl.: International Environmental Agreement, IEA) zu einer Reduktion ihrer umweltbelastenden Aktivität. Bekannte Beispiele für internationale Umweltabkommen in der Realität sind das Montreal Abkommen von 1987 zur Reduktion von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) und das Kyoto Protokoll von 1997 zur Reduktion von Treibhausgasen.
Häufig lassen sich jedoch entweder Umweltabkommen mit einer großen Anzahl beteiligter Staaten, aber nur geringen Verringerungsverpflichtungen, oder Umweltabkommen mit ehrgeizigen Verpflichtungen, aber nur geringer Beteiligung beobachten. Diese Tatsache weist darauf hin, dass sich die Umsetzung der internationalen Umweltzusammenarbeit mit erheblichen Problemen konfrontiert sieht, die durch Abbildung der Realität in einem abstrahierenden Modell einer wirtschaftstheoretischen Analyse zugänglich gemacht werden können.
Zwei dieser Probleme seien hier näher betrachtet: Erstens muss die Beteiligung an einem Umweltabkommen für alle Staaten profitabel sein, d. h. ihre individuelle Wohlfahrt muss sich durch die Beteiligung an dem Abkommen erhöhen. Geht man in der Modellwelt von symmetrischen Ländern aus, d. h. von Ländern, die ihre Grenzschäden gleich einschätzen und gleiche Grenzvermeidungskosten haben, ist dieses Problem in der Regel lösbar, denn jedes Land profitiert im Falle des Zustandekommens des Abkommens nicht nur von seiner eigenen Emissionsreduktion, für die ihm entsprechende Kosten entstehen, sondern auch kostenlos von derEmissionsreduktion aller anderen beteiligten Länder. Tatsächlich bestehen jedoch zwischen den Regionen der Welt große ökonomische und ökologische Assymmetrien, so dass viele Länder, z. B. aus der dritten Welt, die Kosten von Emissionsreduktionen höher bewerten und die Vorteile aus der Umweltverbesserung geringer schätzen als andere Länder, z. B. die meisten Industrieländer. Zweitens muss ein internationales Umweltabkommen selbstdurchsetzend sein, d. h. die betroffenen Länder müssen bereit sein, die in dem Umweltabkommen enthaltenen Verpflichtungen umzusetzen und einzuhalten.
Es gibt im inter-nationalen Bereich keine übergeordnete Institution, die Staaten dazu zwingen kann, sich an einem für sie profitablen Umweltabkommen zu beteiligen und die Emissionsziele einzuhalten. Vielmehr besteht ein Freifahreranreiz selbst dann, wenn das Abkommen für alle Länder profitabel ist: Durch die Umweltkooperation lässt...
Aufgrund der in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer offener zu Tage tretenden globalen Umweltschäden, verursacht durch die zunehmende Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden durch eine immer weiter wachsende Weltwirtschaft und zunehmende Industrialisierung auch in Entwicklungsländern, nimmt die Bedeutung erfolgreicher internationaler Umweltabkommen, die zu einer deutlichen Entlastung der Umwelt führen, immer weiter zu.
Der Verursacherstaat einer global umweltbelastenden Aktivität verursacht nicht nur in seinem Land Schäden, sondern auch in anderen Staaten, die er aber bei der Entscheidung über sein Emissionsniveau nicht berücksichtigt. Wegen dieser Externalitäten führen die Emissionsentscheidungen der einzelnen Staaten nicht zu einem globalen Optimum im Spannungsfeld zwischen den Kosten der Umweltschäden einerseits und den Vorteilen umweltbelastender Aktivitäten andererseits, sondern zu einer übermäßigen Belastung und Zerstörung der Ressource Umwelt.
Durch internationale Umweltkooperation kann eine Internalisierung der externen Effekte erreicht werden, die zu einer Emissionsreduktion und damit zu einer Erhöhung der globalen Wohlfahrt führt. Dabei bilden die kooperationsbereiten Staaten eine Koalition und verpflichten sich in einem internationalen Umweltabkommen (engl.: International Environmental Agreement, IEA) zu einer Reduktion ihrer umweltbelastenden Aktivität. Bekannte Beispiele für internationale Umweltabkommen in der Realität sind das Montreal Abkommen von 1987 zur Reduktion von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) und das Kyoto Protokoll von 1997 zur Reduktion von Treibhausgasen.
Häufig lassen sich jedoch entweder Umweltabkommen mit einer großen Anzahl beteiligter Staaten, aber nur geringen Verringerungsverpflichtungen, oder Umweltabkommen mit ehrgeizigen Verpflichtungen, aber nur geringer Beteiligung beobachten. Diese Tatsache weist darauf hin, dass sich die Umsetzung der internationalen Umweltzusammenarbeit mit erheblichen Problemen konfrontiert sieht, die durch Abbildung der Realität in einem abstrahierenden Modell einer wirtschaftstheoretischen Analyse zugänglich gemacht werden können.
Zwei dieser Probleme seien hier näher betrachtet: Erstens muss die Beteiligung an einem Umweltabkommen für alle Staaten profitabel sein, d. h. ihre individuelle Wohlfahrt muss sich durch die Beteiligung an dem Abkommen erhöhen. Geht man in der Modellwelt von symmetrischen Ländern aus, d. h. von Ländern, die ihre Grenzschäden gleich einschätzen und gleiche Grenzvermeidungskosten haben, ist dieses Problem in der Regel lösbar, denn jedes Land profitiert im Falle des Zustandekommens des Abkommens nicht nur von seiner eigenen Emissionsreduktion, für die ihm entsprechende Kosten entstehen, sondern auch kostenlos von derEmissionsreduktion aller anderen beteiligten Länder. Tatsächlich bestehen jedoch zwischen den Regionen der Welt große ökonomische und ökologische Assymmetrien, so dass viele Länder, z. B. aus der dritten Welt, die Kosten von Emissionsreduktionen höher bewerten und die Vorteile aus der Umweltverbesserung geringer schätzen als andere Länder, z. B. die meisten Industrieländer. Zweitens muss ein internationales Umweltabkommen selbstdurchsetzend sein, d. h. die betroffenen Länder müssen bereit sein, die in dem Umweltabkommen enthaltenen Verpflichtungen umzusetzen und einzuhalten.
Es gibt im inter-nationalen Bereich keine übergeordnete Institution, die Staaten dazu zwingen kann, sich an einem für sie profitablen Umweltabkommen zu beteiligen und die Emissionsziele einzuhalten. Vielmehr besteht ein Freifahreranreiz selbst dann, wenn das Abkommen für alle Länder profitabel ist: Durch die Umweltkooperation lässt...