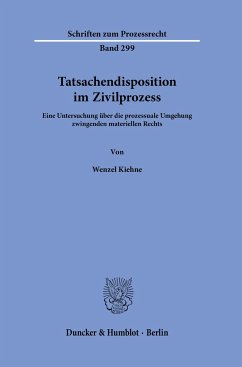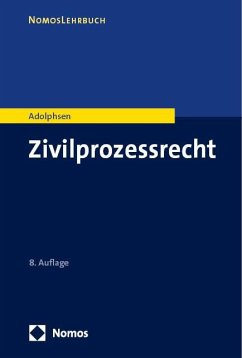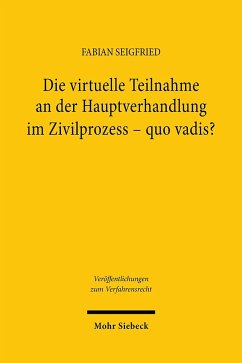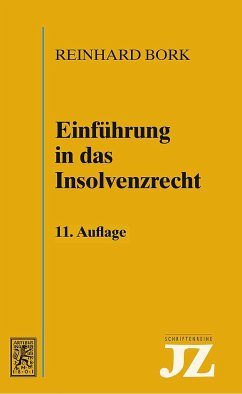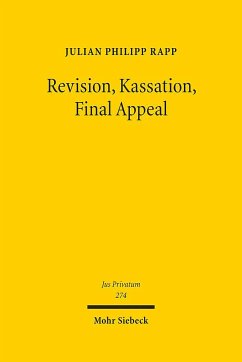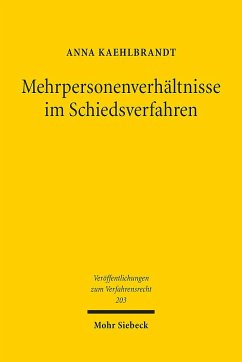aufzudrücken. Um das zu verhindern, sind Institutionen entscheidend, also Regeln. "Der Preismechanismus der Wettbewerbswirtschaft ist die zentrale inklusive Institution", meint der Frankfurter Jurist Alexander Morell. "Aber seine Macht erzeugt zugleich den starken Anreiz, sich ihm so weit wie möglich zu entziehen."
Wer eigene Kosten anderen aufbürdet, produziert günstiger und setzt sich am Markt durch. Eine naheliegende Gegenwehr ist das Recht. Das Recht kann Bürger aber nur dann schützen, wenn sich der Sachverhalt aufklären lässt. Der Staat kann seine Augen nicht immer überall haben, das hat der Fall Wirecard gezeigt. Wer Ausplünderung verhindern will, muss zunächst davon erfahren. Informationen darüber sind oft dezentral unter den Betroffenen verteilt. Das Potential, diese Informationsschnipsel zusammenzuführen, hat der Zivilprozess. Allerdings gilt nach Meinung vieler Juristen der Grundsatz "nemo tenetur": Der Beklagte muss nicht zu seinem Prozessverlust beitragen. Manche nennen das Ausforschungsverbot. Doch ein Schweigerecht gibt es in Wahrheit gar nicht, klärt Morell auf.
Volkswagen weiß, was der Vorstand im Dieselskandal wusste. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY weiß, warum man im Falle Wirecard das Fehlen von Milliarden übersehen hat. Ein Kartellbeschuldigter weiß, welche Information er mit dem Wettbewerber ausgetauscht hat. Doch oft wird geschwiegen. Was soll ein Richter im Zivilprozess also tun? Morells Lösung ist das sogenannte "Grossman'sche Schließen". Die Ökonomen Sanford Grossman und Paul Milgrom haben je in einem Papier aus dem Jahr 1981 unabhängig voneinander die Lösung herausgearbeitet. Beide fragten sich: Unter welchen Umständen kann ein uninformierter Entscheider so auf die Information eines schweigsamen Informanten zugreifen, als verfüge er selbst über die Information? Ergebnis: Der Entscheider wertet jede Unsicherheit, die der Informant belässt, maximal zulasten des Informanten. "Dadurch erhält der Informant einen Anreiz, jede Unsicherheit zu beseitigen, indem er alle Informationen vorlegt, es sei denn, seine Information ist ihm selbst so ungünstig, wie der Entscheider unterstellt. Bleibt er passiv, weiß der Entscheider, dass die Sachlage tatsächlich für den Informanten maximal ungünstig ist." Für den Zivilprozess klingt die Idee überzeugend. Doch ist dieses Vorgehen eine unzulässige Beweislastumkehr? Nein, beschwichtigt Morell: Eine Beweislast finde Anwendung, wenn der Sachverhalt nicht aufgeklärt wird. Bei "Grossman'schem Schließen" werde der Sachverhalt aber aufgeklärt.
Nun gibt es trotzdem drei Probleme. Erstes Problem: Verstößt all das gegen den Grundsatz "nemo tenetur"? Morell meint: Das Zivilrecht darf den Zweck der Verhütung von Unrecht verfolgen. Die Zivilprozessordnung legt fest, dass sich beide Parteien vollständig und wahrheitsgemäß erklären müssen. "Das ist mit einem Schweigerecht unvereinbar", schreibt Morell.
Zweites Problem: Was tun, wenn der Informant nur deshalb eine Unsicherheit zulässt, weil er keine Beweismittel hat? Oder weil die Vorlage der Beweismittel mehr kosten würde als ein Prozessverlust? Dann ist die Nichtvorlage zwar immer noch informativ, aber nur ein Indiz. Sie kann nicht mehr zweifelsfrei auf das Zutreffen der Annahme eines Richters schließen. Und jetzt wird es "nachhaltig kompliziert", schreibt Morell. Tatsache ist, dass ein Richter gar nicht genau weiß, was für den Informanten nachteilig wäre. Vielleicht weiß es der Informant nicht einmal selbst. Morell ist entspannt: "Diese Komplikation wird selten auftreten." Das ist ein brauchbares Argument. Eine Regel muss nicht auf jeden unwahrscheinlichen Fall passen, sondern in der Gesamtheit bessere Ergebnisse erzielen als der derzeitige Zustand.
Drittes Problem: Was tun, wenn jemand vor Gericht lügt? Morells Modell schließt Lügen per se aus. Das schränkt die Verallgemeinerbarkeit ein. Lügen bedeutet das Fälschen von Beweisen. Allerdings kompromittiert die Möglichkeit, Beweise zu fälschen, die Beweisbarkeit insgesamt. Wenn jedes Beweismittel gefälscht sein könnte, beweist auch das richtige Beweismittel nichts mehr. Beweise werden dann unmöglich. Wenn Lügen möglich sind, führt der Vereinigungsmechanismus nicht mehr zur Wahrheit, und zutreffendes Grossman'sches Schließen wäre unmöglich.
Fazit: Morells Buch zeigt auf, wie man auf kluge Weise im heutigen System des Zivilprozessrechts gegen Korruption und Kartellierung vorgehen kann, ohne die Privatautonomie zu beeinträchtigen. Ein großer Wurf und ein Buch, das auf den Tisch jedes Richters gehört, denn diese könnten eine solche Lösung sofort implementieren. Auch Justizminister Marco Buschmann sollte einen Blick hineinwerfen. JOCHEN ZENTHÖFER
Alexander Morell: Der Beibringungsgrundsatz, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, 346 Seiten, 109 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
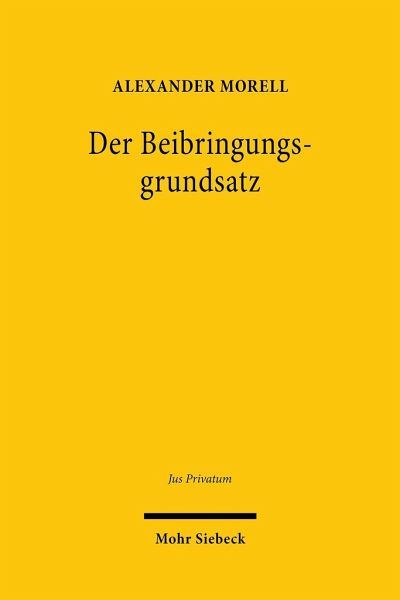




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.01.2023
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.01.2023