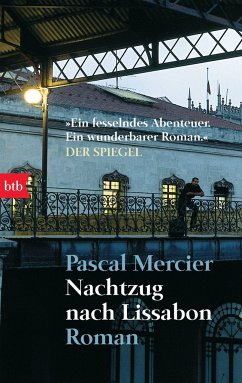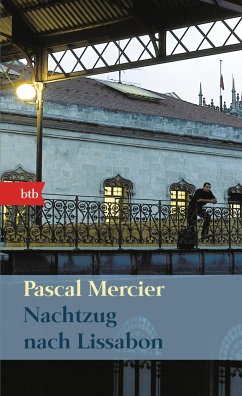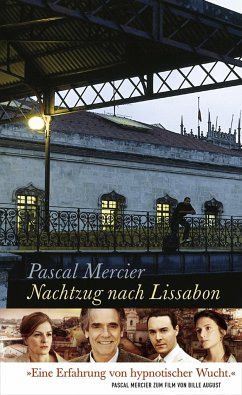Arbeit, auf dem Meditationsstein unter dem schwarzen Maulbeerbaum, weitab vom Zentrum der Zeit.
Das "Zentrum" ist die Mitte der schönen neuen Welt, für die Konsumenten ein Paradies, für Arbeiter und Lieferanten eine Hölle. Der festungsartige Block liegt, 48 Stockwerke hoch und zehn tief, inmitten von Müllhalden, Industriebrachen und gesichtslosen Vorortsiedlungen: eine hybride Kreuzung aus Einkaufszentrum und Wohnsilo, Vergnügungspark und Gefängnis, Kirche und KZ. In diesem Turm von Babel stehen die Schrecken des Totalitarismus gleich neben den Simulationen und babylonischen Versprechungen des globalen Neoliberalismus. Hier werden alle Sprachen verstanden und alle Träume wahr, solange die Kauf- und Arbeitskraft des Publikums zureicht und seine Bedürfnisse sich dem Markt fügen. Hunde, persönliche Gebrauchsgegenstände und Erinnerungen zum Beispiel sind unerwünscht.
Der vierundsechzigjährige Cipriano Algor beliefert das Zentrum mit selbstgebranntem Tongeschirr. Mehr als den Hintereingang hat er von diesem hermetisch und hygienisch versiegelten kafkaesken Schloß mit seinen undurchsichtigen Hierarchien und mysteriösen Werbebotschaften nie gesehen. Als man seine Töpferwaren nicht mehr abnimmt, vergräbt Cipriano sie in der Natur; den letzten Topf schenkt er der Witwe Isaura. Cipriano hadert nicht lange mit seinem Schicksal; darin gleicht er, mehr listiger Dulder als leidender Hiob, seinem treuen, klugen Hund Achado, einem Vetter von Berganza und Odysseus' Argos. Herr und Hund wissen, daß die Zeit über sie hinweggeht; allein, ein alter Mann ist kein biegsamer Welpe mehr. Sein Versuch, zusammen mit der Tochter Marta einen Handel mit handgefertigten Tonfiguren aufzuziehen, scheitert. Die Einkaufsleiter sind keine Monster, aber ihre kapitalistische Ethik ist unerbittlich: Gebraucht wird nur, was sich verkaufen läßt, und die Kundschaft zieht nun mal Plastikgeschirr der zerbrechlichen, schwerfälligen Keramik vor. Cipriano zieht mit Tochter und Schwiegersohn ins Zentrum, wo Marçal, der pflichteifrige Wachmann zweiter Klasse, eine Dienstwohnung zugeteilt bekommen hat. Aber der alte Mann sehnt sich nach seinem Hund, seinem Maulbeerbaum und Isaura. Und weil man etwas Besseres als den Tod überall findet, bricht am Ende die ganze Familie in ihrem klapprigen Lieferwagen auf, um das Glück im Nirgendwo, die Zukunft in der Erinnerung zu suchen: "Es ist nie zu spät, einen Fehler zu korrigieren."
Saramago erzählt diese einfache Geschichte mit einfachen Mitteln. Es gibt in diesem Roman wenig Beschreibungen oder Wortspiele und so gut wie keine Psychologie, dafür jede Menge Spruchweisheiten ohne Verfallsdatum ("Spiel nicht mit deinem Herrn um die Birnen, denn er ißt die reifen und gibt dir die grünen"), umständliche Erörterungen, bedächtige Grübeleien und Gespräche unter Freunden. Die Wörter sind "nur Steine, mit deren Hilfe man einen reißenden Fluß überqueren kann, sie sind nur dazu, daß wir ans andere Ufer gelangen". Der Kommunist Saramago macht keinen Hehl daraus, daß er "aus dem Blickwinkel einer offenen Klassensympathie" schreibt. Er teilt Ciprianos Abneigung gegen die Charaktermasken, zynischen Slogans und Schwindelgeschäfte des Kapitalismus. Aber sein anachronistisches Idyll ist so redlich und unparteiisch komponiert, so handwerklich sorgfältig und weise lächelnd beschrieben, daß kein Ton zu Bruch geht und keiner falsch klingt. Der sinnliche Gebrauchswert, die unentfremdete Arbeit ist für Saramago wertvoller als die Abstraktionen von Tauschwert und Geld. Die Hand, soviel dialektischer Materialismus muß sein, ist klüger als der Kopf, und nur durch Arbeit gewinnt das Subjekt eine Erkenntnis, die mehr ist als "moderne Ignoranz".
Saramagos menschenfreundlicher Erzähler ist klüger als seine schlichten Handarbeiter, aber er macht von seiner Allwissenheit nur sanft ironisch ("wie man bereits erraten haben dürfte") Gebrauch. Seine Sprüche sind schulterklopfende Allerweltsweisheiten und Aufmunterungen, und wenn sich Isaura und Cipriano zum märchenhaften Happy-End finden, blendet er sich diskret aus: "Es gibt Momente im Leben, da muß man eine Tür schließen, damit der Himmel sich öffnet." Öffnet man die Geheimtüren im Keller des Einkaufsbunkers, begegnet man dagegen den bösen Geistern von Platos Höhlengleichnis. In den unzugänglichen, streng bewachten Katakomben liegen mumifizierte Leichen, die, an ihre Meditationsbank gefesselt, noch im Tod die nackten Wände betrachten, auf denen die Götter des Zentrums ihre Trugbilder und Illusionen projizierten. Cipriano erkennt sich in diesen Zerrbildern schaudernd wieder. "Ein gar wunderliches Bild stellst du dar", heißt das platonische Motto des Romans. "Und wunderliche Gefangene. Uns ganz ähnliche." So ist "Das Zentrum" nicht nur dem Stoff, sondern auch seiner Sprache und Erzählstruktur nach der Aufstand einer unzeitgemäßen, "herzzerreißenden Nutzlosigkeit" gegen die praktischen Zwecke und todbringenden Schattenbilder, die der Warenfetisch seinen blinden Götzendienern und gefesselten Sklaven vorgaukelt: ein "Memorial" der Konsumgesellschaft.
Der Mensch ist nach allem, was wir aus den Mythen wissen, aus Lehm erschaffen worden, und das gilt auch für diese Schöpfungsgeschichte eines Töpfergotts. Saramago nimmt Schlamm von heimischer Erde und knetet ihn gewissenhaft, liebevoll, fast andächtig zu Golems und Menschen. Er brennt seine Sinnbilder und Figuren im Ofen der Phantasie, trocknet sie in der Sonne, trägt sparsam Farbe auf und haucht ihnen zärtlich seinen Lebensodem ein. Wie sein Alter ego Cipriano trägt der Achtzigjährige weder seine Geschöpfe noch seine Haut zu Markte. Das unterscheidet ihn wohltuend von den Großfabrikanten, Marktschreiern und Vertriebsprofis der Literaturindustrie: "Das Zentrum" bietet keine Wegwerfwaren feil, sondern das altmodisch solide, handgemachte Sozialmärchen eines göttlichen Handwerkers.
José Saramago: "Das Zentrum". Roman. Aus dem Portugiesischen übersetzt von Marianne Gareis. Rowohlt Verlag, Reinbek 2002. 396 S., geb., 22,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
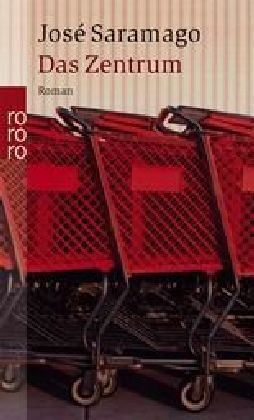





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.06.2002
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.06.2002