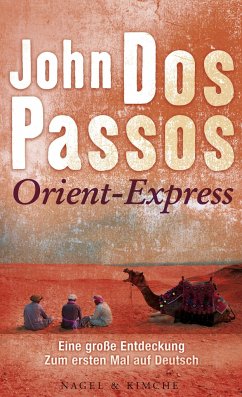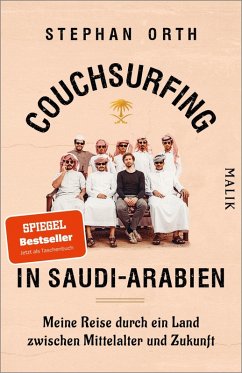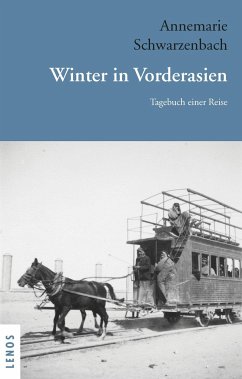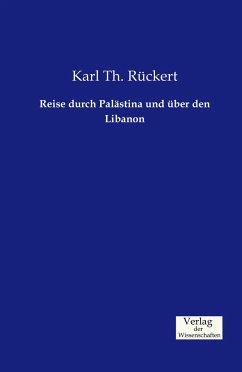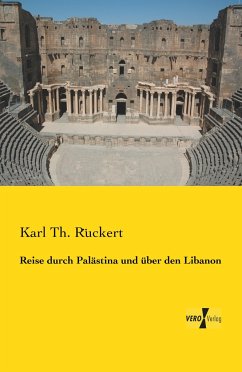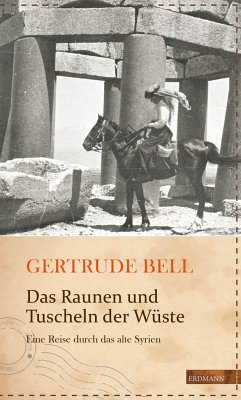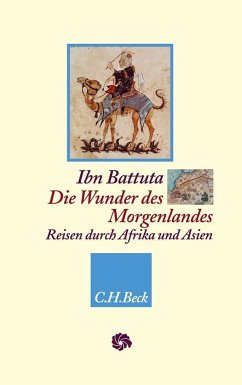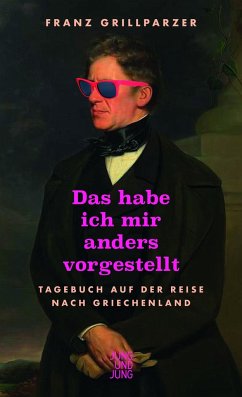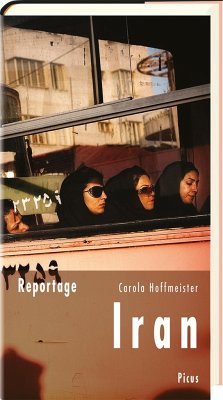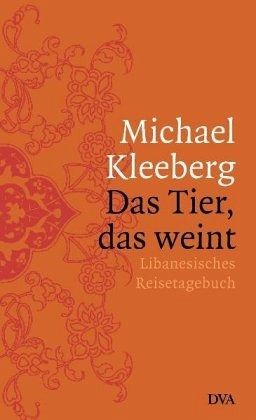
Das Tier, das weint
Libanesisches Reisetagebuch

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
»Dieses Buch enthält persönliche Reiseaufzeichnungen, Gedanken, Erinnerungen und Abschweifungen«, beginnt Michael Kleeberg sein Libanesisches Reisetagebuch. Vier Wochen war er Anfang 2003 zu Gast in Beirut. Durch Abbas Beydoun, einen der wichtigsten libanesischen Schriftsteller, bekommt er Einblicke in das Leben in dieser »weißen Stadt« - »alles ist hier Spiel von Licht und Schatten«. Er führt Gespräche über Islam, den Westen, über Literatur und Film. Zwei Frauen erzählen ihm, wie sie im Bürgerkrieg überlebt haben. Das Tal des Adonis tut sich uns in seiner Erzählung auf, und w...
»Dieses Buch enthält persönliche Reiseaufzeichnungen, Gedanken, Erinnerungen und Abschweifungen«, beginnt Michael Kleeberg sein Libanesisches Reisetagebuch. Vier Wochen war er Anfang 2003 zu Gast in Beirut. Durch Abbas Beydoun, einen der wichtigsten libanesischen Schriftsteller, bekommt er Einblicke in das Leben in dieser »weißen Stadt« - »alles ist hier Spiel von Licht und Schatten«. Er führt Gespräche über Islam, den Westen, über Literatur und Film. Zwei Frauen erzählen ihm, wie sie im Bürgerkrieg überlebt haben. Das Tal des Adonis tut sich uns in seiner Erzählung auf, und wir bekommen Appetit auf das Essen, duftend nach tausend Gewürzen. Doch Kleeberg schreibt auch mit Humor über sich, seine Tochter, seine Arbeit und über die Katzen in Beirut.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Entdecke weitere interessante Produkte
Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote