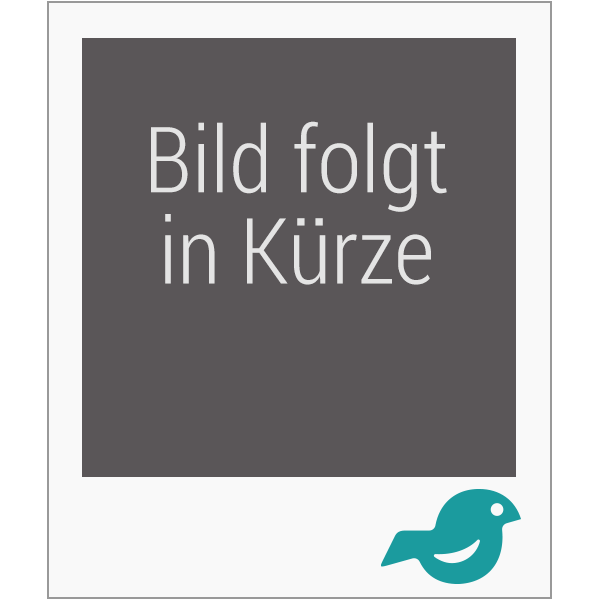Was hat die Menschen der jüngeren Steinzeit ab Mitte des 5. Jahrtausends v. Chr. bewogen, tonnenschwere und bis zu 21 Meter hohe Steinmale, die Menhire oder Hinkelsteine, zu errichten? Wie schaffte man es, diese Kolosse zu transportieren und aufzustellen? Welchen Zweck hatten die meistens freistehend, einzeln, in Kreisen oder manchmal sogar zu tausenden in Reihen angeordneten Kolosse? Mit solchen Fragen befasst sich der Mainzer Archäologe Dr. Detert Zylmann in seinem Buch Das Rätsel der Menhire. Obwohl Wissenschaftler sie sorgfältig untersuchten und mancherlei Fantasten glaubten, das Rätsel um diese Steine gelöst zu haben, blieben die Menhire bis heute von Geheimnissen umwittert. Unbestritten ist nur, dass sie eine kultisch-religiöse Funktion hatten. Vielleicht dienten diese eindrucksvollen Steinmale einst als Götteridole, phallische Kultdenkmäler, Opferpfähle, Gerichtsstätten, Ahnenkultmale, Ruhesitze für umherschwebende Seelen oder als Ersatzleiber Verstorbener, an denen die Hinterbliebenen Abschied nehmen konnten. Über Jahrtausende hinweg - von der Steinzeit bis in die Gegenwart - zogen Menhire immer wieder Menschen in ihren Bann. Einige der mysteriösen Steinmale konnten sich angeblich zu hohen Feiertagen drehen oder sie gaben Weh- und Klagelaute von sich, wenn jemand sein Ohr an sie legte. Von anderen erhofften sich Abergläubische durch ihre Berührung einen segensreichen Einfluss auf die Liebe und den Kindersegen oder die Heilung von Krankheiten. Menhire hat man zu unterschiedlichen Zeiten in Europa, Asien, Afrika und Amerika aufgestellt. Besonders eindrucksvoll wirken die Menhir-Alleen von Menec, Kermario und Kerlescan im französischen Departement Morbihan auf Betrachter. In Deutschland können die letzten steinernen Zeugen eines unbekannten prähistorischen Kultes in Baden-Württemberg, im Saarland, in Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und mecklenburg-Vorpommern bewundert werden.

Obelix, der römerprügelnde Gallier, hat dem Hinkelstein zu ungeahnter Popularität verholfen. Warum die Menschen schon seit Mitte des 5. Jahrtausends vor Christus tonnenschwere, bis zu 21 Meter hohe Steinmale meistens frei stehend, einzeln, in Kreisen oder sogar zu Tausenden in Reihen angeordnet aufgestellt haben, ist bis heute ungeklärt. Auch weiß niemand so genau, wie die Kolosse transportiert wurden - mit Obelixschem Weitwurf jedenfalls nicht. Der Archäologe Detert Zylmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Archäologischen Denkmalpflege in Mainz, geht jetzt in seinem Buch "Das Rätsel der Menhire" solchen Fragen nach.
Die Annäherung an die geheimnisumwitterten Steine geschieht in 14 Abschnitten, die sich zunächst unter anderem mit der Gewinnung des Baumaterials, dem Transport und dem Aufrichten der Menhire beschäftigen, um dann deren Bedeutung in Glauben, Brauchtum, Sagen und Legenden zu beleuchten. Natürlich kommt Zylmann dabei immer wieder auf "Klassiker" wie das englische Stonehenge oder das französische Carnac zu sprechen.
Der Reiz des schmalen Bandes besteht aber nicht zuletzt darin, daß er auch Exemplare in Deutschland einbezieht, die am Ende gar, nach Bundesländern geordnet, aufgelistet sind, um den Leser auf naheliegendes "Anschauungsmaterial" aufmerksam zu machen - zumal die ursprüngliche Bedeutung der Steine nicht in allen Fällen mehr auf den ersten Blick erkennbar ist. Beim höchsten Menhir Hessens, dem "Langen Stein" von Kirchhain-Langenstein im Kreis Marburg-Biedenkopf, mag das noch angehen, auch wenn er längst in die Kirchhofsmauer einbezogen ist. Andernorts war die "Christianisierung" gründlicher, wie etwa beim "Langen Stein" im rheinhessischen Ober-Saulheim, bei dem man im oberen Drittel in der Spätgotik eine Nische für ein Heiligenbild einmeißelte.
Daß Menhire nicht nur für Comics taugen - auch wenn sie, historisch betrachtet, in der Zeit von Asterix und Obelix längst Antiquitäten waren -, sondern zu allen Zeiten auch Kunst-Gegenstände sind, zeigt Zylmann am Ende mit einem Streifzug durch Malerei und bildende Kunst. Er beginnt bei einer Buchillustration des 14. Jahrhunderts, die den Zauberer Merlin beim Aufrichten der Steine von Stonehenge zeigt, und reicht über John Constable und Caspar David Friedrich bis hin zur Verarbeitung "primitiver Kunstleistungen" in der Moderne.
Ein kleines Glossar erleichtert mit der Erläuterung von Begriffen wie Hallstatt-Zeit und Bandkeramik nicht nur die zeitliche Orientierung, sondern macht den Band auch zur allgemeinverständlichen Lektüre.
ULRICH ADOLPHS
Detert Zylmann, Das Rätsel der Menhire. Mainz. Verlag Ernst Probst. 128 Seiten, zahlreiche Abbildungen. 13 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main