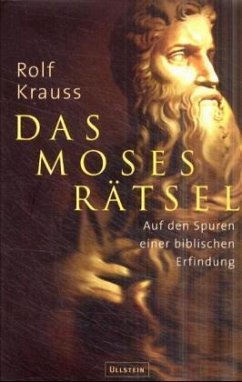Produktdetails
- Verlag: Ullstein HC
- Seitenzahl: 351
- Abmessung: 34mm x 142mm x 221mm
- Gewicht: 584g
- ISBN-13: 9783550071720
- ISBN-10: 3550071728
- Artikelnr.: 09891730

Der die Quellen quält: Auf der Piste der Sensationsschreiberei möchte Rolf Krauss den historischen Moses als Pharao auffliegen lassen
Rolf Krauss hat sich als Ägyptologe durch seine Forschungen zur ägyptischen Geschichte, Astronomie und Zeitrechnung einen Namen gemacht. Besondere Verdienste hat er sich um den bis dahin obskuren Pharao Amenmesse (beziehungsweise Amunmasesa) erworben. Er konnte wahrscheinlich machen, daß es sich hier um den Vizekönig von Kusch namens Messui (oder Masesaja) handelt, der innerhalb der Regierungszeit von Sethos II. am Ausgang des dreizehnten Jahrhunderts vor Christus den Thron für vier Jahre usurpiert und als Pharao in Oberägypten geherrscht hat.
Nachdem Krauss diese durchaus bemerkenswerten Entdeckungen in drei gelehrten Aufsätzen seinen Kollegen in einer angesehenen Fachzeitschrift unterbreitet hat, kam ihm der Einfall, diesen Pharao einer breiteren Öffentlichkeit als den historischen Mose zu präsentieren. Er wird wohl kaum selbst ernsthaft an diese Gleichsetzung glauben, sonst hätte er sie zumindest in dem letzten der genannten Aufsätze mit einem Wort erwähnt, denn es ist ja auch für die fachägyptologische Einschätzung dieser Figur der ägyptischen Geschichte nicht ganz unerheblich, daß sie nach ihrer ägyptischen Karriere zur Gründerfigur des biblischen Monotheismus geworden ist.
Krauss verfährt jedoch strikt zweigleisig: er publiziert als Ägyptologe und als wissenschaftlicher Sensationsschriftsteller; er hält diese Diskurse auseinander, und so darf auch der Leser sie auseinanderhalten. Hier hat er es nun mit einem Produkt der zweiten Art zu tun, aus einem Gebiet, das der science fiction nahesteht und das uns schon zahlreiche ägyptische Prätendenten für den historischen Mose geliefert hat. Wir dürfen uns der Pflicht enthoben fühlen, das Buch ganz ernst zu nehmen, um mit desto größerem Vergnügen die überraschenden Zusammenhänge zur Kenntnis zu nehmen, die es in seiner ungewöhnlichen Beleuchtung sichtbar macht. Denn wer den Pharao Amunmasesa zum biblischen Mose erklären will, muß die überlieferten Quellen gehörig gegen den Strich lesen, vor allem aber muß er diese Quellen selbst vollkommen umwerten. Was bisher im Zentrum stand, das biblische Zeugnis, gerät ins Abseits, und was bisher im Dunkel einer apokryphen Folklore lag, die spätantiken und mittelalterlichen Mose-Legenden, tritt ins Zentrum.
Aber nicht nur mit dem biblischen Zeugnis, das als märchenhafte Dichtung abgetan und außerdem spät datiert wird, so spät, daß es kaum noch chronologischen Vorrang vor den anderen Quellen beanspruchen darf, geht Krauss streng ins Gericht, sondern auch mit Quellen wie dem ägyptischen Autor Manetho, der in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts vor Christus vom Exodus der Juden gehandelt haben soll (so hatte ihn wenigstens der jüdische Historiker Josephus Flavius verstanden). Das soll nun eine Fälschung sein. So schafft sich Krauss eine tabula rasa, auf der er seine eigenen Gewährsleute auffahren kann. Das sind jene Legenden, die Mose zu einem ägyptischen Prinzen, ja Thronprätendenten oder Konkurrenten machen und die von einem zehnjährigen Feldzug nach Äthiopien wissen. Das paßt sehr gut zum Vizekönig von Nubien (Äthiopien), Masesaja, der sich zum König aufschwang. Aber auch zum biblischen Mose gibt es eine verblüffende Parallele, die sich Krauss in diesem Fall denn doch nicht entgehen läßt: der Ahnenverlust. Sowohl Mose wie Amunmasesa haben eine Mutter, die einen Enkel ihres Vaters zum Manne hat. Krauss stellt nicht weniger als fünfzehn derartige "Parallelen" zusammen. Bewiesen wird damit nichts, aber es ist amüsant.
Was soll nun aber einen gestürzten ägyptischen Usurpator dazu bewogen haben, sich zum Führer einer Gruppe hebräischer Sklaven zu machen? Diese Sklaven und ihren Auszug hat es nach Krauss nie gegeben! Wir haben es hier, Krauss zufolge, mit Erfindungen aus nachexilischer Zeit zu tun. So muß die Frage lauten: Was konnte einen jüdischen Autor der Perserzeit auf den Gedanken bringen, dem ägyptischen Prinzen Masesaja den Auszug aus Ägypten und die Stiftung der monotheistischen Religion anzudichten? Wieso haben sich ausgerechnet in Judaea, nicht aber in Ägypten, Legenden an einen ägyptischen Prinzen geknüpft und über achthundert Jahre in mündlicher Überlieferung erhalten? Diese entscheidende Frage bleibt nicht nur offen, sondern auch ungestellt. Denn was von Mose übrigbleibt, der ägyptische Prinz, der äthiopische Feldzug und der "Ahnenverlust", ist nichts, was ihn gerade in der jüdischen Erinnerung hätte unsterblich machen können. In diesem Widerspruch tritt die letztliche Unaufrichtigkeit dieser "Spurensuche" zutage. Wer behauptet, die irdische Existenz des biblischen Mose real nachweisen zu können, der kann nicht gleichzeitig alles, was die Bibel ihm an gedächtnisstiftenden Taten zuschreibt, für bare Erfindung halten. Das wäre so, wie wenn man nachweist, daß es wirklich im achten Jahrhundert vor Christus einen Mann namens Homer gegeben hat, daß er sogar blind und ein Sänger war, aber daß er mit den ihm zugeschriebenen Epen nicht das geringste zu tun hat. So sagt uns Krauss: Mose hat es wirklich gegeben, aber die Bibel hat doch nicht recht, denn dieser Mose hat nichts von dem getan, was sie ihm zuschreibt.
Der Leser erfährt aus diesem Buch vieles über ägyptische Geschichte und biblische "Erfindungen", was in so ungewohntem Licht durchaus unterhaltsam zu lesen ist. Aber der aggressive, denunziatorische Ton gegenüber den biblischen Berichten stört. Krauss kämpft hier gegen ein primitiv fundamentalistisches Bibelverständnis an. Wer schreibt denn dem biblischen Text die historistischen Wahrheitswerte zu, die ihm Krauss mit so viel Polemik streitig macht? Wem bricht eine Welt zusammen, wenn er erfährt, daß die Schöpfung nicht "an einem Oktobertag im Jahr 3761 v. Chr." begann? Solche Polemik ist invertierter Fundamentalismus. Wer so mit der Bibel verfährt, den wird man nicht zu den Gebildeten unter ihren Verächtern rechnen.
JAN ASSMANN.
Rolf Krauss: "Das Moses-Rätsel". Auf den Spuren einer biblischen Erfindung, Ullstein Verlag, München 2001. 352 S., Abb., geb., 24,-
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Jan Assmann fühlt sich der Pflicht enthoben, dies Buch "ganz ernst" zu nehmen. Das will er jedoch nicht als Argument gegen die Publikation verstanden wissen, die ihm einiges Vergnügen bereitet hat. Nicht nur, weil der Autor darin überlieferte Quellen gehörig gegen den Strich las. Bei ihm gerät das biblische Zeugnis über Moses ins Abseits, dagegen die "spätantiken und mittelalterlichen Moses-Legenden" ins Zentrum, so Assmann. Hier nun habe Autor Rolf Krauss zwischen dem Stifter der monotheistischen Religion und einem ägyptischen Vizekönig erstaunliche Parallelen gefunden, was ihn laut Assmann auf den Einfall gebracht haben muss, "diesen Pharao einer breiteren Öffentlichkeit als Moses zu präsentieren". Krauss verfahre dabei "strikt zweigleisig". Er publiziere als Ägyptologe UND wissenschaftlicher Sensationsschriftsteller und halte "beide Diskurse" auseinander. Beweisen kann er seine Darstellung ohnehin nicht, meint der Rezensent, der sie aber "amüsant zu lesen" findet. Man erfahre einiges über ägyptische Geschichte und biblische "Erfindungen", was so bisher nicht zu lesen gewesen sei. Kleine Einschränkung: der "aggressive, denunziatorische Ton der Bibel gegenüber stört Assmann dann doch. Krauss kämpfe gegen "ein primitiv fundamentalistisches Bibelverständnis". Seine Polemiken sind für den Rezensenten aber kaum mehr als ein invertierter Fundamentalismus.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH