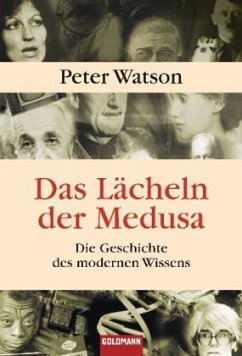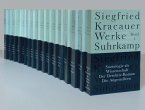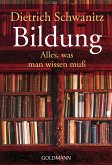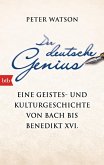Das Standardwerk zur Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts
Malerei und Physik, Philosophie und Anthropologie, Literatur und Medizin, Architektur und Theater - Peter Watson hat jene Ideen und Erkenntnisse zusammengetragen, die das letzte Jahrhundert nicht nur entscheidend geprägt haben, sondern auch nachhaltigen Einfluss darauf hatten, was und wie wir heute denken. Eine Enzyklopädie der Geistesgeschichte, eine Tour d'horizon durch die Jahrzehnte, eine unerhörte Fülle des Wissens, spannend und unterhaltsam präsentiert.
Malerei und Physik, Philosophie und Anthropologie, Literatur und Medizin, Architektur und Theater - Peter Watson hat jene Ideen und Erkenntnisse zusammengetragen, die das letzte Jahrhundert nicht nur entscheidend geprägt haben, sondern auch nachhaltigen Einfluss darauf hatten, was und wie wir heute denken. Eine Enzyklopädie der Geistesgeschichte, eine Tour d'horizon durch die Jahrzehnte, eine unerhörte Fülle des Wissens, spannend und unterhaltsam präsentiert.

Peter Watsons Kulturimperialismus / Von Christoph Albrecht
Die Feinde der Globalisierung, des Neoliberalismus und des Neodarwinismus können sich auf einen neuen Gegner einschießen. Er heißt Peter Watson, ist britischer Journalist und hat jetzt in deutscher Übersetzung eine Apologie der westlichen Zivilisation und ihres Herrschaftsanspruchs vorgelegt. Das Buch ist eine fast 1200 Seiten dicke Welt- und Ideengeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts. Es handelt sich um thematisch und zeitlich sortierte kurze lexikonartige Kapitel, die ein Personen- und ein Sachregister erschließt. Das Buch bietet einen mehr oder weniger umfassenden Überblick über wichtige Ereignisse in der Geschichte von Literatur, Physik, Medizin, Psychologie, Wirtschaft, Technik, Kino, Musik, Kunst, Philosophie, Religion und anderer kultureller Ausdrucksformen des eben vergangenen Jahrhunderts. Die Grundidee ist, per Umfrage bei allen möglichen Experten die übereinstimmend für wichtig gehaltenen Ideen, technischen und wissenschaftlichen Entwicklungen zu ermitteln und kurz darzustellen. Anders als ein Lexikon ist es dazu da, am Stück weg gelesen zu werden.
Die vor uns ausgebreitete Fülle beweist zunächst einmal das eine: den ungeheuren geistigen Reichtum, die sagenhafte intellektuelle Produktivität der modernen Welt, die im wesentlichen die westliche und ganz besonders die nordamerikanische Welt ist. Schon darin liegt eine Provokation. Gibt es nicht viele Symptome westlicher Dekadenz? Kriminalität, viele Selbstmorde und hohe Scheidungsraten, Pornographie und Materialismus, dazu die politischen Katastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts: Weltkriege, Totalitarismus, die Ermordung der Juden, der Kalte Krieg. Und gleichzeitig dieser überlegene intellektuelle Reichtum der westlichen Kultur, für den Watson offensiv wirbt. Dabei kommt es in dieser teleskopischen Sicht wenig auf die Vollständigkeit oder auf die Urteile im einzelnen an - manche sind platt. Wichtig ist die Perspektive. Welchen Maßstab legt Watson zugrunde, wenn er die Leistungen der Naturwissenschaften höher bewertet als die der Geisteswissenschaften und Künste, wenn er den Westen als kulturell produktiver bewertet als den Rest der Welt?
Die alles integrierende Meta-Idee, die Weltformel entstammt dem neunzehnten Jahrhundert. Der große erzählerische Behälter, in dem alles zusammenfließt, ist Darwins Begriff der Evolution. Er dient gleichzeitig als Werkzeug der Auslese, um das Nützliche vom lediglich Interessanten zu trennen. Das darwinistische Konkurrenzmodell erlaubt es beispielsweise, die Unterschiede zwischen der angelsächsischen und der kontinentalen Philosophie und damit sich selbst zu beschreiben: hier die "Meta-Narrationen" des Freudianismus und des Marxismus, ebenfalls Relikte des neunzehnten Jahrhunderts, dort die Meta-Narration des Darwinismus. Überall interessante Ansätze, die aber letztlich "nur nach der Überzeugungskraft beurteilt werden" dürften. Und hier schneiden etwa die postmodernen Franzosen, in deren Nähe Watson auch Habermas rückt, schlechter ab: "Keiner von ihnen hat allgemeine Akzeptanz gefunden." Akzeptanz ist der Selektionsmechanismus der kulturellen Evolution. Am meisten akzeptiert seien die Naturwissenschaften. Ihr Aufstieg an die Spitze der intellektuellen Nahrungskette sei deshalb das intellektuell Kennzeichnende des zwanzigsten Jahrhunderts. Evolution habe kein Ziel.
Aber die Beweislage zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts lasse eine Tendenz erkennen. Ein radikaler naturwissenschaftlicher Reduktionismus werde die Deutungsangebote von Kunst, Geisteswissenschaften und Religion verschlingen. Alles werde einer großen Erzählung von der universalgeschichtlichen Evolution aller Völker aus allen Zeiten einverleibt. Watsons fröhlichen Kulturimperialismus wird nicht jedermann akzeptieren. Wertvoll ist sein Buch jedoch als reader's guide und als Herausforderung zum Kampf der Ideen.
Peter Watson: "Das Lächeln der Medusa". Die Geschichte der Ideen und Menschen, die das moderne Denken geprägt haben. Aus dem Englischen von Yvonne Badal. C. Bertelsmann Verlag, München 2001. 1184 S., geb., 98,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Watson breitet locker Stoff für das nächste Jahrzehnt von 'Wer wird Millionär' aus." taz