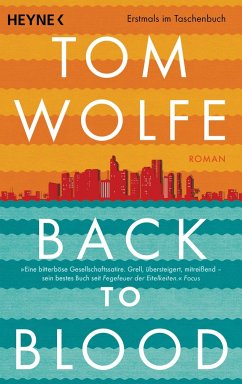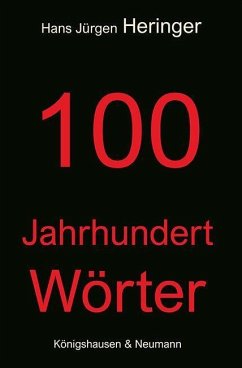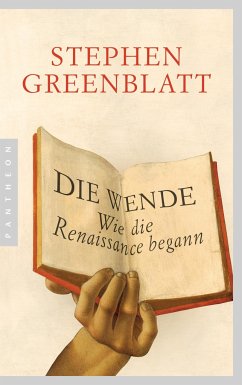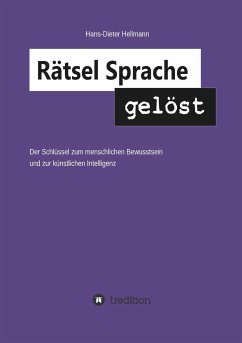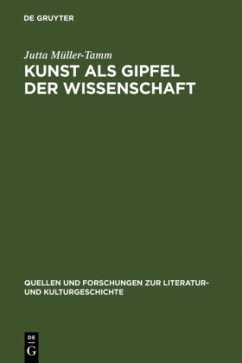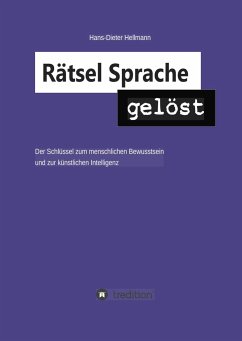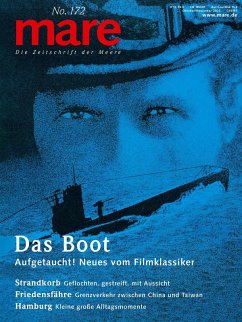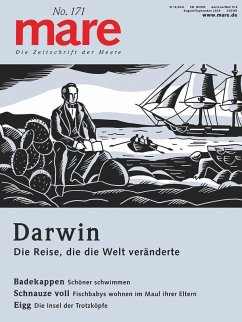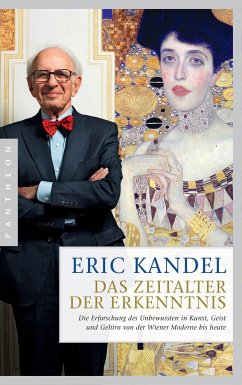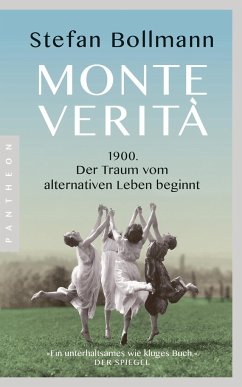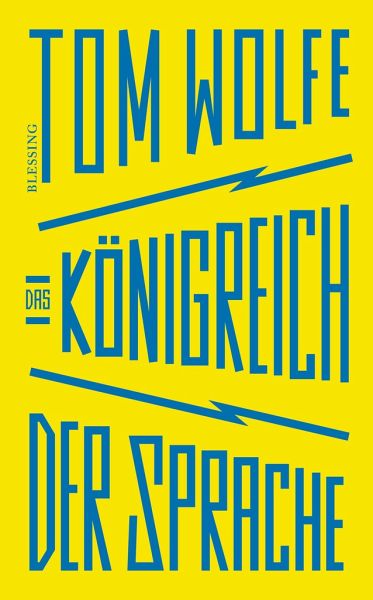
Das Königreich der Sprache

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
In den vergangenen 150 Jahren wurden von der Entdeckung des Penizillins über die Entschlüsselung der menschlichen DNS bis zum Nachweis des Higgs-Bosons kolossale Fortschritte gemacht. Doch an einer der drängendsten Fragen der Menschheitsgeschichte - Wo liegt der Ursprung der menschlichen Sprache? - scheitert die Wissenschaft bis heute. Das hat, wie Tom Wolfe genüsslich darlegt, führende Forscher von Charles Darwin bis Noam Chomsky jedoch zu keiner Zeit davon abgehalten, grandiose Erfolge zu verkünden, die gar keine waren, Konkurrenten zu diffamieren, anstatt eigene Fehler einzugestehen, ...
In den vergangenen 150 Jahren wurden von der Entdeckung des Penizillins über die Entschlüsselung der menschlichen DNS bis zum Nachweis des Higgs-Bosons kolossale Fortschritte gemacht. Doch an einer der drängendsten Fragen der Menschheitsgeschichte - Wo liegt der Ursprung der menschlichen Sprache? - scheitert die Wissenschaft bis heute. Das hat, wie Tom Wolfe genüsslich darlegt, führende Forscher von Charles Darwin bis Noam Chomsky jedoch zu keiner Zeit davon abgehalten, grandiose Erfolge zu verkünden, die gar keine waren, Konkurrenten zu diffamieren, anstatt eigene Fehler einzugestehen, und generell des Kaisers neue Kleider in den schillerndsten Farben zu beschreiben.
In Das Königreich der Sprache vertritt Wolfe die These, wonach die Sprache die erste kulturelle Leistung des Menschen und somit nicht mit der Evolutiontheorie oder wissenschaftlicher Systematik zu erklären ist.
In Das Königreich der Sprache vertritt Wolfe die These, wonach die Sprache die erste kulturelle Leistung des Menschen und somit nicht mit der Evolutiontheorie oder wissenschaftlicher Systematik zu erklären ist.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.