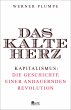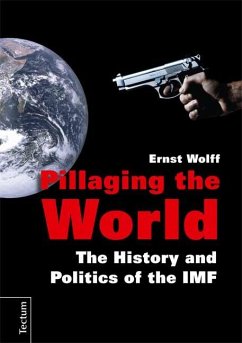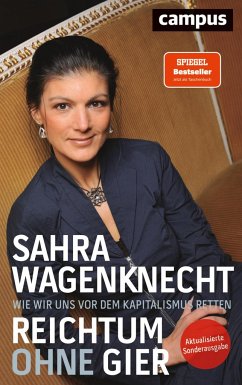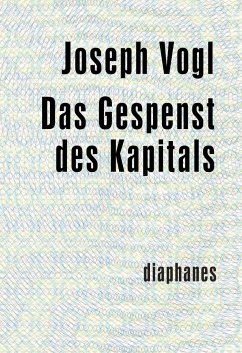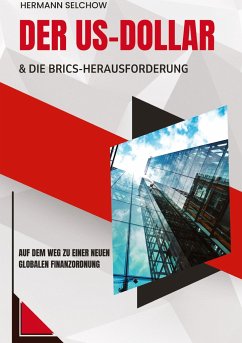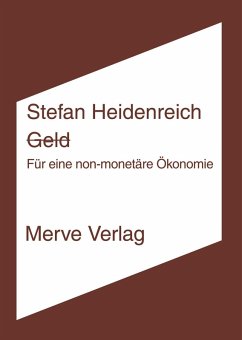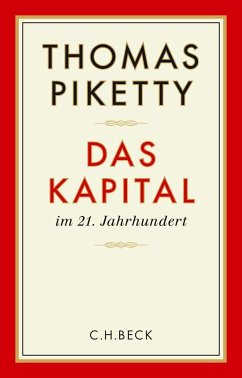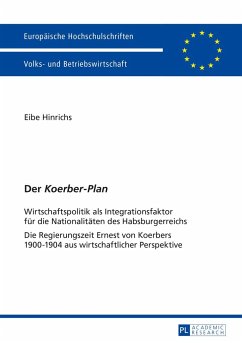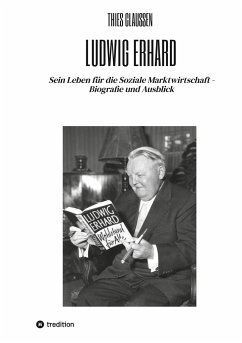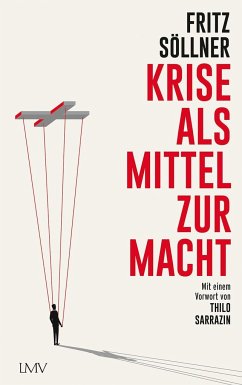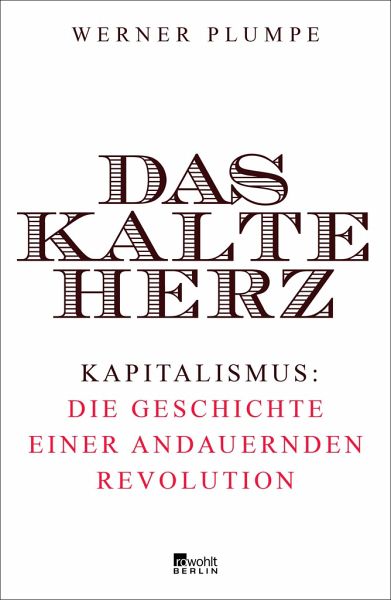
Das kalte Herz
Kapitalismus: die Geschichte einer andauernden Revolution

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Macht der Kapitalismus wenige reich und viele arm - oder immer mehr immer weniger arm?Nicht erst seit der Finanzkrise ist es wieder üblich geworden, den Kapitalismus für fast alle Übel der Welt verantwortlich zu machen. Dem setzt der renommierte Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe die Geschichte des Kapitalismus entgegen, die zeigt, wie viele Probleme die kapitalistische Marktwirtschaft gelöst hat - und nur diese. Denn «der» Kapitalismus ist kein System, sondern eine Art der Wirtschaft, bei der der Konsum im Mittelpunkt steht - und zwar der Konsum gerade der wenig vermögenden Menschen, ...
Macht der Kapitalismus wenige reich und viele arm - oder immer mehr immer weniger arm?
Nicht erst seit der Finanzkrise ist es wieder üblich geworden, den Kapitalismus für fast alle Übel der Welt verantwortlich zu machen. Dem setzt der renommierte Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe die Geschichte des Kapitalismus entgegen, die zeigt, wie viele Probleme die kapitalistische Marktwirtschaft gelöst hat - und nur diese. Denn «der» Kapitalismus ist kein System, sondern eine Art der Wirtschaft, bei der der Konsum im Mittelpunkt steht - und zwar der Konsum gerade der wenig vermögenden Menschen, die jahrhundertelang ihrem Schicksal überlassen waren. Nur so ist die ökonomisch erfolgreiche Massenproduktion möglich. Das hat früh Kritik auf sich gezogen, aber Plumpe zeigt, wie die kapitalistische Art des Wirtschaftens darauf reagiert hat, sich immer wieder wandelt.
Der Kapitalismus ist folgenreich wie wenige andere Ideen, und wir entkommen ihm nicht, nicht mal in der Verweigerung. Ihm liegt weder ein böser Wesenskern zugrunde, noch ist er die Summe missliebiger Begleiterscheinungen unseres Gesellschaftssystems. Plumpe zeigt den Kapitalismus als immerwährende Revolution - als eine Bewegung ständiger Innovation und Neuerung, die so gut oder schlecht ist, wie wir sie gestalten. Der Kapitalismus ist und war schon immer das, was wir aus ihm machen.
Nicht erst seit der Finanzkrise ist es wieder üblich geworden, den Kapitalismus für fast alle Übel der Welt verantwortlich zu machen. Dem setzt der renommierte Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe die Geschichte des Kapitalismus entgegen, die zeigt, wie viele Probleme die kapitalistische Marktwirtschaft gelöst hat - und nur diese. Denn «der» Kapitalismus ist kein System, sondern eine Art der Wirtschaft, bei der der Konsum im Mittelpunkt steht - und zwar der Konsum gerade der wenig vermögenden Menschen, die jahrhundertelang ihrem Schicksal überlassen waren. Nur so ist die ökonomisch erfolgreiche Massenproduktion möglich. Das hat früh Kritik auf sich gezogen, aber Plumpe zeigt, wie die kapitalistische Art des Wirtschaftens darauf reagiert hat, sich immer wieder wandelt.
Der Kapitalismus ist folgenreich wie wenige andere Ideen, und wir entkommen ihm nicht, nicht mal in der Verweigerung. Ihm liegt weder ein böser Wesenskern zugrunde, noch ist er die Summe missliebiger Begleiterscheinungen unseres Gesellschaftssystems. Plumpe zeigt den Kapitalismus als immerwährende Revolution - als eine Bewegung ständiger Innovation und Neuerung, die so gut oder schlecht ist, wie wir sie gestalten. Der Kapitalismus ist und war schon immer das, was wir aus ihm machen.