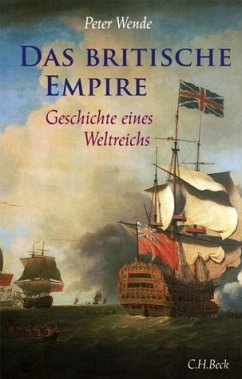Aufstieg und Niedergang einer Weltmacht
Peter Wende entwirft in seinem umfassenden Werk ein facettenreiches Bild der Geschichte des Britischen Empire. Die differenzierte Darstellung reicht von den mittelalterlichen Voraussetzungen und Anfängen über die imperiale Außen- und Reichspolitik während der Frühen Neuzeit bis zur britischen Kolonialherrschaft in Amerika, Asien und Afrika und der Auflösung des Weltreichs im 20. Jahrhundert.
Peter Wende gilt als einer der besten Kenner der englischen Geschichte. Hier fragt er nach den Ursachen und Folgen der Tatsache, daß eine Insel am Rande Europas für mehr als zwei Jahrhunderte das Zentrum eines weltumspannenden ökonomischen und politischen Beziehungsgeflechts bildete. So rückt er bestimmte Faktoren, Phasen und Schauplätze des Geschehens bewußt in den Vordergrund: die Entwicklung des Überseehandels und den Ausbau der Kriegsflotte, die Entstehung der amerikanischen Siedlungskolonien und deren Entlassung in die Unabhängigkeit, das Wechselspiel von europäischer Mächtepolitik und dem Ausbau einer globalen Machtposition, das Verhältnis von politischer Herrschaft und (privaten) wirtschaftlichen Interessen, die Instrumente und Techniken kolonialer Herrschaft in Indien und Afrika, die Mechanismen der Expansion sowie schließlich die Auswirkungen imperialer Herrschaft auf das Mutterland, die Befreiungskämpfe und die Dekolonisation in der spezifischen Form des Commonwealth.
Peter Wende entwirft in seinem umfassenden Werk ein facettenreiches Bild der Geschichte des Britischen Empire. Die differenzierte Darstellung reicht von den mittelalterlichen Voraussetzungen und Anfängen über die imperiale Außen- und Reichspolitik während der Frühen Neuzeit bis zur britischen Kolonialherrschaft in Amerika, Asien und Afrika und der Auflösung des Weltreichs im 20. Jahrhundert.
Peter Wende gilt als einer der besten Kenner der englischen Geschichte. Hier fragt er nach den Ursachen und Folgen der Tatsache, daß eine Insel am Rande Europas für mehr als zwei Jahrhunderte das Zentrum eines weltumspannenden ökonomischen und politischen Beziehungsgeflechts bildete. So rückt er bestimmte Faktoren, Phasen und Schauplätze des Geschehens bewußt in den Vordergrund: die Entwicklung des Überseehandels und den Ausbau der Kriegsflotte, die Entstehung der amerikanischen Siedlungskolonien und deren Entlassung in die Unabhängigkeit, das Wechselspiel von europäischer Mächtepolitik und dem Ausbau einer globalen Machtposition, das Verhältnis von politischer Herrschaft und (privaten) wirtschaftlichen Interessen, die Instrumente und Techniken kolonialer Herrschaft in Indien und Afrika, die Mechanismen der Expansion sowie schließlich die Auswirkungen imperialer Herrschaft auf das Mutterland, die Befreiungskämpfe und die Dekolonisation in der spezifischen Form des Commonwealth.

Eine kompakte Geschichte des Britischen Empire
Peter Wendes Werk über das Britische Empire ist nicht im eigentlichen Sinne ein Wirtschaftsbuch, sondern eine aus der Perspektive eines erfahrenen Allgemeinhistorikers verfasste Geschichte eines der größten Weltreiche der Menschheit. Sein Verfasser lehrte als Professor an der Universität in Frankfurt am Main und leitete zwischen 1994 und 2000 das Deutsche Historische Institut in London. Doch gerade diese nicht fachspezifische Geschichtsschreibung macht die Lektüre des flüssig und verständlich geschriebenen Buches auch aus ökonomischer Sicht spannend und lehrreich. Sie zeigt, dass es keiner ökonomischen Brille bedarf, um die gewaltige wirtschaftliche Bedeutung des Empire zu erkennen.
Das gilt vor allem für das erste Empire, das Wende im Einklang mit der Gründung der Kolonie Virginia im Jahre 1607 beginnen und mit der Anerkennung der Unabhängigkeit der nordamerikanischen Kolonien im Frieden von Paris 1783 enden lässt. Das erste britische Weltreich war ein von merkantilistischem Geist erfülltes Handelsimperium, erobert und erschlossen meist durch private Initiativen, die mit Genehmigung der Krone agierten. Es verband sich Unternehmergeist mit dem Willen von Kolonisten, dem sozialen Elend in der Heimat zu entfliehen. Hier und da begünstigten religiöse Motive die Auswanderung. Die geographischen Schwerpunkte dieses Reiches, dem Großbritannien seine Weltmachtstellung verdankt, lagen in Nordamerika und in der Karibik. Mit der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten verlor das erste Empire jedoch seine wichtigste außereuropäische Machtbasis.
Dass sich dem ersten Empire ein zweites Weltreich (1784 bis 1960) anschloss, hat vor allem mit der britischen Machtentfaltung in Indien zu tun, denn der bevölkerungsreiche Subkontinent wurde zum Dreh- und Angelpunkt des britischen Imperialismus, der sich anschließend mächtig entfaltete: Weitere Teile Asiens wie Burma und Singapur, Australien und Neuseeland sowie ein beachtlicher Teil Afrikas gerieten unter Kontrolle der britischen Krone.
Nun waren es allerdings nicht mehr private Handelsgesellschaften, sondern der Staat, der die Expansion vorantrieb und sicherte. In der Praxis lag wegen der großen Entfernungen und der eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten ein erheblicher Teil der Macht bei der Verwaltung vor Ort; zentralistisch ließ sich das Empire nicht regieren. Entsprechend verschieden wurden die Kolonien und Protektorate geführt - manchmal eher zurückhaltend wie in Australien, manchmal aber auch geradezu despotisch wie im Falle Indiens. Die Unabhängigkeit Indiens nach dem Zweiten Weltkrieg wurde denn auch zum Sargnagel des Empire, für das es aber auch in London kaum mehr Verteidiger gab.
Abschließend bleibt die Frage: Hat sich das Empire für Großbritannien wirtschaftlich gelohnt? Eine klare Rechnung ist nicht möglich. Fachhistoriker, die sich diesem Thema gewidmet haben, sind, je nach der betrachteten Epoche, zu sehr unterschiedlichen Schlussfolgerungen gelangt. Das erste Empire dürfte sich rentiert haben, allerdings mit der Ausnahme des kostspieligen amerikanischen Unabhängigkeitskrieges. Das zweite Empire war vermutlich weit bis in das 19. Jahrhundert rentabel, ehe das Zeitalter des Imperialismus die Kosten für Erschließung und militärische Sicherung der Kolonien und Protektorate in die Höhe schießen ließ. Die Bilanz für das 20. Jahrhundert fällt aber wohl, vor allem wegen der erheblichen Kosten für das Militär, negativ aus.
Abseits aller Zahlenspiele bleiben zwei Befunde. Das Vertrauen auf sichere wirtschaftliche Ressourcen aus den verschiedenen Teilen des Empire hat im 20. Jahrhundert wahrscheinlich die wirtschaftliche Sklerose Großbritanniens begünstigt und den notwendigen Strukturwandel zumindest verzögert.
Auf der Habenseite stand jedoch, dass die auswärtigen Besitzungen dem Heimatland als Karriereort und Zufluchtsstation dienten - sei es als Sträflingskolonie wie Australien, sei es als Gelegenheit für bestenfalls mittelprächtig talentierte Söhne des Adels und des Bürgertums, passable Laufbahnen beim Militär oder in der Verwaltung einzuschlagen. Die Funktion des Empire als Ventil für sozialen Druck im Heimatland gilt damit als eine Erklärung, warum Großbritannien im Unterschied zu vielen europäischen Staaten in den letzten Jahrhunderten keine Revolution erlebte.
GERALD BRAUNBERGER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Peter Wende erzählt, wie es dem Britischen Empire gelang, mit nur 1200 Beamten die Kolonien zu verwalten
Spanier und Portugiesen machten sich die Sache einfach: Anstatt ihre Kräfte damit zu vergeuden, einander im Streit um Kolonien zu bekriegen, teilten sie die Welt 1494 untereinander auf: Alles neue Land westlich des 46. Längengrades sollte der spanischen Krone gehören, und alles Land östlich davon der portugiesischen. Die Briten verspäteten sich, und ihre Versuche, im 16. und frühen 17. Jahrhundert an der amerikanischen Ostküste Siedlungen zu etablieren, gerieten ein ums andere Mal zum Fiasko.
Es war nicht schlau, allzu viele Aristokraten in die neue Welt mitzunehmen, die zwar abenteuerlustig waren, es mit ihrer gesellschaftlichen Stellung aber nicht vereinbaren konnten, mit Hand anzulegen. Zwar hatte man Saatgut dabei, nicht aber Bauern, die damit umzugehen verstanden. Ein Mann namens Humphrey Gilbert wollte unbedingt nach Amerika. Doch bei der ersten Reise 1578 ließen die Kapitäne seiner kleinen Flotte ihn im Stich und nahmen ihre gewohnte Seeräuberei wieder auf. Auf der zweiten Reise hatte Gilbert zwar daran gedacht, Gaukler und Tänzer zu dingen, die die Eingeborenen beeindrucken sollten, doch hatte er leider versäumt, genug Lebensmittel für die Überfahrt zu laden.
Immerhin eines wusste man damals: Ein Kauffahrteischiff konnte nicht mehr als 100 Fässer Bordeauxwein transportieren. Darauf geht das dann gebräuchliche Maß für Tonnage zurück. Während Humphrey Gilberts Schiff 1583 in einem Sturm unterging, soll er auf dem Achterdeck gesessen und Thomas Morus’ „Utopia” gelesen haben.
Peter Wendes Geschichte des britischen Empire ist am Anfang besonders kurzweilig. In dem Maße, wie das Empire Gestalt annahm und administriert werden musste, ist Wende genötigt, auch die trockeneren Aspekte zu schildern. Verwaltungsfragen und diversen Kriegen gilt es Rechnung zu tragen. Weil es dem Historiker darum ging, eine konzise Gesamtdarstellung vorzulegen, hat er sich im Zweifelsfall gegen das Anekdotische entschieden. Er kümmert sich um die großen Linien. So weist er darauf hin, dass die Spanier stets als Beutemacher ausgezogen seien, wohingegen die meisten Briten in den Neuenglandstaaten wirklich eine neue Welt hätten erschaffen wollen, in der religiöse dissenters von der Obrigkeit unbehelligt und von ihrer Hände ehrlicher Arbeit leben konnten. Aus Sicht der Siedler war das so, nicht aber aus Sicht der Indianer, die zu spüren bekamen, dass Grausamkeit das erste Charakteristikum jeder Siedlungsgesellschaft ist, weil sie im Kampf ums Überleben an fremden Gestaden ihre Manieren schnell vergisst.
Krieg und Beglückung
Gern hätte London in Nordamerika den englischen Feudalismus eingeführt. Das scheiterte daran, dass es so viel Land gab: Wer sich eingeengt fühlte, zog weiter, tötete eine ausreichende Zahl Indianer und war nun sein eigener Herr. Auch das Bemühen der britischen Verwaltung, mit den Einheimischen Verträge zu schließen, die ihnen Raum zum Leben zugestanden, scheiterte an den Kolonialisten. Das galt für alle Kontinente. Britische Warlords, die gegen Londoner Weisungen eine Stadt oder eine Provinz einnahmen, wurden eigentlich nur dann zur Rechenschaft gezogen, wenn die Fraktionskämpfe im politischen Sumpf der parlamentarischen Monarchie für sie ungünstig ausgingen. Die Neuengländer für ihr Teil wussten genau, warum sie sich 1776 nicht als Monarchie, sondern als Republik unabhängig machten. Schon damals, schreibt Wende, seien die Bürger der neuen Vereinigten Staaten wohlhabender gewesen als alle anderen Völker der Welt. Zwar überstieg das Pro-Kopf-Einkommen nicht das der Briten, aber es war gerechter verteilt.
Als die amerikanischen Kolonien für das Empire verloren waren, konzentrierte man sich in London auf den Osten. Bis weit in die zweite Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts war die Eroberung von Kolonien Privatgeschäft. Die Abenteurer, die im Auftrag der East India Company den indischen Subkontinent unterwarfen, standen nicht in Diensten der Krone. Schon 1661 hatte Charles II. der Gesellschaft das Privileg verliehen, auf eigene Rechnung Truppen aufzustellen und Krieg zu führen. Das tat sie dann auch.
Erst im Siebenjährigen Krieg begann Großbritannien staatlicherseits sein Empire auszudehnen. Nachdem die amerikanischen Kolonien verloren waren, konzentrierte London sich auf die Besitzungen im fernen Osten. Die nun folgende Phase stand im Zeichen zweier Bestrebungen: Einerseits wollte man Profit machen und britische Waren auf den kolonialen Märkten absetzen. Andererseits fühlte man sich ausersehen, fremde Völker aller Erdteile mit der christlichen Zivilisation zu beglücken. Wo es möglich war, wie etwa in Indien, verständigte man sich mit einheimischen Fürsten, welche die Bevölkerung nun im Namen der Krone ausbeuteten. Das funktionierte so gut, dass lediglich die indische „Meuterei” 1857 und der Burenkrieg 1899 ernste Ärgernisse darstellten. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg unterstanden etwa 43 Millionen Menschen in mehr als einem Dutzend Kolonien der Verwaltung von lediglich 1200 Kolonialbeamten.
Peter Wende kennt sich in allen historischen Streitfragen gut aus. Sein Überblick ist so souverän, dass er darauf verzichtet, den Leser mit den Scharmützeln der Historiker näher bekanntzumachen. Er nennt die Probleme und die Lösungen, die sich herauskristallisiert haben. Anregender wäre sein vorzüglicher Überblick ausgefallen, wenn er die Streitereien etwas näher beleuchtet hätte. So haben die Historiker zum Beispiel jahrelang darüber debattiert, ob die Sklaverei wirklich profitabel war. Wende stellt fest, die Aufhebung der Sklaverei, die in den britischen Kolonien 1834 verfügt wurde, sei ökonomisch eher belanglos gewesen: Die afrikanischen Sklaven wurden durch indische „coolies” ersetzt, die kaum besser lebten als Sklaven. So plausibel das klingt, so gern wüsste der Leser mehr über die nicht ganz ohne politischen Furor betriebene Debatte, die zu dieser Erkenntnis führte.
Das gleiche gilt für die Frage, ob und wann das Empire lukrativ war. Wende resümiert, dass es im 20. Jahrhundert damit vorbei gewesen sei. Doch vor dem Zweiten Weltkrieg habe die Londoner Wirtschaftspolitik davon gezeugt, dass man das Empire erhalten wollte. Wende ist anglophil und geneigt, die britische Geschichte so zu betrachten, wie sie überliefert wurde. Vermutlich geht er deshalb nicht auf die Frage ein, die Bernard Porter in seinem Buch „The Absent-Minded Imperialists” aufgeworfen hat: War das Empire wirklich das Herzstück des britischen Selbstverständnisses?
Die Dekolonisierung, die nach dem Zweiten Weltkrieg teils unumgänglich, teils erwünscht war, wurde den Briten leicht gemacht, weil sie sich – so Wende – seit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung damit eingerichtet hätten, dass die von Weißen bevölkerten Kolonien sich letztlich selbst regieren mussten. Um das Gesicht zu wahren, habe Großbritannien jedoch stets so getan, als beuge es sich nicht irgendeiner Freiheitsbewegung. Das gelang mal mehr, mal weniger überzeugend. Immerhin hat Großbritannien sich mit seinem mitunter ausgesprochen hastigen Rückzug aus den Kolonien grausame Kriege erspart, wie Frankreich sie in Indochina und Algerien führte. Über das Commonwealth, das anstelle des Empire trat, hat Wende ein Gutes zu sagen: Es wirkte als „Narkotikum”, das den Briten den Abschied von seiner einstigen Größe leichter machte. FRANZISKA AUGSTEIN
PETER WENDE: Das britische Empire. Geschichte eines Weltreichs. Verlag C. H. Beck, München 2008. 367 Seiten, 24,90 Euro.
Auf Englands Herrschaft über die Weltmeere ist man immer noch stolz: Eine Schiffsparade vor der Küste von Hampshire, im Jahre 2005 aufgefahren zur Erinnerung an die Schlacht von Trafalgar. Foto: Ben Wood/Corbis
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Rundum positiv bespricht Caspar Hirschi Peter Wendes Abhandlung über "Das britische Empire", eine Einführung in die Geschichte des ehemaligen Weltreichs, die das Thema als ein komplexes "Beziehungsgeflecht" darstellt. Unter Verzicht auf pauschale Urteile eröffne der Historiker und hervorragende Kenner der Materie einen Blick auf die Vielschichtigkeit und Fragilität eines weltumspannenden Herrschaftssystems, berichtet der Rezensent angetan. Besonders erfreulich findet er die bedingungslose Multiperspektivität von Wendes Ansatz, und identifiziert weitere Faktoren, die die Qualität des Buches stärken: die klare chronologische Struktur, die "flüssige" Prosa und die fachkundige Expertise sowohl in politik-, wirtschafts- als auch kulturgeschichtlichen Belangen. Lobend erwähnt er zudem, wie Wende, den er unter Vorbehalt in die Tradition linker Imperialismuskritik stellt, "mit feiner Ironie und auf zeitgenössische Stimmen gestützt, die ideologische Verbrämung der britischen Weltherrschaft" hervor hebt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH