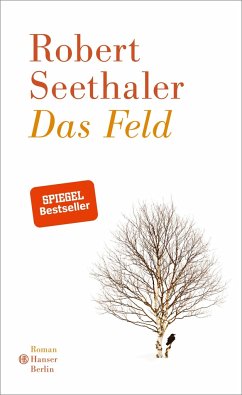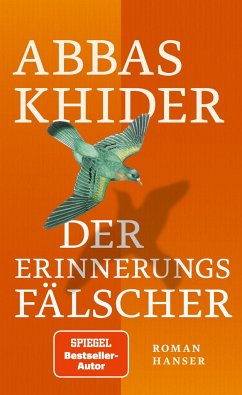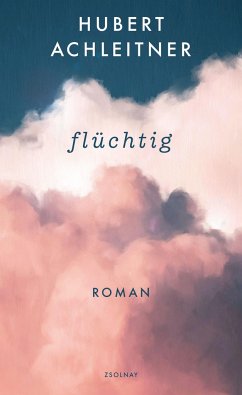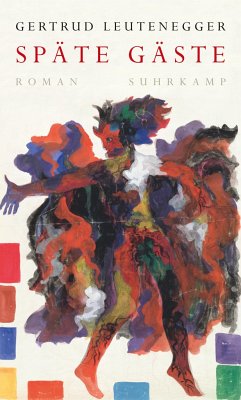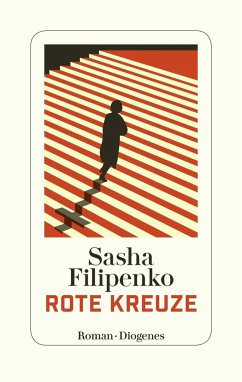mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet wurde.
Es ist zudem der gesamte Inhalt der ersten Seite. Die zweite ist ebenfalls nicht gefüllt mit Buchstaben. Viel Weiß prägt das Druckbild, aber auch den Text: weiß wie der Schwan, wie der Schnee, wie ein Laken. Die Farbe wird mit dem Rot des Mohns und des Fuchses, vor allem mit dem Rot von Blut kontrastiert. Typographisch trifft das klare Schwarz der Lettern linker Hand auf das etwas blassere zur rechten. Links wird die Gegenwart nach Anankes Tod geschildert, rechts durcheinanderwirbelnde Erinnerungen, kurz vor Schluss übernimmt der linke Strang, und die Handlung wird aufs Ende hin zugestaltet. Das übrigens keinen Punkt hat.
Damit dürfte klar sein: Hier wird keine Standardkost serviert. Den Text prägen durchgehende Kleinschreibung und unorthodoxe Interpunktion, eine Ich-Erzählung in Du-Form und Maskierung des Geschlechts der Figuren.
Zunächst wird das Bild einer relativ unbeschwerten Kindheit gezeichnet. Keine Helikoptereltern, viel Natur, enge Freundschaft. "ihr seid in diesen tagen allein im freibad, und das ganze hat stets einen hauch von abenteuer: swann packt am morgen nicht nur eure badesachen und handtücher in eure rucksäcke, sondern stets auch nektarinen und laugenbrötchen", so dass nur "die furcht davor, den test am ende, wie im ersten jahr, nicht zu bestehen, dich daran hindert, die freiheit, die freude zu genießen." Doch eines Tages schreit Swann Ichor unvermittelt an. Noch mysteriöser indes verhält es sich mit Ichors Reaktion: "ich will nicht dein kind sein." Puzzle bilden den Text, und es wird zu schauen sein, ob alle Teile passen.
Themenstränge sind Trauer und Verlust sowie das Verhältnis von Ich zu Du, von Individuum zu Clique, Familie oder Umwelt. Auch hier ist eine virtuose Komposition zu erkennen. Ananke und Ichor, die Göttin und das Götterblut, Form und Inhalt. Und wenn schon Ichor, dann auch "petrichor", dieser besondere Geruch, wenn es auf trockene Erde regnet, hier von der Figur eingeatmet. Die Clique besteht aus Ichor, Ananke, Cato, Eden und Vienna, die weiteren Figuren tragen ähnlich ungewöhnliche Namen. Stern hat sie gewählt, um die "Geschlechtszuweisung durch den Text zu verunmöglichen". Das Äußere der Figuren wird kaum beschrieben. Eden ist Ichors Zwilling, womit abermals eine Aussage über das Geschlecht vermieden wird und gleichzeitig die "Individualität" ins Spiel kommt; unklar bleibt freilich, ob die beiden ein- oder zweieiig sind.
Auf Anreden wie "Mama" und "Papa" verzichtet Stern ebenso wie auf Personal- und Possessivpronomen. Dabei gelingt ihr das Kunststück, zu einer Sprache zu finden, die trotz der häufigen Wiederholung des Namens nicht infantil wirkt. Als diese Hürde aber gerade genommen ist, heißt es nach einem neukonventionellen "studierenden" plötzlich "zu sehr pirat" oder die "drei besoffenen freunde". Diese maskulinen Formen springen schier in Großbuchstaben aus dem Text heraus. Dahin ist sie, die fiktive Geschlechtslosigkeit.
Bleibt die Frage, welche Möglichkeiten das geschlechtslose Erzählen bietet. Entgrenzt es die Wahrnehmung von Menschen? Zeigt sich hier eine neue Freiheit? Oder verblassen die Menschen? Ist der nächste Schritt die Ersetzung des Namens durch die Steuernummer?
Das "Neutrum" der Figuren geht einher mit Lücken im Text. Das sind nicht die häufig abgebrochenen Sätze, die oft gut ergänzt werden können. Es sind konkrete Leerstellen. Warum ist Cato in Psychotherapie? Warum ist Ichor schon vor Anankes Tod traumatisiert? Spielt eine Autoaggression in der Clique eine Rolle, oder stammen die Narben an den Händen vom Blutritual zur Freundschaftsbesiegelung? Kommt es zu (homoerotischen) Liebesbeziehungen? Aus meist mündlichen Situationen, in denen jemand nicht offen über eine homosexuelle Beziehung sprechen will/mag/kann, ist zuweilen ein solches "Neutrum" bekannt. Bei Stern bleibt all das ebenso unerklärt wie der Streit zwischen Swann und Ichor, was einen Nachgeschmack von Halbherzigkeit erzeugt.
Anführungszeichen und Fragezeichen fehlen. Was aber bedeutet es, wenn eine Frage mit einem Punkt endet? Dass kein Gegenüber da ist, sie zu beantworten? Dass an der Antwort kein Interesse besteht? Der fehlende Punkt am Ende des Romans verspricht zwar Offenheit, die Interpunktion sonst könnte dagegen als Hermetisierung des Textes gelesen werden. Zusammen mit dem geheim gehaltenen Wissen um die Figuren gerät er damit vollends zum Selbstgespräch.
Formexperimente sind immer wieder faszinierend, man denke nur an Georges Perec, der einen Roman ohne den Vokal E geschrieben hat, "Anton Voyls Fortgang", wie er in der deutschen Übersetzung heißt. Oder an die Kleinschreibung in der Lyrik - und Stern lässt ihren Roman auch graphisch wie ein Gedicht ausklingen. Die Bandbreite der Herangehensweisen ist immens. "das licht im container ist klinisch kalt, die spülung zerreißt den lauf der zeit, und du erschrickst, als du dich selbst im spiegel siehst." Der erste Satz aus der Erzählung mit dem umgedreht-gleichen Titel, aus Christa Wolfs "Kein Ort. Nirgends" lautet: "Die arge Spur, in der die Zeit vor uns wegläuft. Vorgänger ihr, Blut im Schuh. Blicke aus keinem Auge, Worte aus keinem Mund." Bei ähnlicher Sprachstruktur entsteht ein völlig anderer Klang. Ob sich Form und Inhalt harmonisch fügen, liegt nicht an einzelnen Erzählverfahren. Nicht einmal an ihrer Radikalität. Anna Stern brilliert in der Handhabung ihrer Sprache. Doch am Ende? Am Ende erdrückt die Form den Inhalt. Hier. Jetzt.
CHRISTIANE PÖHLMANN
Anna Stern: "Das alles hier, jetzt." Roman.
Elster & Salis, Zürich 2020. 288 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
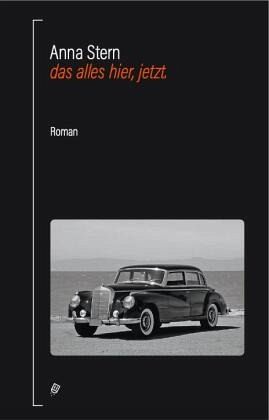





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.12.2020
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.12.2020