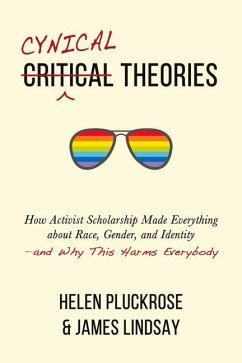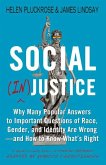Produktdetails
- Verlag: Pitchstone Publishing
- Seitenzahl: 352
- Erscheinungstermin: 25. August 2020
- Englisch
- Abmessung: 236mm x 159mm x 35mm
- Gewicht: 635g
- ISBN-13: 9781634312028
- ISBN-10: 1634312023
- Artikelnr.: 57839643

Minderheiten
Eine Streitschrift warnt: Bedrohen kritische,
aktivistische Theorien das freie Denken?
VON THOMAS STEINFELD
Als das Buch der britischen Publizistin Helen Pluckrose und des amerikanischen Mathematikers James Lindsay mit dem Titel „Cynical Theories“ vor einigen Wochen in der englischsprachigen Welt erschien, wurde die Publikation von Testimonials der höchsten Autoritäten begleitet. Der amerikanische Psychologe Steven Pinker, die niederländische Frauenrechtlerin Ayaan Hirsi Ali, der britische Biologe Richard Dawkins: Sie alle fordern mit den Autoren, dem wachsenden Einfluss einer autoritären Lehre entgegenzutreten. Nicht nur an amerikanischen und britischen Universitäten, sondern auch in wachsenden Teilen des öffentlichen Lebens habe sich ein Fundamentalismus durchgesetzt, der liberale Werte unterdrücke und eine wissenschaftliche Auseinandersetzung unmöglich werden lasse.
Gemeint sind Theorien über Geschlecht und Gender, über sexuelle Minoritäten, über Rassismus, über Behinderte und Fettleibige, die im englischen Sprachraum als „Critical Theory“ (sie hat mit der deutschen „Kritischen Theorie“ nur bedingt etwas zu tun) oder als Programm einer sozialen Gerechtigkeit („Social Justice“) zusammengefasst werden. In Deutschland erscheinen sie bislang eher in Fraktionen, unter Namen wie Gender Studies oder Queertheorie, die oft in verschiedenen akademischen Disziplinen beheimatet sind.
Das Buch „Cynical Theories“ (Pitchstone Publishing, Durham, North Carolina 2020) dürfte die erste historisch-systematische Darstellung dieser Lehren zum Zweck ihrer Kritik sein. Sie beginnt mit einer Geschichte des radikalen Skeptizismus, der nach Ansicht der Autoren in Gestalt des Poststrukturalismus, also der Werke Michel Foucaults, Jacques Derridas und einiger anderer Protagonisten des Denkens in „Diskursen“, in die Welt gekommen sei. Es gebe keine Wahrheiten, sondern lediglich Äußerungen von Macht, hätten diese Philosophen gelehrt (was so pauschal nicht zutrifft, aber das ist eine andere Geschichte). Zwanzig Jahre nach ihrem ursprünglichen Auftreten in kleinen akademischen Zirkeln sei diese Lehre in die Hände amerikanischer Aktivisten gefallen, wo sie sich, Schritt für Schritt und mit immer wieder anderen Minoritäten im Blick, in ein umfassendes Programm zur Radikalisierung der Menschenrechte verwandelt habe.
Seitdem werde nicht nur und zunehmend das Recht auf freie Rede lauter Regelungen und Verboten für den Umgang mit ethnischen, sexuellen oder anderen Minderheiten unterworfen. Vielmehr seien überhaupt die Grundlagen einer bürgerlichen Liberalität und einer freien Wissenschaft geopfert worden – sowie, vor allem für die Universität, aber auch im Kulturbetrieb, eine unabhängige und auf fachlichen Meriten basierende Anstellungspolitik. Beispiele, in jederlei Hinsicht, kennen die Autoren in großer Zahl: Das Buch ist, vor allem anderen, ein Dokument dafür, dass die „Social Justice“-Bewegung im Alltag angekommen ist.
Im Oktober 2018 hatten Pluckrose und Lindsay zusammen mit dem Philosophen Peter Boghossian einen „Hoax“, einen selbstveranstalteten Schwindel, offengelegt: Unter Pseudonymen hatten sie akademischen Zeitschriften, die der „Social Justice“-Bewegung nahestehen, zwanzig Aufsätze zur Publikation angeboten. Streng im Jargon der Bewegung gehalten, galten sie fragwürdigen Erfindungen: In einem Artikel wurde behauptet, man habe auf Grund empirischer Forschungen an zehntausend Hunden ermittelt, dass es unter diesen Tieren eine Vergewaltigungskultur gebe. Sie lasse sich durch Dressur verändern, was als Vorbild für den Umgang mit Männern dienen könne. In einem anderen Aufsatz wurde eine Verbindung zwischen dem Penis, einer „Hypermännlichkeit“ und dem Klimawandel gezogen. Etwa die Hälfte der Artikel wurde (einige davon unter Vorbehalten) zur Veröffentlichung angenommen oder gar publiziert. Der Schwindel erregte damals großes Aufsehen, worunter von den Autoren vor allem Boghossian zu leiden hatte: Der Philosoph wurde trotz der satirischen Absicht von seiner Universität des wissenschaftlichen Fehlverhaltens beschuldigt, was zwar etliche Solidaritätserklärungen der akademischen Prominenz in den USA nach sich zog, aber auch in ein Forschungsverbot mündete.
Die satirische Aktion zielte auf die Entlarvung wissenschaftlicher Unredlichkeit, das Buch „Cynical Theories“ sucht nun die Widerlegung des gesamten Ansatzes. Zu diesem Zweck geben sich Pluckrose und Lindsay einige Mühe mit der Darstellung der Bewegung. Die wichtigsten Vertreter jener Theorien werden noch einmal vorgestellt, oft auch in Zitaten, es werden Geschichte und Zusammenhang dargelegt. Die radikale Skepsis einiger französischer Gelehrter habe, so Pluckrose und Lindsay, gleichsam im Untergrund des akademischen Lebens geschlummert. Ihr sei dann, von anderer Seite und mit anderen Zwecken, der Feminismus entgegengekommen, bis sich beide in der etwa durch die amerikanische Philosophin Judith Butler vertretenen Annahme vereinten, das kulturelle Geschlecht („gender“) sei eine soziale Konstruktion.
Deshalb sind linguistische Regelungen für die critical theories so wichtig: Ihre Anhänger sind davon überzeugt, Macht bestehe insbesondere aus Sprache (womit eine alte Tradition des abendländischen Geisteslebens, nämlich der Nominalismus, zurückkehrt). Helen Pluckrose und James Lindsay verfolgen die Entwicklung des Prinzips sozialer Gerechtigkeit zur intellektuellen Anwaltschaft für immer feiner definierte Minderheiten, von verschiedenen Abweichungen von traditionellen sexuellen Normen bis hin zu den „Fat Studies“. Am Ende geht es in dem Buch um Versuche, selbst die Mathematik, weil ebenfalls sexistisch und rassistisch, der neuen moralischen Ordnung zu unterwerfen.
Getragen wird die Bewegung von akademischen Lehrern und Funktionären, die für sich den Anspruch erheben, es mit der Gleichheit ernster zu nehmen als je einer vor ihnen. Darüber wurden sie zu Aktivisten, insofern sie, um einer finalen Gleichstellung willen, den Minderheiten eine höhere gesellschaftliche Geltung zusprachen als der Mehrheit. Auf diese Weise wird nicht nur offenbar, dass Gleichheit und Gleichstellung gegeneinander konkurrieren: Wer Gleichstellung will, muss Gleichheit relativieren.
Es entsteht außerdem eine intellektuelle Praxis, deren wesentlicher Zweck darin besteht, das anstößige Treiben der (meist „heteronormativen“ oder „toxisch männlichen“) Macht in mehr oder minder gewöhnlichen Lebensäußerungen bloßzustellen. Eine Kultur des Misstrauens und der Kolportage sei die notwendige Folge, warnen Pluckrose und Lindsay, die sich als „liberale Humanisten“ verstehen. In den USA scheint sich diese Kultur vor allem in den Universitäten – und zwar gerade in den besonders angesehenen Einrichtungen – durchgesetzt zu haben. Doch nicht nur dort: In Schweden hat die Bewegung, wie ein jüngst erschienenes Buch der Journalisten Anna-Karin Wyndhamn und Ivar Arpi dokumentiert („Genusdoktrinen“, Juni 2020), längst auch die öffentliche Verwaltung und die Schulen erreicht.
Zwei Schwächen prägen das Buch „Cynical Theories“, aller Anschaulichkeit zum Trotz: Viel zu oft endet die Auseinandersetzung in dem Vorwurf, die „Social Justice“-Bewegung bringe vor allem einen akademischen Jargon und unverständliches Gerede hervor. In der Aufregung darüber verbirgt sich eine Schwäche der Argumentation. Sie enthält zu viel Empörung und zu wenig Analyse: Denn was ist mit der Behauptung, es gebe keine Wahrheiten, sondern nur Diskurse der Macht? Trifft sie zu? Und wenn es so wäre: Wie kommt die Bewegung dazu, sich selbst für die Wahrheit zu halten, die sie allen anderen Diskursen abspricht? Oder was bedeutet soziale Konstruktion? Dass jede Identität eine Erfindung sei? Wäre das nicht eine Tautologie, bei der sich dann fragt, wer dann die Erfindung erfunden haben soll? An den Kernthesen der Theorie stößt, wer gründlich nachfragt, auf Dilemmata der theologischen Art. Das ist kein Zufall: Das Ansinnen, die Welt von den Normen einer rassischen oder sexuellen Identität und damit von allen schädlichen Machtansprüchen zu befreien, gehört zu einer Utopie, vielleicht sogar zu einem säkularen Erlösungsglauben.
Der zweite Mangel, der diese Streitschrift schwächt, besteht in der Überzeugung, die Bewegung stelle einen Angriff auf Liberalismus und Demokratie dar und sei schon deswegen verwerflich. Gewiss, sie tritt dem politischen Freisinn mit Misstrauen entgegen, und es trifft auch zu, dass die Bewegung dem Bemühen, ihr mit Argumenten beizukommen, dadurch zu begegnen sucht, dass sie sich weniger dem Argument als dessen Urheber zuwendet.
Doch lassen sich Theorien nicht mit dem Verweis auf ihre Folgen widerlegen. Neben eine politische Kritik hätte daher eine philosophische zu treten: Einer Bewegung, die an ihrer Prätention, nicht nur Theorie, sondern auch „scholarship“ zu sein, also akademische Forschung, scheint festhalten zu wollen, wäre nicht zuletzt mit Wissenschaft zu begegnen. Den Geistes- und Kulturwissenschaften käme dann die Aufgabe zu, bestimmte Theorien in den eigenen Reihen so zu widerlegen, dass ihre Geltungsansprüche aus empirischen wie logischen Gründen hinfällig werden. Das Buch, das Helen Pluckrose und David Lindsay zur Verteidigung des Liberalismus schrieben, wäre dann immerhin eine Vorbereitung für die Lösung dieser Aufgabe.
Es begann mit Quatsch-Aufsätzen:
Wenn man Hunde dressieren
kann, wieso nicht auch Männer?
Die radikale Skepsis der
Postmoderne wurde mit
sozialen Bewegungen verknüpft
Selbst die Mathematik ist dem
Vorwurf ausgesetzt, sexistisch
und rassistisch zu sein
Es gäbe Anlass genug, sich öfter
mit Argumenten statt mit
ihren Urhebern zu befassen
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de