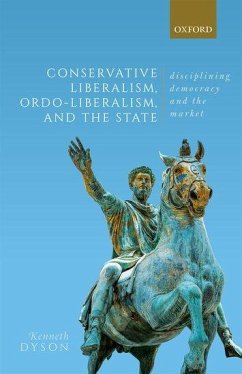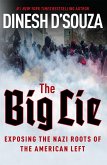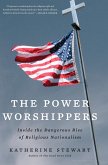Der Ordoliberalismus und seine Verwandten
Im Mainstream der Ökonomie als eine ältere und zahlenscheue deutsche Schulrichtung betrachtet, in Europa eher als schulmeisterliche Anmaßung empfunden, gilt der Ordoliberalismus oft als eine germanische Marotte. So macht es neugierig, dass Oxford University Press ein Buch präsentiert, dessen Titel ganz anders klingt: "Conservative Liberalism, Ordoliberalism, and the State. Disciplining Democracy and the Market".
Der Ordoliberalismus soll als eine politische Ökonomie im klassischen Sinne verstanden werden, die eine auf Regeln basierende Ordnung entwirft, um sowohl den Markt als auch die Massendemokratie vor selbstzerstörerischen Entwicklungen zu bewahren, worin sie den liberalkonservativen Traditionen verschiedener (westlicher) Länder gleicht. Autor Kenneth Dyson, der bis zur Emeritierung an der University of Cardiff lehrte, will nicht nur die unterschiedlichen Ansätze im deutschen Ordoliberalismus darstellen, sondern auch die internationale Gemeinsamkeit eines liberalkonservativen Ordnungsdenkens, die er als Familienähnlichkeit bezeichnet.
War das Laissez-faire-System unfähig, Machtkonzentrationen zu verhindern, weshalb Vorschläge zur Reform des Liberalismus darum kreisten, nicht "Markt gegen Staat" zu setzen, sondern über "Markt mit Staat" nachzudenken, so schildert Dyson den Ordoliberalismus als die durchdachteste Antwort auf das Dilemma, den Staat als Korrektiv zu nutzen und ihn dennoch an ständiger Einmischung hindern zu wollen. Die Freiburger suchten der Quadratur des Kreises, nämlich der Inanspruchnahme und gleichzeitigen Begrenzung des Staates, durch eine grundlegende Unterscheidung zu entkommen. Der Staat soll Regeln entwickeln und durchsetzen, aber nicht selbst in das Wirtschaftsgeschehen eingreifen. Regelsteuerung statt Prozesssteuerung. Das verlangt gerade nach vorhersehbaren Abläufen und unabhängigen Institutionen, also nach Einschränkung des demokratischen Majoritätsprinzips.
Außerhalb Deutschlands fanden die Freiburger am ehesten Anklang, wenn sie von einer Geldpolitik sprachen, die auf strikten Regeln beruhen und möglichst automatisch funktionieren sollte, was etwa die Rückkehr zum Goldstandard empfahl. Die Unabhängigkeit von Zentralbanken erschien wegen der Abhängigkeit von den persönlichen Qualitäten der Beteiligten nur als zweitbeste Lösung.
Von Eucken und Böhm als dem harten Kern des deutschen Ordoliberalismus unterscheidet Dyson einige weniger prägnante, aber keineswegs weniger einflussreiche Autoren wie Alexander Rüstow und Wilhelm Röpke. Dyson spricht von einem stärker ergebnisorientierten Ordoliberalismus, der mit der Freiburger Betonung von Prozessen und Regeln nicht immer harmonierte. Beide Varianten unterschieden sich auch in der Art ihres Erfolges. Die Freiburger bildeten trotz Euckens frühem Tod (1950) und Böhms politischer Karriere ein akademisches Netzwerk. Zehn Schüler Euckens erhielten einen Lehrstuhl, und dreien aus dieser zweiten Generation gelang es wiederum, je sieben ihrer Mitarbeiter auf einen Lehrstuhl zu helfen, wobei der damalige Ausbau der Universitäten wohl half. Rüstow und besonders Röpke hatten dagegen publizistischen Erfolg. So erreichte etwa Röpkes "Gesellschaftskrisis der Gegenwart" vier Ausgaben.
Danach widmet Dyson sich über mehrere Hundert Seiten seiner Absicht, den Ordoliberalismus in eine liberalkonservative Ideenbewegung etlicher Länder einzuordnen, wobei es ihm weniger um die Korrespondenz zwischen den Autoren geht und er internationale Konferenzen wie das "Colloque Walter Lippmann" von 1938 und die spätere "Mont Pèlerin Society" nur beiläufig erwähnt. Er konzentriert sich auf die intellektuellen Verwandtschaften. So folgen zunächst mehrere Kapitel über "Patron Saints". Als Vorläufer erscheinen "aristokratische" Liberale (Tocqueville, Acton, Ortega, Burckhardt), die kontinentaleuropäische ethische Philosophie "im Schatten Kants" (Rudolf Eucken, Nicolai Hartmann, Edmund Husserl und Max Scheler) und schließlich ein französischer Beitrag zum Denken in Regeln, die Institutionentheorie des Maurice Hauriou.
Dyson schildert, welche ähnlichen Konzepte regelorientierter Ordnung in verschiedenen Ländern entstanden. Das gilt für den Turiner Ökonomen und späteren Präsidenten Italiens, Luigi Einaudi, für Jacques Rueff, Maurice Allais und Louis Rougier in Frankreich oder Alan Peacock, Ralph Hawtrey und Lionel Robbins in Großbritannien. Fündig wird Dyson besonders in Amerika. Das reicht von der "Harvard School" des späteren Supreme-Court-Richters Louis Brandeis, der den Wettbewerb beschränken wollte, um ihn an der Selbstzerstörung zu hindern, zu Frank Knight, dem es wie den Freiburgern auf "disempowerment" ankam und der versuchte, seinen Schülern eine ordnungstheoretische Sicht zu vermitteln, was ihm bei Milton Friedman und George Stigler weniger gelang als bei James Buchanan.
Dysons Buch zeugt von imponierender Belesenheit des Autors. Es zerstreut die Befürchtung, der Ordoliberalismus sei eine deutsche Extravaganz, doch bestätigt es zugleich den Verdacht, der Wunsch, den Markt wie auch die Demokratie durch Regeln zu disziplinieren, finde sich allenfalls bei der Minderheit ebenso belesener Personen. MICHAEL ZÖLLER.
Kenneth Dyson: Conservative Liberalism, Ordoliberalism, and the State. Oxford University Press, Oxford 2021, 528 Seiten, 127 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main