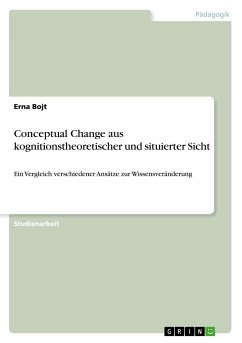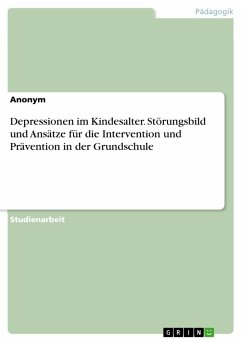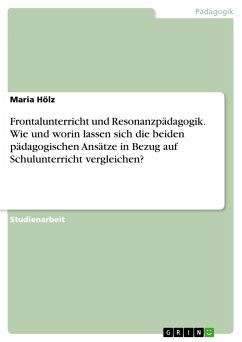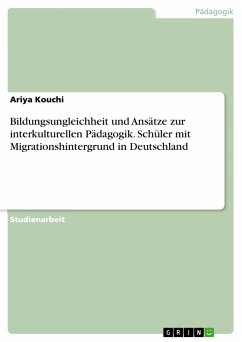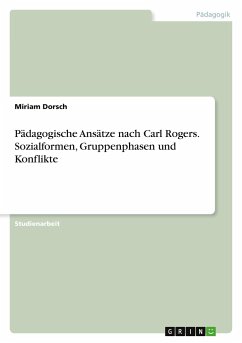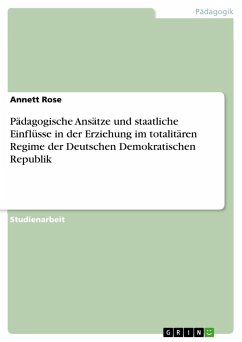Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Pädagogik - Wissenschaft, Theorie, Anthropologie, Note: 1, Fachhochschule Nordwestschweiz, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit untersucht den sogenannten Conceptual Change aus kognitionstheoretischer und situierter Sicht. Beginnend mit dem kognitiven Ansatz wird zuerst das kognitionstheoretische Modell von Jean Piaget vorgestellt, die die Basis für den Rahmentheorieansatz von Stella Vosniadou bildet. Es sollen diese Modelle hinsichtlich der Faktoren untersucht werden, wodurch sie ausgezeichnet sind, wie sie zusammenhängen und inwiefern Piagets Theorie die von Vosniadou beeinflusst und verändert hat. Danach soll näher auf Conceptual Change aus situierter Sicht eingegangen werden. Wygotskys Verständnis von Konzepten als Werkzeug für Aktionen in bestimmten Situationen ist ein konträrer Theorieansatz. Sehr interessant ist auch der Ansatz von Roger Säljö, der als radikal gilt und der in dieser Arbeit hervorgehoben werden soll. Er sieht Konzepte nicht nur als Werkzeuge für Aktivitäten in bestimmten Situationen, sondern diskutiert unter anderem auch über konzeptuelle Klassifikation. Dies beruht wiederum auf den Kategorisierungsansatz von Chi. Was genau bedeutet das? Welches sind die Kritikpunkte dieser Theorien?Lernende bilden, wissenschaftliche Phänomene betreffend, schon sehr früh eigene Theorien. Vom Anfang ihres Lebens konstruieren sie erworbenes Wissen aktiv zu Zusammenhängen. Bereits Babys besitzen ein Neugierverhalten und streben somit Wissenserwerb an, was schon früh einen grossen Schatz an Alltagswissen mit sich bringt. Ihre Ideen und Vorstellungen beziehen sie aus Erfahrungen, Erlebnissen und Informationen aus ihrem Alltag. Bereits vor Eintritt in die Schule haben sie viel Wissen konstruiert. Diese sogenannten naiven Theorien oder naiven Konzepte haben meistens noch nicht viel mit den wissenschaftlich korrekten Theorien zu tun. Es ist wichtig, dass sich diese kindlichen Konzepte verändern können und somit ein Konzeptwechsel stattfindet, damit der Lernende sich in der wissenschaftlichen Welt zurechtfinden kann. Schule bringt somit eine Reorganisation vorhandenen Wissens mit sich.Die Ideen, nicht die Konzepte zu betrachten, sondern die Reaktion und das Handeln Einzelner in spezifischen Situationen, gefallen mir sehr. Dieser Einbezug des sozialen und vor allem des historischen Kontextes könnte bestimmte viele Antworten beziehungsweise Reaktionen von Lernenden erklären.