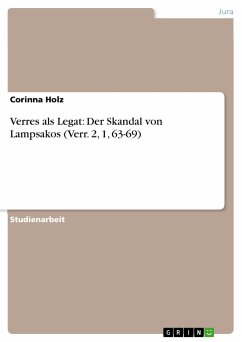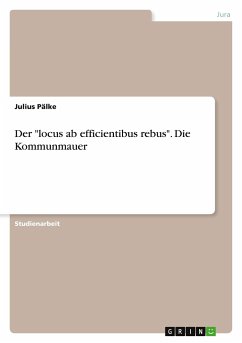Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich Jura - Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie, Rechtsgeschichte, Note: 16,0 Punkte, Ludwig-Maximilians-Universität München, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Darstellung eruiert zunächst Essentialia der Prozesssituation, vollzieht sodann wesentliche Stationen des Sachverhalts in ihrer rechtlichen Einbettung nach und interpretiert die widerstreitenden Argumente und Rechtsauffassungen von Anklage und Verteidigung gegliedert nach der jeweiligen Stoßrichtung. Die äußere Brisanz des Verfahrens, annäherungsweise auf das dritte Quartal des Jahres 56 datierbar, konnte dazu verleiten, es auf seinen "Stellvertretercharakter" zu reduzieren. Eine solch verkürzende Sichtweise anhand innerer Aspekte des Balbus- Prozesses zu widerlegen, hat sich die vorliegende Arbeit zu eigen gemacht. In den textimmanenten Grenzen der nahezu exklusiven Quelle, Ciceros Balbiana, soll dabei das überlagernde Politikum nach Möglichkeit hinter genuin juristisch-philologischen Erkenntnissen zurücktreten. Statusverfahren in Sachen Bürgerrecht waren ein probates juristisches Mittel in antiken Rechtsgemeinschaften. Gerade im spätrepublikanischen Rom wurde gegen vermeintliche Usurpatoren der "civitas Romana" prozessiert, gleichsam um Eigenes (proprium) von Fremdem (peregrinum) personell zu trennen. Durch eine bislang ungekannte machtpolitische Brisanz angereichert, sticht hier das Jahr 56 v. Chr. und die Anklage gegen Caesars Protegé Lucius Cornelius Balbus hervor. Der andalusische Feldstratege konnte zwar mit der Unterstützung des sog. 1. Triumvirats rechnen, war jedoch vor Gericht auf die Verteidigungskünste eines erfahrenen Advokaten wie Marcus Tullius Cicero angewiesen. Da nimmt es nicht wunder, wenn die Streitfrage, ein Verleihungsakt des Befehlshabers Pompeius zugunsten Balbus', im Plädoyer Ciceros alsbald merklich verblasst und durch Stellungnahmen zu den vertraglichen Beziehungen Roms mit dem andalusischen Cádiz überdeckt wird.. Formiert sich somit eine Grundsatzdebatte über die Provinzialautonomie, ist Anlass für einige Bemerkungen zum sog. "ius gentium" in bilateralen Konstellationen. Freilich münden auch diese Metathemen, am rekonstruierten Prozessgeschehen zu Ende gedacht, wieder im konkreten Rechtsfall und entscheiden die Frage: Durfte sich Balbus des Titels civis Romanus" berühmen?